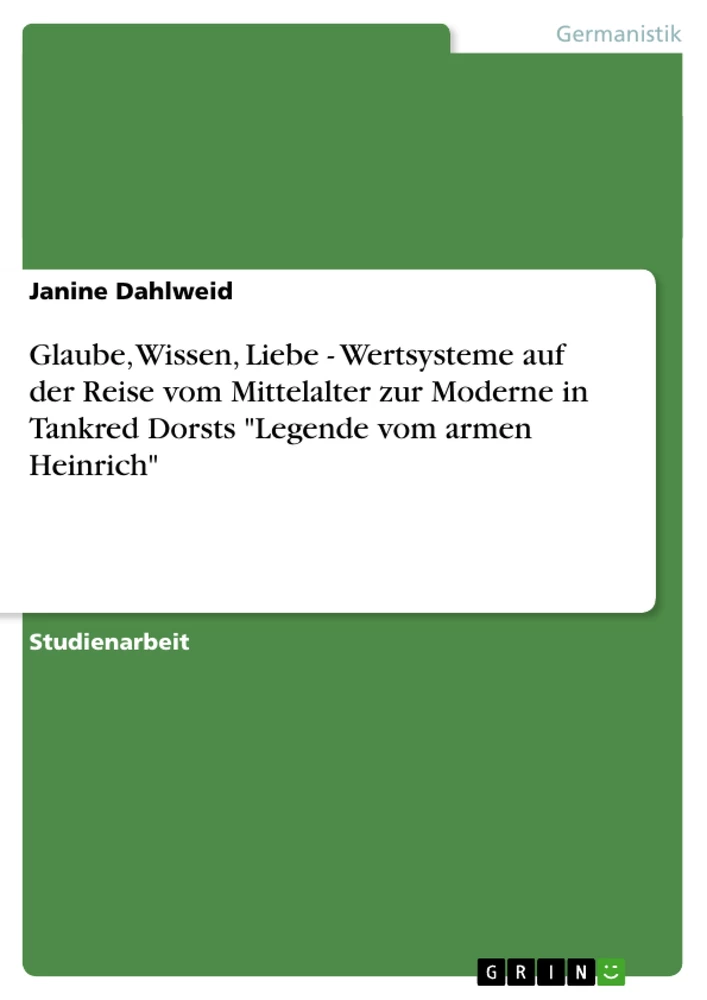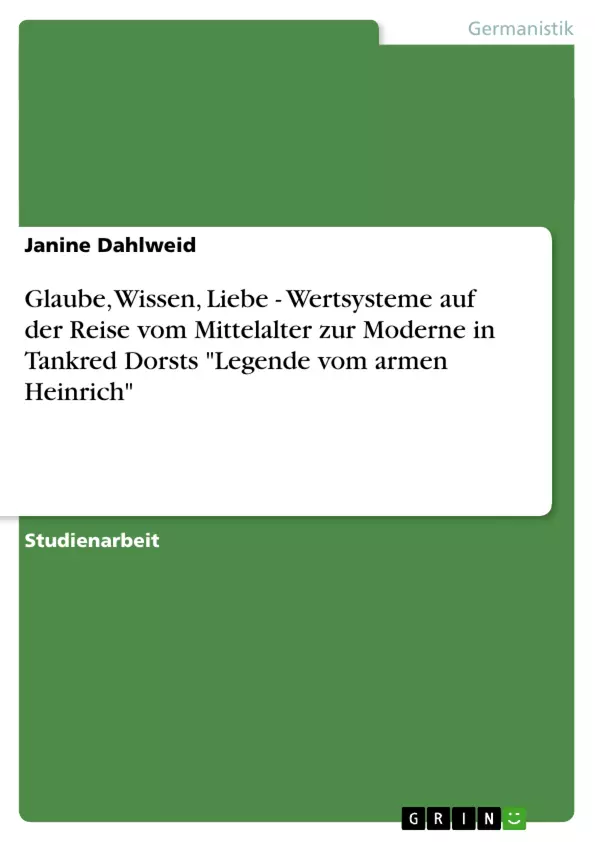Im Zentrum des mittelalterlichen Versepos von Hartmann von Aue steht Heinrich, ein tugendhafter und dem Ideal entsprechender Ritter, der in der Welt hohes Ansehen genießt. Die Weltzugewandtheit Heinrichs stellt zugleich sein Verderben dar, denn Gott bestraft bzw. prüft ihn, indem er ihn am Aussatz erkranken lässt. Seine Rettung beruht auf der Erkenntnis des allmächtigen Schöpfers - dass er sich Gott hingeben, ihm vertrauen und sich seinem Willen unterordnen muss. Als Kontrast zu Heinrich führt Hartmann das Mädchen ein, die fromme Tochter eines Bauern, die völlig der Welt abgewandt ist und ihre Seele retten möchte, indem sie sich für Heinrich opfert. Sie möchte ins Paradies gelangen und die Braut Christi werden. Auch sie wird am Ende geheilt, wenn sie die Welt, die die Schöpfung Gottes ist, akzeptiert. Das Hauptthema des mittelalterlichen Textes ist demzufolge die Beziehung des Menschen zu Gott und zu der von ihm geschaffenen Welt. Tankred Dorst problematisiert in seinem Drama „Die Legende vom armen Heinrich“ die Religiosität des modernen Menschen. Doch anders als Hartmann lässt Dorst die Ursachen der Erkrankung Heinrichs offen. Der Leser respektive der Zuschauer erfährt auch nicht den Namen der Krankheit. Eine weitere schwerwiegende Abweichung in der Ausgangslage der Geschichte ist die Distanzierung der Bauernfamilie von ihrem Herrn Heinrich. Dieser wird von ihnen als selbstsüchtiger Herr geschildert, der kein Mitleid verdient hat, weshalb er in einem dunklen Turm im Wald einsam haust. Ein weiterer Unterschied zu Hartmanns Version besteht in der ausführlichen Gestaltung der Reise nach Salerno, die im mittelalterlichen Versepos nur kurz als Fakt erwähnt wird. Das Wunder, das heißt die Heilung geschieht nicht aufgrund der Hingabe zu Gott, sondern in dem Moment als sich Heinrich und Elsa umarmen. Aus diesen Differenzen zwischen beiden literarischen Bearbeitungen des Stoffes lässt sich folgern, dass es Dorst nicht um die Gottergebenheit des Menschen geht, sondern um die zwei Hauptcharaktere Heinrich und Elsa, wobei erwähnt werden muss, dass das Mädchen Elsa hier im Vergleich zu Hartmanns Text in den Vordergrund rückt, denn es erhält bei Dorst einen Namen und mehr Raum in der Darstellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Glauben und Wissen“ – Jürgen Habermas
- Charakterisierung der Hauptfiguren vor Beginn der Reise bis zum Labyrinth
- Elsa die Welt des Glaubens
- Heinrich - die Welt der Ratio
- Wandlung, Erkenntnis und Wunder - die Liebe
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Tankred Dorsts Drama „Die Legende vom armen Heinrich“ und untersucht, wie er die Religiosität des modernen Menschen im Kontext der mittelalterlichen Legende vom armen Heinrich problematisiert. Dabei wird insbesondere auf die Beziehung zwischen Glauben, Wissen und Liebe im Werk eingegangen.
- Vergleich zwischen Hartmanns mittelalterlicher Version und Dorsts moderner Interpretation der Legende
- Die Darstellung der Hauptfiguren Heinrich und Elsa und ihre jeweiligen Wertsysteme
- Die Rolle des Wunders und die Bedeutung von Emotion und Liebe in Dorsts Stück
- Die Einbindung von verschiedenen Zeitaltern der Menschheitsgeschichte in das Drama
- Die Verbindung von Glaube, Wissen und Liebe als drei zentrale Wertsysteme in Dorsts Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Grundzüge des mittelalterlichen Versepos von Hartmann von Aue und Tankred Dorsts Drama „Die Legende vom armen Heinrich“ vor. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Bedeutung des Glaubens für den Menschen im modernen Kontext.
Das zweite Kapitel analysiert die Rede von Jürgen Habermas aus dem Jahr 2001, die sich mit den Themen Glaube, Wissen und Liebe auseinandersetzt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die beiden Hauptfiguren, Heinrich und Elsa, vor Beginn ihrer Reise. Es wird gezeigt, wie Elsa die Welt des Glaubens verkörpert und Heinrich die Welt der Ratio repräsentiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Wandlung der Hauptfiguren auf ihrer Reise und dem zentralen Thema der Liebe als drittem Wertsystem neben Glaube und Wissen. Die Bedeutung des Wunders und der Heilung wird im Zusammenhang mit der Entwicklung von Heinrich und Elsa betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenkomplex von Glauben, Wissen und Liebe in Tankred Dorsts Drama „Die Legende vom armen Heinrich“. Wichtige Schwerpunkte liegen auf der Analyse der Hauptfiguren Heinrich und Elsa, der Rolle des Wunders und der Verbindung von verschiedenen Zeitaltern der Menschheitsgeschichte mit den drei Wertsystemen.
Häufig gestellte Fragen zu Tankred Dorsts "Armer Heinrich"
Wie unterscheidet sich Tankred Dorsts Version von der mittelalterlichen Legende?
Dorst lässt die Ursache der Krankheit offen und stellt die Liebe und menschliche Emotionen in den Vordergrund, statt der reinen Gottergebenheit.
Welche Rolle spielt die Figur Elsa?
Elsa verkörpert die Welt des Glaubens. Im Gegensatz zum Original erhält sie bei Dorst einen Namen und eine tiefere psychologische Ausgestaltung.
Was symbolisiert Heinrich in Dorsts Drama?
Heinrich repräsentiert die Welt der Ratio (Vernunft) und des Zweifels des modernen Menschen gegenüber religiösen Wundern.
Wie geschieht die Heilung im modernen Stück?
Die Heilung vollzieht sich im Moment der menschlichen Umarmung und Liebe zwischen Heinrich und Elsa, was als drittes Wertsystem neben Glaube und Wissen fungiert.
Welche Themen werden im Kontext von Jürgen Habermas diskutiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Habermas' Diskurs über das Verhältnis von Glauben und Wissen in der säkularen Moderne.
- Quote paper
- Janine Dahlweid (Author), 2003, Glaube, Wissen, Liebe - Wertsysteme auf der Reise vom Mittelalter zur Moderne in Tankred Dorsts "Legende vom armen Heinrich", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45627