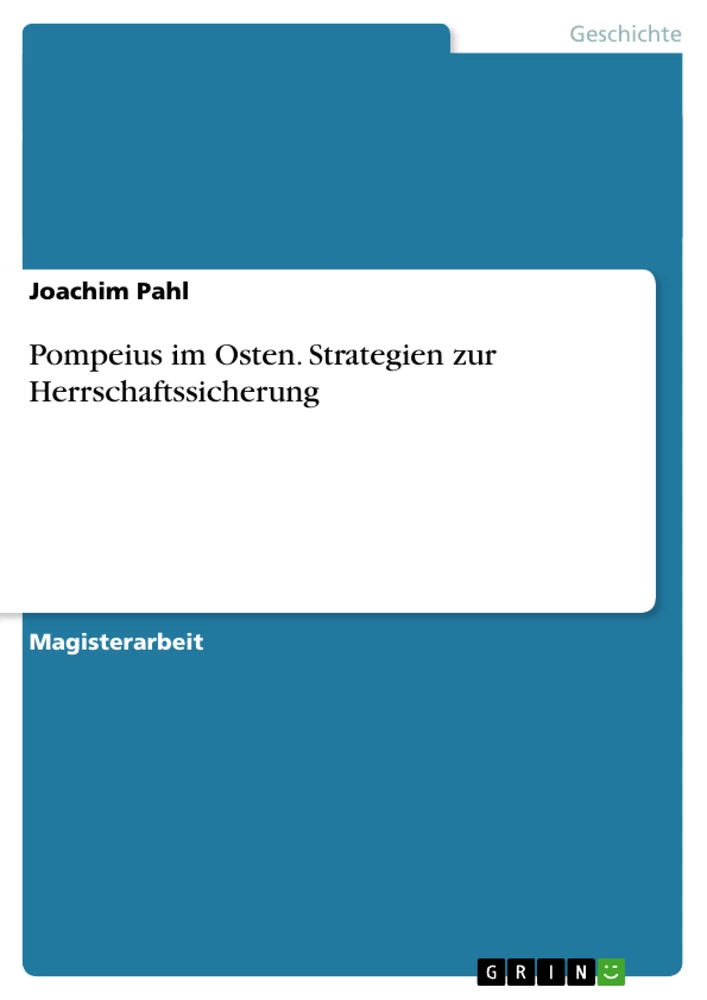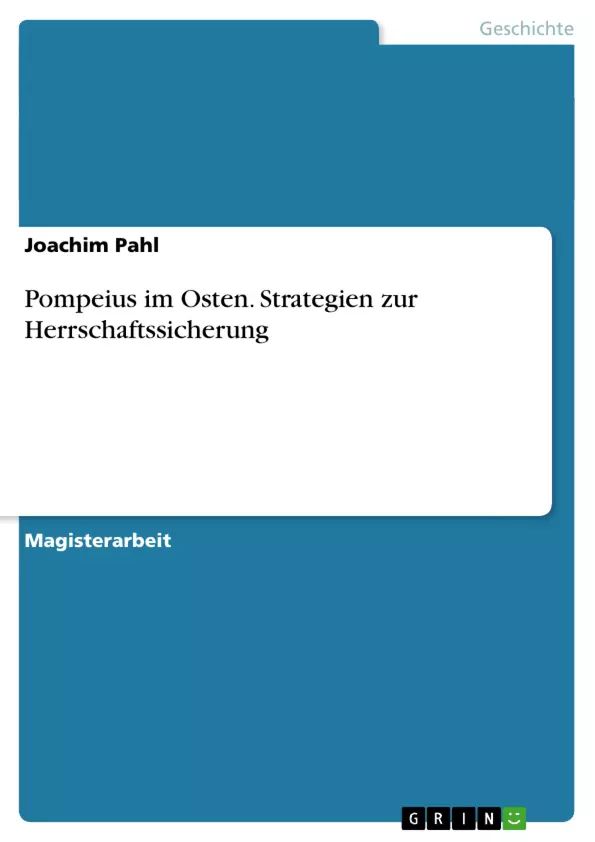Während des zweiten Jahrhunderts vor Christi hatte das Römische Reich Phasen großer Veränderungen und damit verbunden ebenso großer Verunsicherungen zu überstehen, die hauptsächlich aus der Tatsache resultierten, daß der Kleinstaat Rom seinen Machtbereich sukzessive ausgeweitet hatte. Diese Erweiterung betraf zunächst nur Italien, später jedoch die gesamte Mittelmeerregion. Innerhalb dieses Herrschaftsgebietes hatten die unterworfenen Länder unterschiedlichen Rechtsstatus. Innerhalb Italiens wurden sie meist Bundesgenossen genannt, was freilich einen Euphemismus darstellte, da ihre Bürger zwar die gleichen Pflichten hatten wie römische Vollbürger, besonders was den Wehrdienst anging, nicht aber eine Mitbestimmung wie diese.
Außerhalb des italischen Kernlandes begann man Provinzen einzurichten, die Rom vollkommen unterstellt waren, gleichwohl ihre alten Verwaltungsträger behalten durften1; dies mußte schon deshalb geschehen, weil Rom wohl personell überfordert gewesen wäre, hätte es diese Aufgaben selbst übernommen. Darüber hinaus gab es jedoch auch in den peripheren Regionen Klientelstaaten2, die nach innen weitgehend autonom gelassen wurden, nach außen sich jedoch an Rom auszurichten hatten3 und zur Waffengefolgschaft sowie meist zur Tributleistung verpflichtet waren.
Unter dem Druck der Umstände und gegen en Widerstand der Optimaten gelang es schließlich der popularen Seite, Pompeius zunächst im Jahre 67 gegen die Seeräuber und ein Jahr später gegen Mithridates mit Außerordentlichen Imperien auszustatten, die Machtmittel in einem Umfange einschlossen, wie sie vorher noch nie einer Einzelperson anvertraut worden waren.
Wie diese Machtmittel in Anwendung gebracht wurden, und wie die hierbei erzielten militärischen Resultate in politisch-strukturelle Veränderungen umgemünzt wurden, die dem Römischen Reich einen dauerhaften Nutzen bringen sollten, wird anhand von Quellen untersucht werden. Auch soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die Regelungen des Pompeius richtungsweisend für die weitere Entwicklung des Römischen Reiches gewesen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellen
- Der Seeräuberkrieg
- Das Wesen der Piraterie
- Der kurze Feldzug
- Die clementia gegenüber den Seeräubern
- Der Mithridatische Krieg
- Vorbereitungen
- Pompeius Vormarsch
- Pompeius Verhalten nach Mithridates' Flucht
- Die Gewinnung Armeniens
- ,,Auf Alexanders Spuren“
- Die Neuordnung des Ostens
- Das Verhältnis zu Parthien
- Pontos und Bithynia
- Syrien
- Kilikien
- Paphlagonien
- Galatien
- Kappadokien
- Kommagene
- Judäa
- Ziele und Prinzip der Neugliederung
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herrschaftssicherungsstrategien Pompeius' im Osten des Römischen Reiches, die während des zweiten Jahrhunderts vor Christi eine Phase großer Veränderungen und Verunsicherungen erlebte. Der Fokus liegt dabei auf Pompeius' militärischen Feldzügen gegen die Seeräuber und Mithridates, sowie der anschließenden Neuordnung des Ostens.
- Pompeius' Feldzüge gegen die Seeräuber und Mithridates
- Die Rolle der clementia in Pompeius' Herrschaftssicherungsstrategien
- Die politische und administrative Neuordnung des Ostens nach den Feldzügen
- Die Bedeutung von Macht und Einfluss in der römischen Republik
- Die Auswirkungen von Pompeius' Handlungen auf die weitere Entwicklung des Römischen Reiches
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den historischen Kontext, in dem Pompeius' Herrschaftssicherungsstrategien im Osten des Römischen Reiches zu verstehen sind. Es wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus der expansiven Politik Roms ergaben, insbesondere die Unterschiede im Rechtsstatus der unterworfenen Länder. Die Einleitung führt außerdem die wichtigsten Quellen ein, auf die sich die Arbeit stützt.
Das Kapitel "Der Seeräuberkrieg" beleuchtet Pompeius' Vorgehen gegen die Piraterie, die zu dieser Zeit das Mittelmeer unsicher machte. Das Kapitel analysiert die Ursachen und Folgen der Piraterie, sowie Pompeius' Strategie zur Bekämpfung der Seeräuber. Dabei werden die militärischen und politischen Aspekte von Pompeius' Vorgehen beleuchtet.
Das Kapitel "Der Mithridatische Krieg" befasst sich mit Pompeius' Feldzug gegen den pontischen König Mithridates. Die Vorbereitung und Durchführung des Feldzugs werden im Detail dargestellt. Das Kapitel analysiert auch Pompeius' Verhalten nach Mithridates' Flucht und die anschließende Gewinnung Armeniens.
Das Kapitel "Die Neuordnung des Ostens" untersucht die politischen und administrativen Veränderungen, die Pompeius nach seinen Feldzügen im Osten einleitete. Es werden die Auswirkungen seiner Herrschaftssicherungsstrategien auf die einzelnen Regionen des Ostens, wie z.B. Parthien, Pontos, Bithynia, Syrien, Kilikien, Paphlagonien, Galatien, Kappadokien, Kommagene und Judäa, betrachtet.
Das Kapitel "Ziele und Prinzip der Neugliederung" analysiert die Ziele und Prinzipien, die Pompeius bei der Neuordnung des Ostens leiteten. Das Kapitel geht auf die Frage ein, inwiefern Pompeius' Strategien zur Stabilisierung des Römischen Reiches beigetragen haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der römischen Expansion, Herrschaftssicherung, militärischen Strategien, politischer und administrativer Neuordnung, sowie der Rolle von Pompeius in der römischen Republik. Dabei werden Begriffe wie Seeräuberkrieg, Mithridatischer Krieg, clementia, Provinzorganisation, Klientelstaaten und die Bedeutung von Macht und Einfluss in der römischen Republik beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Welche Strategien nutzte Pompeius zur Herrschaftssicherung im Osten?
Pompeius kombinierte militärische Stärke mit politischer Neuordnung, indem er Provinzen einrichtete und Klientelstaaten schuf, die Rom gegenüber zur Treue verpflichtet waren.
Welche Rolle spielte die „clementia“ in Pompeius’ Vorgehen?
Die Milde (clementia) gegenüber Besiegten, besonders im Seeräuberkrieg, diente dazu, ehemalige Gegner als loyale Untertanen oder Siedler zu gewinnen und langfristigen Frieden zu sichern.
Wie ging Pompeius gegen die Piraterie im Mittelmeer vor?
Er erhielt außerordentliche Vollmachten und säuberte das Mittelmeer in einem überraschend kurzen Feldzug von 67 v. Chr., indem er die logistischen Zentren der Seeräuber zerschlug.
Was war das Ziel der Neuordnung des Ostens nach dem Mithridatischen Krieg?
Ziel war die Schaffung einer stabilen Pufferzone gegen äußere Feinde (wie die Parther) und die Sicherung regelmäßiger Tribute für Rom durch eine klare administrative Gliederung.
Inwiefern waren Pompeius’ Regelungen richtungsweisend für das Römische Reich?
Seine Methode der Provinzialverwaltung und das System der Klientelkönige bildeten die strukturelle Basis für die spätere imperiale Herrschaft Roms im östlichen Mittelmeerraum.
- Citar trabajo
- Magister Joachim Pahl (Autor), 2005, Pompeius im Osten. Strategien zur Herrschaftssicherung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45632