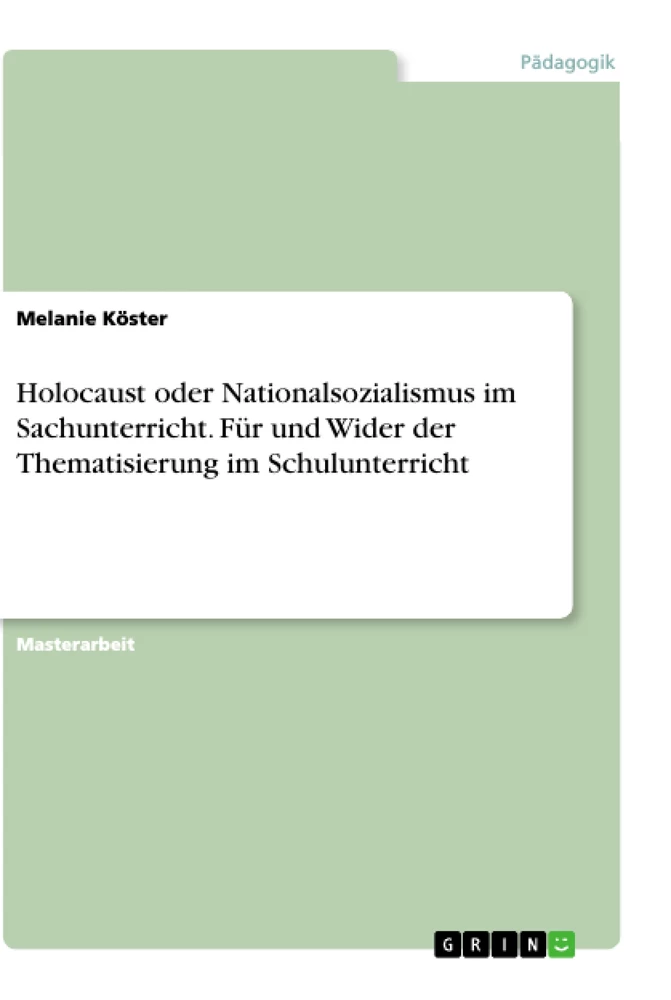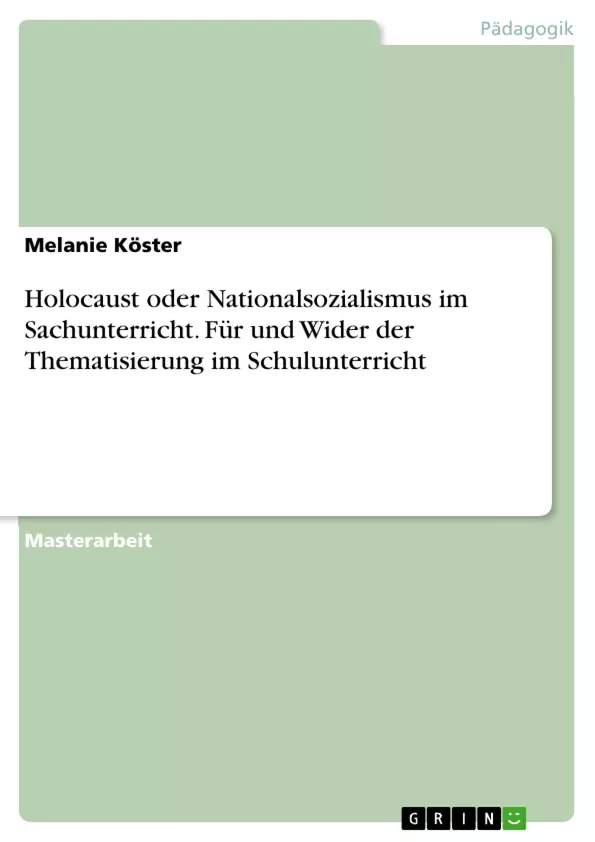In der vorliegenden Abschlussarbeit soll durch die theoretische Auseinandersetzung mit ausgewählter, wissenschaftlicher Fachliteratur geklärt werden, in welchem Verhältnis die vermeintlichen Risiken zu den möglichen Chancen einer unterrichtlichen Behandlung von Nationalsozialismus und Holocaust stehen und somit der Frage nachgegangen werden, ob und mit welcher Begründung eine praktische Umsetzung dieser Themen in der Grundschule erforderlich ist. Weiterhin soll untersucht werden, wie eine angemessene Vermittlung dieses Unterrichtsgegenstandes in der Primarstufe aufgebaut und umgesetzt werden kann.
Die seit den letzten Monaten verstärkt aufkommenden Medienberichterstattungen über judenfeindliche Vorfälle an deutschen Schulen waren Ausgangspunkt für die Themenauswahl dieser Abschlussarbeit. Insbesondere für Grundschullehrer/innen stellt sich dabei die Frage, ob eine Prävention gegen antisemitische und rassistische Anfeindungen, durch die Thematisierung des Nationalsozialismus und Holocausts, bereits in der Primarstufe möglich wäre. Weiterhin ist es relevant, in welcher Form diese sensiblen Themen an Grundschulkinder vermittelt werden können ohne sie kognitiv und emotional zu überlasten, sie aber dennoch ausreichend über die Entstehung von Vorurteilen und Ausgrenzung aufzuklären.
Im Rahmen der ersten Recherchen wurde schnell erkenntlich, dass Nationalsozialismus und Holocaust zu jenen Thematiken gehören, welche in Grundschulen immer noch unter allen historischen Unterrichtsstoffen, von Lehrern, Eltern sowie von Schulbuchverlagen am kritischsten betrachtet und am meisten umgangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Rahmenbedingungen
- 3.1 Was soll der Sachunterricht leisten und welche Aufgaben hat er zu erfüllen?
- 3.2 Begründung und Ziele der historischen Perspektive im Sachunterricht
- 3.3 Holocaust und Nationalsozialismus in den Bestimmungen der Lehr-, Rahmenplänen und Kerncurricula der Bundesländer für den Heimat- und Sachunterricht an Grundschulen
- 4. Begründung einer unterrichtlichen Behandlung von Nationalsozialismus in der Grundschule
- 4.1 Werden Kinder bereits im Grundschulalter mit den Themen Holocaust und Nationalsozialismus konfrontiert und welchen Platz nehmen sie in ihrer Lebenswelt ein?
- 4.2 Warum ist das Thema gerade jetzt hochaktuell?
- 4.3 Antisemitismus in der Grundschule?
- 4.4 Exkurs: Forschung von Andra Becher über die Vorstellungskonzepte von Kindern über Nationalsozialismus und Holocaust
- 5. Risiken und Herausforderungen
- 5.1 Der scheinbar fehlende Zugang
- 5.2 Tod und Gewalt als emotionale Belastung für Kinder
- 5.3 Keine reine Opfergeschichte
- 5.4 Zur Komplexität des Themas
- 6. Chancen der frühen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder dem Holocaust in der Grundschule
- 7. Welche Kompetenzen können ausgebildet oder gefördert werden?
- 8. Methodisch-Theoretischer Ansatz: Wie vermittelt man die Themen Nationalsozialismus oder Holocaust kindgerecht und kompetenzorientiert?
- 8.1 Grundlegendes zur Vorgehensweise und zum Aufbau der Unterrichtseinheit
- 8.1.1 Wann kann und sollte das Thema eingeleitet werden?
- 8.1.2 Die Einführungs- und Erarbeitungsphase nach den „Schritten historischen Denkens nach Bergmann“
- 8.1.3 Der Abschluss
- 8.2 Zentrale Inhalte und grundlegende Verstehensprozesse
- 8.3 Fach- und Themenspezifische Methoden
- 8.3.1 Der Geschichtsraum als offener und vertrauter Raum zugleich
- 8.3.2 Eigenständiges Lernen und Handlungsorientierung
- 8.3.3 Identifikationsfiguren als Zugang
- 8.3.4 Perspektivenübernahme und Perspektivenwechsel
- 8.4 Quellen, Material und Lernorte
- 8.4.1 Grundlegendes zur Materialauswahl
- 8.4.2 Historische Kinderbelletristik
- 8.4.3 Erzählungen von Zeitzeugen (Oral History)
- 8.4.4 Außerschulische Lernorte
- 8.1 Grundlegendes zur Vorgehensweise und zum Aufbau der Unterrichtseinheit
- 9. Erfahrungen aus der Schulpraxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Behandlung von Holocaust und Nationalsozialismus im Sachunterricht der Grundschule. Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die didaktischen Ansätze für eine kindgerechte und kompetenzorientierte Vermittlung dieser sensiblen Themen. Ziel ist es, eine fundierte Argumentation für oder gegen eine frühe Auseinandersetzung mit diesem Thema zu liefern und praktische Empfehlungen für die Unterrichtsgestaltung zu geben.
- Möglichkeiten und Risiken der Thematisierung von Holocaust und Nationalsozialismus in der Grundschule
- Didaktische Ansätze für eine altersgerechte Vermittlung
- Präventive Wirkung im Hinblick auf Antisemitismus und Rassismus
- Kompetenzentwicklung bei Kindern durch die Auseinandersetzung mit der Thematik
- Auswertung des aktuellen Forschungsstandes und der didaktischen Diskussion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit wird durch aktuelle Fälle von Antisemitismus an deutschen Schulen motiviert und fragt nach der Möglichkeit und Notwendigkeit einer präventiven Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust bereits in der Grundschule. Es wird die Problematik der Thematik angesprochen, sowohl was die Überforderung der Kinder als auch die Unsicherheit der Lehrer angeht. Die Arbeit stellt die Frage in den Raum, ob die Vermeidung dieser Themen zu unmündigen und unpolitischen Schülern führt.
2. Forschungsstand: (Es fehlt eine Beschreibung des Inhalts von Kapitel 2 im gegebenen Text. Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
3. Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Aufgaben des Sachunterrichts und die Bedeutung der historischen Perspektive. Es analysiert die Berücksichtigung von Holocaust und Nationalsozialismus in den Lehrplänen der Bundesländer.
4. Begründung einer unterrichtlichen Behandlung von Nationalsozialismus in der Grundschule: Dieses Kapitel untersucht, ob Grundschulkinder bereits mit dem Thema konfrontiert sind und warum es aktuell hochaktuell ist. Es befasst sich mit Antisemitismus in der Grundschule und integriert den Forschungsstand von Andra Becher zu den Vorstellungskonzepten von Kindern über Nationalsozialismus und Holocaust.
5. Risiken und Herausforderungen: Das Kapitel thematisiert die potenziellen Schwierigkeiten bei der Behandlung des Themas, wie den scheinbar fehlenden Zugang für Kinder, die emotionale Belastung durch Tod und Gewalt, die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit, über eine reine Opferperspektive hinauszugehen.
6. Chancen der frühen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder dem Holocaust in der Grundschule: (Es fehlt eine Beschreibung des Inhalts von Kapitel 6 im gegebenen Text. Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
7. Welche Kompetenzen können ausgebildet oder gefördert werden?: (Es fehlt eine Beschreibung des Inhalts von Kapitel 7 im gegebenen Text. Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
8. Methodisch-Theoretischer Ansatz: Wie vermittelt man die Themen Nationalsozialismus oder Holocaust kindgerecht und kompetenzorientiert?: Dieses Kapitel präsentiert einen methodisch-theoretischen Ansatz zur kindgerechten und kompetenzorientierten Vermittlung der Themen. Es beschreibt den Aufbau einer Unterrichtseinheit, inklusive der Auswahl geeigneter Materialien und Methoden, sowie die Berücksichtigung der verschiedenen Lernstufen.
9. Erfahrungen aus der Schulpraxis: (Es fehlt eine Beschreibung des Inhalts von Kapitel 9 im gegebenen Text. Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Holocaust, Nationalsozialismus, Sachunterricht, Grundschule, Antisemitismus, Prävention, Didaktik, Kindgerechte Vermittlung, Kompetenzorientierung, Geschichtsdidaktik, Emotionale Belastung, Risiken, Chancen, Lehrpläne, Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Holocaust und Nationalsozialismus im Sachunterricht der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Behandlung von Holocaust und Nationalsozialismus im Sachunterricht der Grundschule. Sie analysiert den aktuellen Forschungsstand, die rechtlichen Rahmenbedingungen und didaktische Ansätze für eine kindgerechte und kompetenzorientierte Vermittlung dieser sensiblen Themen. Ziel ist es, eine fundierte Argumentation für oder gegen eine frühe Auseinandersetzung mit diesem Thema zu liefern und praktische Empfehlungen für die Unterrichtsgestaltung zu geben.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Möglichkeiten und Risiken der Thematisierung, didaktische Ansätze für eine altersgerechte Vermittlung, präventive Wirkung im Hinblick auf Antisemitismus und Rassismus, Kompetenzentwicklung bei Kindern und die Auswertung des aktuellen Forschungsstandes und der didaktischen Diskussion. Konkret werden die Aufgaben des Sachunterrichts, die Berücksichtigung des Themas in Lehrplänen, die Konfrontation von Grundschulkindern mit dem Thema, Antisemitismus in der Grundschule, potentielle Schwierigkeiten wie der Zugang für Kinder, emotionale Belastung, Komplexität des Themas und die Notwendigkeit, über eine reine Opferperspektive hinauszugehen, sowie methodisch-theoretische Ansätze zur kindgerechten und kompetenzorientierten Vermittlung untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Rahmenbedingungen, Begründung einer unterrichtlichen Behandlung, Risiken und Herausforderungen, Chancen der frühen Auseinandersetzung, förderbare Kompetenzen, methodisch-theoretischer Ansatz und Erfahrungen aus der Schulpraxis. Die Kapitel behandeln jeweils spezifische Aspekte der Thematik, von der theoretischen Grundlage bis hin zu praktischen Umsetzungsempfehlungen und Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis.
Wie wird das Thema kindgerecht vermittelt?
Die Arbeit präsentiert einen methodisch-theoretischen Ansatz zur kindgerechten und kompetenzorientierten Vermittlung. Dieser beinhaltet den Aufbau einer Unterrichtseinheit, die Auswahl geeigneter Materialien und Methoden, die Berücksichtigung verschiedener Lernstufen und den Einsatz von verschiedenen didaktischen Ansätzen wie z.B. Geschichtsraum, eigenständiges Lernen, Identifikationsfiguren, Perspektivenübernahme und den Einsatz von Kinderliteratur und Zeitzeugenberichten.
Welche Risiken und Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert den scheinbar fehlenden Zugang für Kinder, die emotionale Belastung durch Tod und Gewalt, die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit, über eine reine Opferperspektive hinauszugehen. Sie diskutiert die potenziellen Schwierigkeiten bei der Behandlung des Themas im Grundschulunterricht und bietet Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen.
Welche Chancen bietet eine frühe Auseinandersetzung mit dem Thema?
(Hinweis: Der Text enthält keine detaillierte Beschreibung der Chancen. Eine umfassende Antwort auf diese Frage ist anhand des vorliegenden Textes nicht möglich.)
Welche Kompetenzen können durch die Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert werden?
(Hinweis: Der Text enthält keine detaillierte Beschreibung der förderbaren Kompetenzen. Eine umfassende Antwort auf diese Frage ist anhand des vorliegenden Textes nicht möglich.)
Welche Materialien und Methoden werden empfohlen?
Die Arbeit empfiehlt den Einsatz von historischen Kinderbüchern, Erzählungen von Zeitzeugen (Oral History) und außerschulischen Lernorten. Der methodische Ansatz betont eigenständiges Lernen, Handlungsorientierung, Perspektivenübernahme und Perspektivenwechsel.
Gibt es Erfahrungen aus der Schulpraxis?
(Hinweis: Der Text enthält keine detaillierte Beschreibung von Erfahrungen aus der Schulpraxis. Eine umfassende Antwort auf diese Frage ist anhand des vorliegenden Textes nicht möglich.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Holocaust, Nationalsozialismus, Sachunterricht, Grundschule, Antisemitismus, Prävention, Didaktik, kindgerechte Vermittlung, Kompetenzorientierung, Geschichtsdidaktik, emotionale Belastung, Risiken, Chancen, Lehrpläne, Forschungsstand.
- Citation du texte
- Melanie Köster (Auteur), 2018, Holocaust oder Nationalsozialismus im Sachunterricht. Für und Wider der Thematisierung im Schulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456443