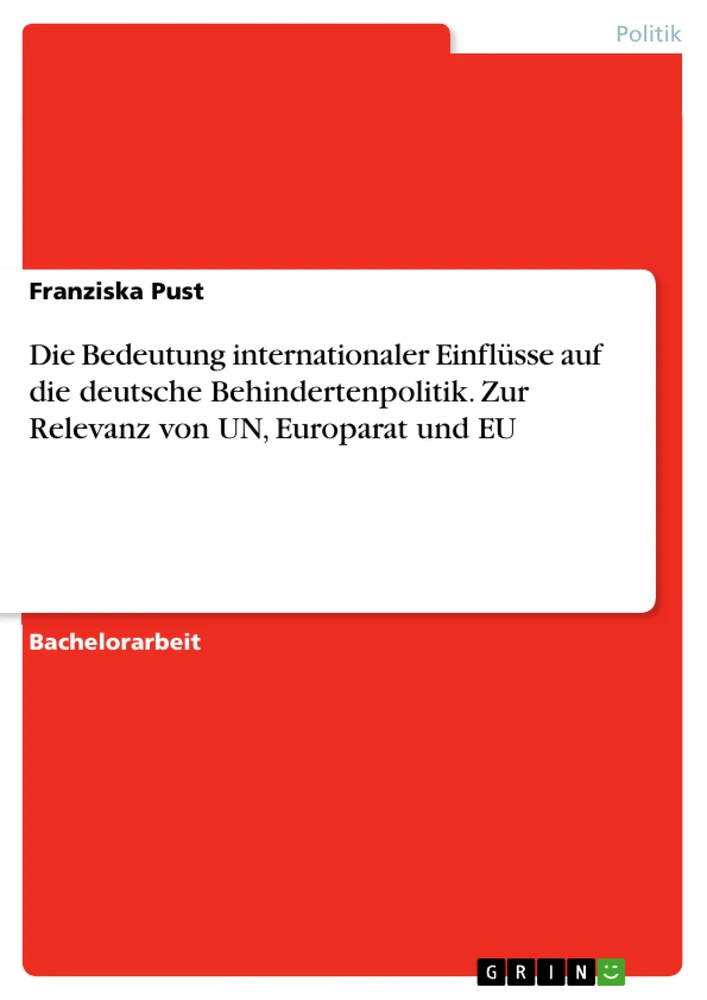Zentral für diese Arbeit ist die Frage, wie sich der angesprochene Wandel in der deutschen Behindertenpolitik vor dem Hintergrund internationaler Organisationen vollzogen hat. Es soll aufgezeigt werden, welche Relevanz von dem politischen Gestaltungsprozess in einem politischen Mehrebenensystem ausgeht und welche Einflüsse das internationale System auf die deutsche Behindertenpolitik hat.
Es wird zunächst ein historischer Überblick über die deutsche Behindertenpolitik gegeben, der den gesellschaftlichen und politischen Wandel in diesem Politikfeld im Verlauf der letzten Jahrzehnte verdeutlicht. Ein kurzer Einblick in die jeweilige Behindertenpolitik der Bundesregierungen soll zudem zeigen, dass sich grundlegende Wertunterschiede der Parteien auch in diesem Politikfeld finden lassen.
Es folgt die Darstellung der Entstehungsgeschichte und die wichtigsten Etappen der Behindertenpolitik der Vereinten Nationen als global agierende internationale Organisation. Hier wird besonders die UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung den Schwerpunkt dargestellt.
Der Europarat ist die bedeutendste internationale Organisation auf dem europäischen Kontinent. Die 47 Mitgliedstaaten sind, neben den Mitgliedern der Europäischen Union, nahezu über den gesamten europäischen Kontinent, bis an die Grenze zu China, verbreitet. Ihre menschenrechtsfördernde Funktion hat neben der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) noch weitere für behinderte Menschen relevante Dokumente hervorgebracht, die im Folgenden näher dargelegt werden.
Der größte Einfluss auf die deutsche Politik geht unbestritten von der Europäischen Union als, in großen Teilen, supranationaler Staatenverbund aus. Durch die rasant voranschreitende europäische Integration, hat auch die Behindertenpolitik auf dieser Ebene große Fortschritte gemacht. Es wird auch hier ein umfangreicher Überblick über die verschiedenen Etappen gegeben. Um die Frage nach den Einflüssen des internationalen Systems und der Implementierung neuer Werte und Regeln analysieren zu können, werden der Ansatz der Compliance Forschung sowie Teildisziplinen des Institutionalismus vorgestellt, bevor ein abschließendes Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Analyserahmen
- 2.1. Normativ-reflexiver Institutionalismus und Neo-Institutionalismus
- 2.2. Compliance-Forschung
- 3. Die deutsche Behindertenpolitik
- 3.1. Vorbedingungen für eine deutsche Behindertenpolitik
- 3.2. Invalidenpolitik - 1945-1960
- 3.3. Behindertenpolitik ab 1970
- 3.4. Die Behindertenpolitik der 1990er Jahre
- 3.5. Paradigmenwechsel der deutschen Behindertenpolitik ab 1998
- 3.6. Behindertenpolitik der Bundesregierungen von Brandt bis Merkel
- 4. Die Behindertenpolitik der Vereinten Nationen
- 4.1. Die Entstehung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- 4.2. Aufbau der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- 5. Die Behindertenpolitik des Europarats
- 6. Historische Entwicklung der Behindertenpolitik in der Europäischen Union
- 6.1. Gemeinschaftliche Beziehungen ohne gemeinsame europäische Behindertenpolitik
- 6.2. Die europäische Behindertenpolitik und ihre Stagnation
- 6.3. Neuer Antrieb durch Förderung - Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre
- 6.4. Von der Rehabilitation zu Gleichberechtigung und Diskriminierungsschutz – 1996 bis 2003
- 6.5. Impuls des Jahres der Menschen mit Behinderungen
- 6.6. Aktuelle und zukünftige Entwicklungen in der europäischen Behindertenpolitik
- 7. Die Entwicklung der Behindertenpolitik aus theoretischer Sicht
- 8. Supranationalisierung der deutschen Behindertenpolitik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der deutschen Behindertenpolitik im Kontext internationaler Einflüsse. Ziel ist es, die Relevanz von UN, Europarat und EU für den politischen Gestaltungsprozess im Mehrebenensystem aufzuzeigen. Dabei werden die wichtigsten Etappen der deutschen Behindertenpolitik beleuchtet und der Einfluss internationaler Organisationen auf die deutsche Behindertenpolitik analysiert.
- Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Behindertenpolitik
- Der Einfluss von UN, Europarat und EU auf die deutsche Behindertenpolitik
- Die Rolle internationaler Abkommen und Konventionen für die deutsche Behindertenpolitik
- Der Paradigmenwechsel in der deutschen Behindertenpolitik hin zu einem menschenrechtsbasierten Ansatz
- Die Herausforderungen und Chancen der Supranationalisierung der deutschen Behindertenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Behindertenpolitik für die deutsche Gesellschaft dar und skizziert die zentrale Fragestellung der Arbeit. Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Rahmen der Arbeit und erläutert den normativ-reflexiven Institutionalismus und die Compliance-Forschung. Kapitel 3 bietet einen historischen Überblick über die deutsche Behindertenpolitik und beleuchtet die Entwicklung von der Invalidenpolitik bis zur heutigen menschenrechtlich geprägten Politik. Kapitel 4 untersucht die Entstehung und Entwicklung der Behindertenpolitik der Vereinten Nationen und stellt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in den Fokus. Kapitel 5 beleuchtet die Behindertenpolitik des Europarats und stellt die wichtigsten Dokumente und Aktivitäten in diesem Bereich vor. Kapitel 6 analysiert die historische Entwicklung der Behindertenpolitik in der Europäischen Union und zeigt die Herausforderungen und Chancen für eine gemeinsame europäische Behindertenpolitik auf. Kapitel 7 betrachtet die Entwicklung der Behindertenpolitik aus theoretischer Sicht und Kapitel 8 untersucht die Supranationalisierung der deutschen Behindertenpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Behindertenpolitik, internationale Einflüsse, UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, Europarat, Europäische Union, Normativ-reflexiver Institutionalismus, Compliance-Forschung, Menschenrechte, Inklusion, Paradigmenwechsel, Supranationalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche internationalen Organisationen beeinflussen die deutsche Behindertenpolitik?
Die Arbeit nennt primär die Vereinten Nationen (UN), den Europarat und die Europäische Union (EU) als maßgebliche Akteure.
Was ist der wichtigste Meilenstein der UN in diesem Bereich?
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) wird als zentrales Dokument für einen menschenrechtsbasierten Ansatz hervorgehoben.
Wie hat sich das Leitbild der deutschen Behindertenpolitik gewandelt?
Es gab einen Paradigmenwechsel von der ursprünglichen Invalidenpolitik (Versorgung) hin zu Inklusion, Gleichberechtigung und Diskriminierungsschutz.
Welche Rolle spielt die EU für behinderte Menschen in Deutschland?
Die EU übt als supranationaler Staatenverbund durch rasant voranschreitende Integration und spezifische Richtlinien den größten direkten Einfluss auf die nationale Gesetzgebung aus.
Was untersucht die Compliance-Forschung in diesem Zusammenhang?
Sie analysiert, inwieweit Deutschland internationale Vorgaben und Regeln tatsächlich in nationales Recht umsetzt und befolgt.
- Quote paper
- Franziska Pust (Author), 2012, Die Bedeutung internationaler Einflüsse auf die deutsche Behindertenpolitik. Zur Relevanz von UN, Europarat und EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456817