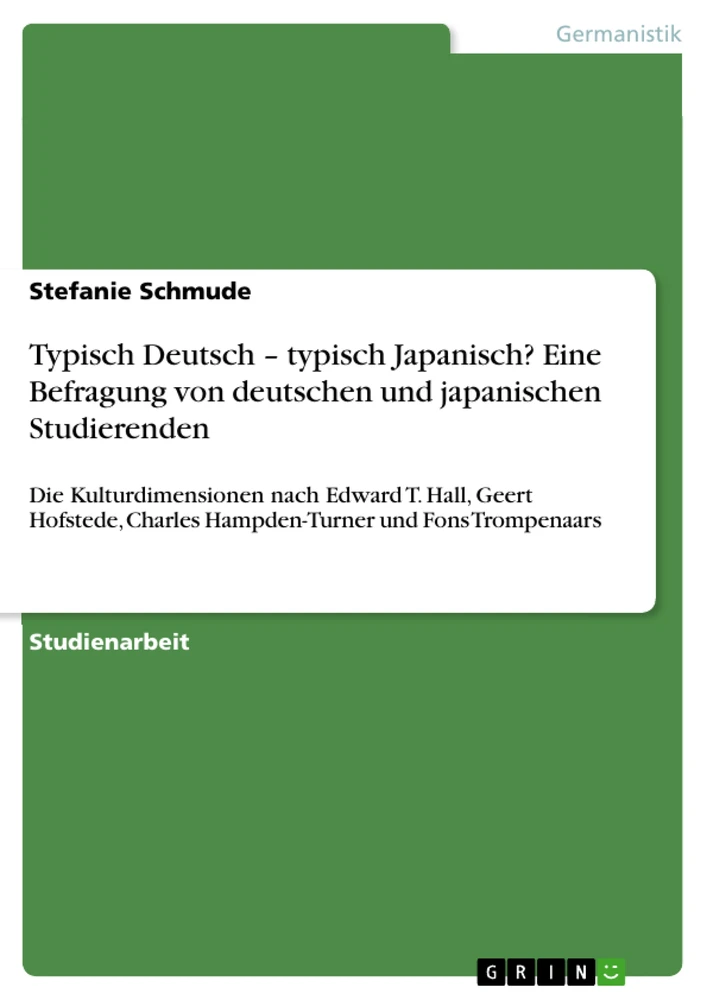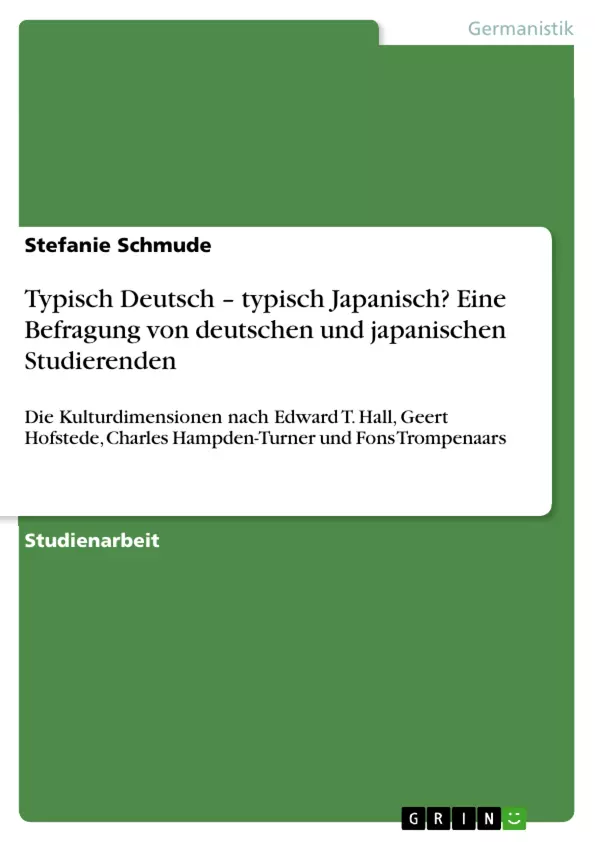Die Seminararbeit aus dem Bereich der Interkulturellen Kommunikation analysiert und interpretiert die Ergebnisse einer Fragebogenaktion unter deutschen und japanischen. Der Fragebogen ist von Sonja Vandermeeren anhand der Kulturdimensionen und Stereotype von Hofstede, Trompenaars und Hall entwickelt worden. Die relativ große Zahl der Fragen ist für Studierende zumutbar, bei anderen Befragten hätte der Fragebogen deutlich kürzer ausfallen müssen. Um signifikante Unterschiede zu ermitteln, ist der Chi-Quadrat-Test im Programm SPSS zur Anwendung gekommen.
Es gibt viele Versuche einer Definition von Kultur. Kultur kann als all das vom Menschen Geschaffene, also nicht natürlich Vorkommende verstanden werden. Kultur kann auch mit der Hochkultur identifiziert werden, mit Kunst, Religion und Wissenschaft. Auf einer anderen Ebene gehört zur Kultur nicht nur Materielles, sondern auch die Weise, wie Menschen denken. Kultur wird tradiert, sie wird erlernt, nicht vererbt.
Gert Hofstede definiert Kultur als „die kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet.“ Charles Hampdon-Turner und Fons Trompenaars definieren Kultur als Art und Weise, wie eine Gruppe von Menschen Probleme löst. Kulturen sind wandelbar, entweder durch intrakulturelle Veränderungen oder durch Einflüsse von außen. Dazu gehört zum Beispiel die Übernahme fremdkultureller Charakteristika wie Yoga oder Sprache, wobei die Adaption in der Regel nicht vollständig geschieht, sondern von der eigenen Umwelt angepasst wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problem
- 2. Methode
- 3. Ergebnisse
- 3.1. Ergebnisse der ersten Fragebatterie
- 3.2. Ergebnisse der zweiten Fragebatterie
- 3.3. Ergebnisse der dritten Fragebatterie
- 3.4. Ergebnisse der vierten Fragebatterie
- 4. Diskussion und Ausblick
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen deutscher und japanischer Kultur anhand einer Fragebogenbefragung unter Studierenden. Ziel ist es, diese kulturellen Unterschiede mithilfe der Kulturdimensionen nach Hall, Hofstede, Hampden-Turner und Trompenaars zu analysieren und zu interpretieren.
- Definition und Herausforderungen der Kulturbeschreibung
- Analyse kultureller Unterschiede mithilfe von Kulturdimensionen
- Vergleichende Betrachtung der deutschen und japanischen Kultur
- Kommunikationsstile und deren Bedeutung in interkulturellen Kontexten
- Einfluss kultureller Werte auf Verhalten und Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problem: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Kultur und den Schwierigkeiten, sie zu erfassen und zu beschreiben. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition von Kultur vorgestellt, von der Betrachtung als vom Menschen geschaffenem Gegenstück zur Natur bis hin zur Definition als kollektive Programmierung des Geistes (Hofstede). Die Arbeit beleuchtet die Komplexität von Kultur und die problematische Gleichsetzung von Kultur und Nation. Die Bedeutung von Kulturstandards als allgemein akzeptierte Verhaltensweisen wird hervorgehoben, ebenso wie die Herausforderungen interkultureller Kommunikation, die durch unterschiedliche Kulturstandards entstehen können. Das Kapitel betont die Notwendigkeit einer Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede, um Missverständnisse zu vermeiden und die Chancen interkultureller Begegnungen zu nutzen.
1.1. Kulturdimensionen nach Hall: Dieses Kapitel stellt die Kulturdimensionen nach Edward T. Hall vor, insbesondere die Unterscheidung zwischen "High-Context" und "Low-Context"-Kommunikation. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in direkter und indirekter Kommunikation sowie den daraus resultierenden Missverständnissen in interkulturellen Kontexten. Weiterhin wird Halls Unterscheidung zwischen monochroner und polychroner Zeitwahrnehmung erläutert, die unterschiedliche Ansätze der Zeitplanung und -organisation in verschiedenen Kulturen verdeutlicht. Schließlich wird die Bedeutung von räumlicher Distanz und deren kulturelle Variation in der Kommunikation angesprochen.
1.2. Kulturdimensionen nach Hofstede: Dieses Kapitel präsentiert die Kulturdimension "Machtdistanz" nach Geert Hofstede. Es beschreibt das Ausmaß, in dem weniger einflussreiche Mitglieder einer Gesellschaft eine ungleiche Machtverteilung akzeptieren oder ablehnen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Kulturen mit hoher und niedriger Machtdistanz und den Auswirkungen auf Organisationsstrukturen, Führungsstile und Kommunikation innerhalb dieser Kulturen. Der Unterschied zwischen einer direkten Konfrontation von Macht und einem eher konsensorientierten Ansatz wird diskutiert, wobei Deutschland als Beispiel für eine Kultur mit geringer Machtdistanz herangezogen wird.
Schlüsselwörter
Kulturdimensionen, interkulturelle Kommunikation, Deutschland, Japan, Edward T. Hall, Geert Hofstede, Charles Hampden-Turner, Fons Trompenaars, Hoch- und Tiefkultur, Machtdistanz, Zeitverständnis (Monochronie/Polychronie), Kommunikationsstile.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen deutscher und japanischer Kultur anhand einer Fragebogenstudie mit Studierenden. Sie analysiert diese Unterschiede mithilfe der Kulturdimensionen verschiedener Autoren wie Hall, Hofstede, Hampden-Turner und Trompenaars.
Welche Kulturdimensionen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt verschiedene Kulturdimensionen, darunter Halls Unterscheidung zwischen „High-Context“ und „Low-Context“-Kommunikation, seine Konzepte von monochroner und polychroner Zeitwahrnehmung und räumlicher Distanz. Weiterhin wird Hofstedes Dimension der „Machtdistanz“ analysiert. Weitere Autoren wie Hampden-Turner und Trompenaars werden vermutlich ebenfalls einbezogen, jedoch nicht explizit im vorliegenden Auszug genannt.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Untersuchung basiert auf einer Fragebogenbefragung unter Studierenden. Die Ergebnisse dieser Befragung werden in mehreren Kapiteln (3.1-3.4) detailliert dargestellt und analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Problem, 2. Methode, 3. Ergebnisse (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Fragebatterien), 4. Diskussion und Ausblick, 5. Literaturverzeichnis und 6. Anhang.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Analyse und Interpretation kultureller Unterschiede zwischen Deutschland und Japan anhand der ausgewählten Kulturdimensionen. Die Arbeit soll ein Verständnis für die Bedeutung kultureller Werte für Verhalten und Interaktion in interkulturellen Kontexten vermitteln.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit Kulturbeschreibung angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und Beschreibung von Kultur, die problematische Gleichsetzung von Kultur und Nation und die Herausforderungen interkultureller Kommunikation aufgrund unterschiedlicher Kulturstandards. Die Komplexität von Kultur und die Notwendigkeit einer Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kulturdimensionen, interkulturelle Kommunikation, Deutschland, Japan, Edward T. Hall, Geert Hofstede, Charles Hampden-Turner, Fons Trompenaars, Hoch- und Tiefkultur, Machtdistanz, Zeitverständnis (Monochronie/Polychronie), Kommunikationsstile.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Ergebnisse der Fragebogenbefragung werden in vier Unterkapiteln (3.1 bis 3.4) des Kapitels „Ergebnisse“ präsentiert. Der genaue Inhalt dieser Unterkapitel ist im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben.
Was beinhaltet das Kapitel "Diskussion und Ausblick"?
Der Inhalt des Kapitels "Diskussion und Ausblick" ist im vorliegenden Auszug nicht beschrieben. Es wird jedoch angenommen, dass hier die Ergebnisse interpretiert, diskutiert und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gegeben wird.
- Citation du texte
- Stefanie Schmude (Auteur), 2014, Typisch Deutsch – typisch Japanisch? Eine Befragung von deutschen und japanischen Studierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456893