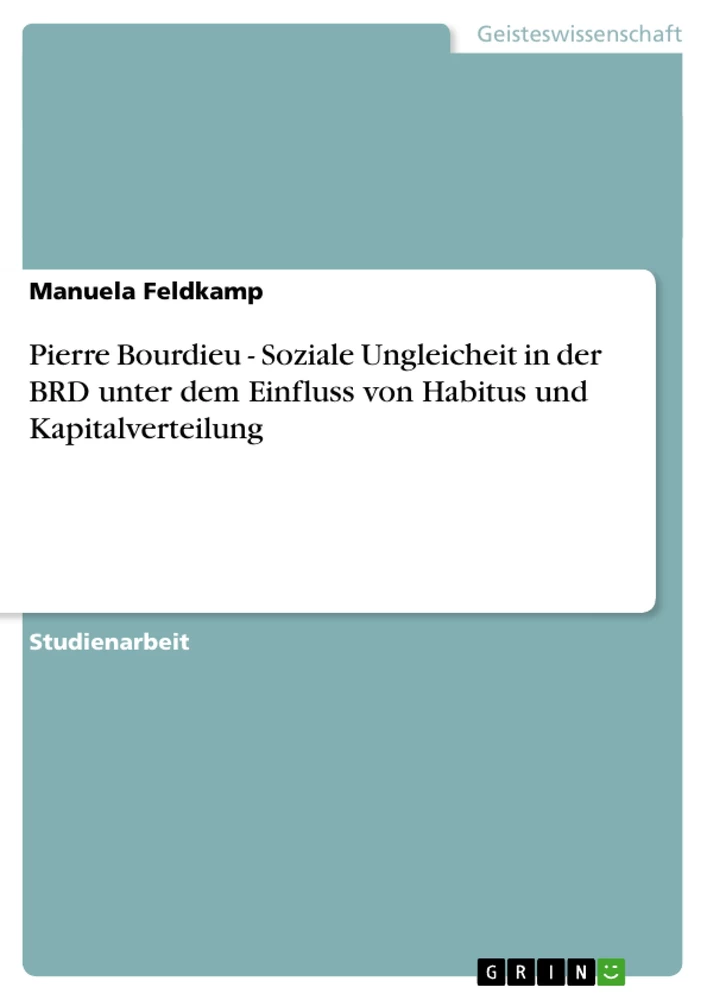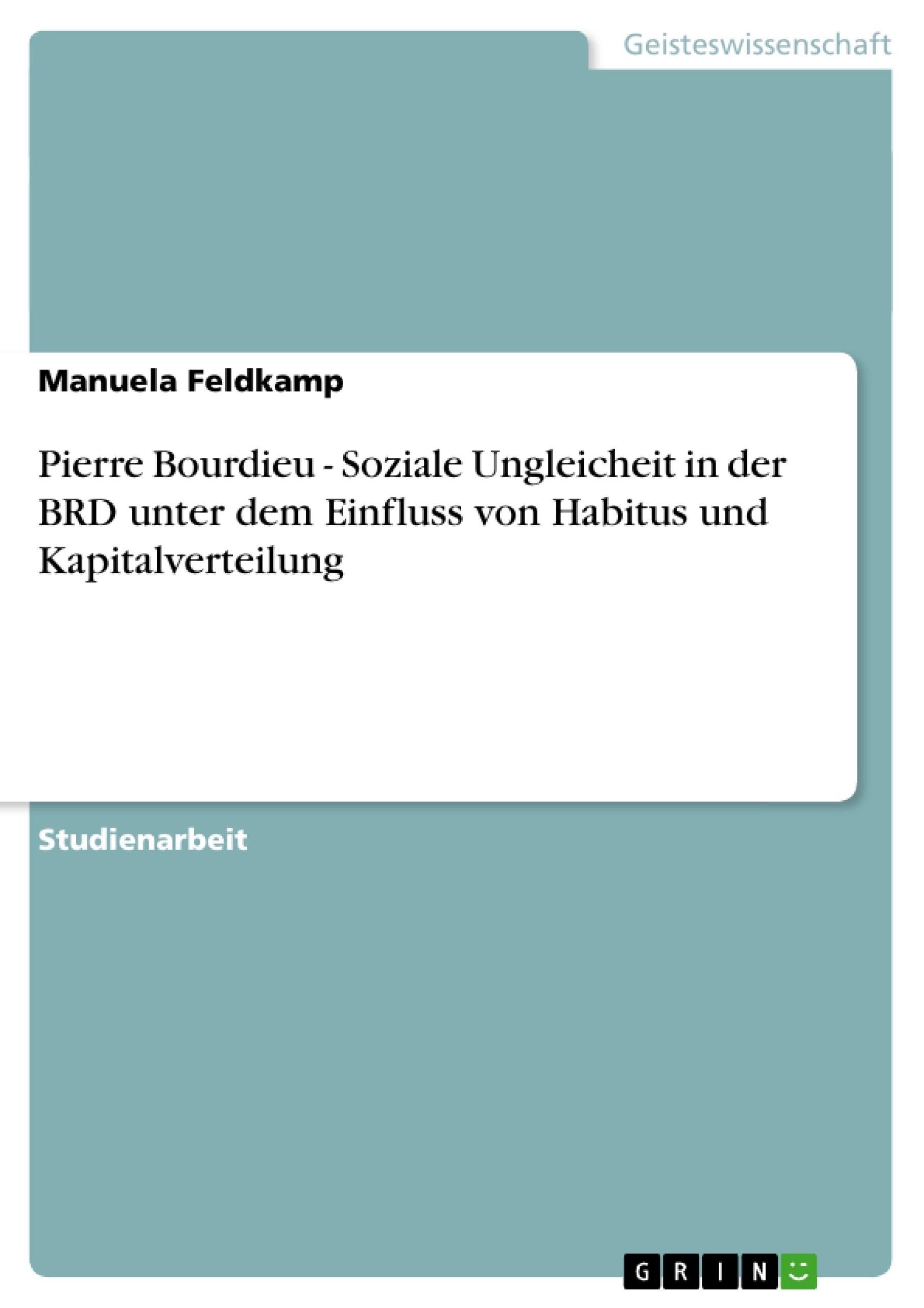"Pierre Bourdieu ist [...] nicht nur und nicht primär ein Homo academicus." (Bohn/Hahn 1999: 252) Wie ist diese Aussage zu bewerten? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Bourdieu hat Zeit seines Lebens und darüber hinaus dafür gesorgt, dass Kritiker und Befürworter seiner Theorien einen fortwährenden Diskurs über ben diese Frage und seine Rolle als Wissenschaftler führen.
Aus den Reihen der Wissenschaft wurde er unter anderem oftmals mit dem Vorwurf konfrontiert, "seine Theorie sei deterministisch, lasse keine Veränderungen zu und führe daher zu politischem Fatalismus." (Steinrücke 1992:9) Seine Befürworter hingegen schätzen, dass bei ihm "Theorie und empirische Untersuchung nicht getrenn nebeneinander stehen, sondern eng aufeinander bezogen sind." (Krais/Gebauer 2002:14) Bourdieu plädierte immer wieder dafür, dass die Soziologie sich den Blick für das Alltägliche bewahren muss und die gegenwärtigen Probleme der Gesellschaft für sie von hoher Wichtigkeit sein sollten. Die Autorin hat ein besonderes Interesse für die Frage, inwieweit der Habitus und Kapitalformen, zwei zentrale Aspekte in Bourdieus Schriften, sich auf den Stand eines Individuums in unserer Gesellschaft und auf eine mögliche soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland auswirken können. Sie stellt diese Frage deshalb in den Mittelpunkt ihrer Beobachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Soziale Ungleichheit - eine kurze Definition
- 2. Bourdieu-Habitus und Kapitalformen
- 2.1 Das Konzept des Habitus
- 2.1.1 Der Ursprung der Habitustheorie
- 2.1.2 Der Habitus als Dispositionssystem sozialer Akteure
- 2.2 Die Kapitalformen
- 2.2.1 Ökonomisches Kapital
- 2.2.2 Kulturelles Kapital
- 2.2.2.1 Objektiviertes kulturelles Kapital
- 2.2.2.2 Inkorporiertes kulturelles Kapital
- 2.2.2.3 Institutionalisiertes kulturelles Kapital
- 2.2.3 Soziales Kapital
- 2.1 Das Konzept des Habitus
- 3. Bourdieus Kritik - ein Problem der französischen Gesellschaft?
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Pierre Bourdieus Theorie der sozialen Ungleichheit, insbesondere im Kontext der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Bedeutung von Habitus und Kapitalformen für die soziale Positionierung von Individuen und die Reproduktion sozialer Strukturen.
- Bourdieus Habitus-Konzept und seine Bedeutung für soziale Handlungen und Lebensstile
- Die verschiedenen Formen von Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) und ihre Bedeutung für die soziale Ungleichheit
- Die Übertragbarkeit von Bourdieus Theorien auf die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle von Klasse und Lebensstil in Bourdieus Klassenmodell
- Die Auswirkungen von Habitus und Kapital auf soziale Ungleichheit in der BRD
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz von Bourdieus Theorie für die Analyse sozialer Ungleichheit heraus und skizziert die zentralen Themen der Arbeit.
- Kapitel 1 bietet eine kurze Definition des Begriffs "soziale Ungleichheit" und legt den Grundstein für die spätere Analyse der Rolle von Habitus und Kapital.
- Kapitel 2 beleuchtet das Habitus-Konzept und die verschiedenen Formen von Kapital nach Bourdieu. Es analysiert die Bedeutung dieser Konzepte für die soziale Positionierung von Individuen.
- Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit Bourdieus Erkenntnisse auch auf die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland übertragen werden können.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Habitus, Kapital, Klasse, Lebensstil, Pierre Bourdieu, Bundesrepublik Deutschland, Soziologie, Reproduktion, Sozialstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Pierre Bourdieu unter dem Begriff „Habitus“?
Der Habitus ist ein System dauerhafter Dispositionen, das das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen basierend auf seiner sozialen Herkunft prägt.
Welche Kapitalformen unterscheidet Bourdieu?
Er unterscheidet ökonomisches Kapital (Geld/Besitz), kulturelles Kapital (Bildung/Wissen) und soziales Kapital (Beziehungen/Netzwerke).
Wie entsteht soziale Ungleichheit laut Bourdieu?
Ungleichheit entsteht durch die ungleiche Verteilung der Kapitalformen und die Reproduktion dieser Strukturen über den Habitus, der den Zugang zu Chancen beeinflusst.
Was ist der Unterschied zwischen inkorporiertem und institutionalisiertem Kulturkapital?
Inkorporiertes Kapital ist verinnerlichtes Wissen und Bildung, während institutionalisiertes Kapital formale Bildungsabschlüsse und Titel bezeichnet.
Lassen sich Bourdieus Theorien auf Deutschland übertragen?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit Habitus und Kapitalverteilung auch in der Bundesrepublik Deutschland zur sozialen Positionierung und Ungleichheit beitragen.
Warum wird Bourdieus Theorie oft als deterministisch kritisiert?
Kritiker werfen ihm vor, dass sein Modell kaum Raum für individuelle Veränderungen lasse und somit zu politischem Fatalismus führen könne.
- Quote paper
- M.A. Manuela Feldkamp (Author), 2005, Pierre Bourdieu - Soziale Ungleicheit in der BRD unter dem Einfluss von Habitus und Kapitalverteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45727