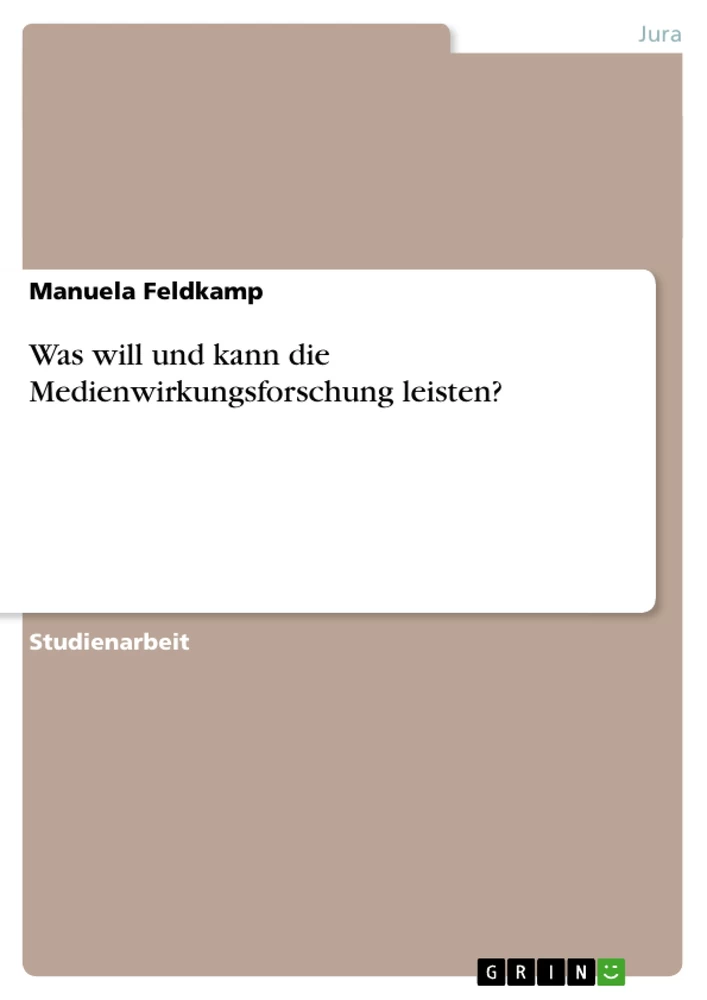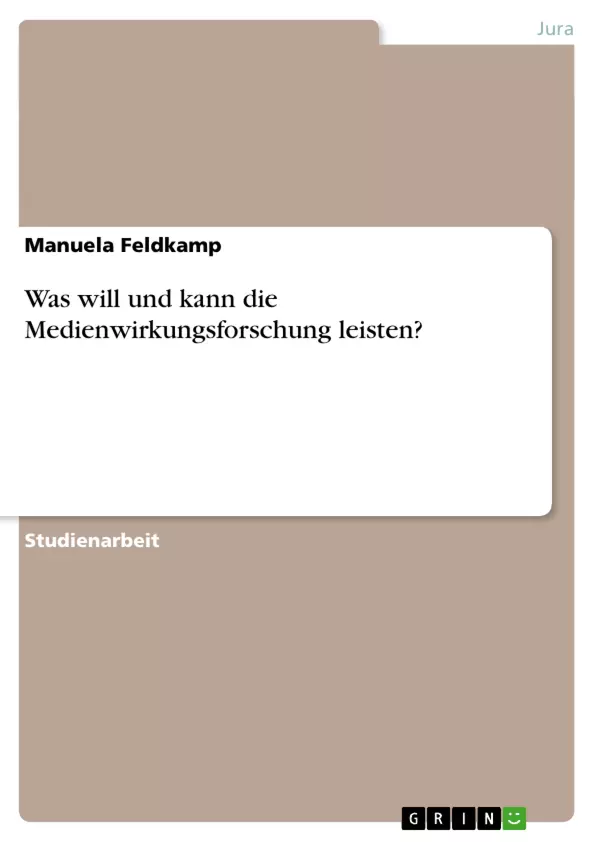„Gewalt erzeugt Gegengewalt“ sang die Popgruppe Die Ärzte im Jahre 1996 und bezog sich dabei auf gewaltsame Konflikte zwischen Jugendlichen. Dass dieser Aussage während der vergangenen Jahre immer größere Bedeutung zugekommen ist, wird vornehmlich den Medien und ihren Angeboten angelastet. Genährt wird diese Schuldzuweisung immer dann, wenn dramatische Ereignisse einen Rückschluss vom Medienkonsum der Akteure auf deren Verhaltensweisen zulassen. Im Kreuzfeuer der Kritik steht neben Computerspielen, die es dem Nutzer ermö glichen, in einer virtuellen Welt Gewaltphantasien und Aggressionen auszuleben, vornehmlich das Massenmedium Fernsehen.
„Das Fernsehen hat durch die Ablichtung von realer und fiktiver Darstellung von Gewalt im Programm die Bereitschaft zu gewalttätigen Konfliktlösungen in der Gesellschaft erheblich gesteigert! Das ist eine populäre These über die Wirkungsweise des Fernsehens. […] sei es als Bericht oder Meldung über Regionen der Dritten Welt, als Schreckensbericht über das Blutbad in Ex-Jugoslawien […]. Was immer mehr zu zählen scheint, ist die vordergründige Bildsensation, arrangiert für die Atemlosigkeit der Fernsehsekunde.“ ([1])
Dem Medium Fernsehen wird hier vorgeworfen, die gesellschaftlichen Werte und Normen dahingehend zu verschieben, dass eine Desensibilisierung der Zuschauer erfolgt und sie Gewalt als eine Form der Problemlösung akzeptieren.
Kritiker, die in dieser Art und Weise argumentieren, gehen demnach von einer starken Wirkungskraft der Medien aus. Gegner dieses Ansatzes weisen indes immer wieder darauf hin, dass es vielmehr die gesellschaftliche Entwicklung selber ist, die diesen Wertewandel zur Folge hat. Ein Einfluss der Medien wird in diesem Zusammenhang zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, ihm kommt aber nur geringe Bedeutung zu. Ob und gegebenenfalls wie sich die verschiedenen
Argumentationen begründen lassen, soll in den nachfolgenden Ausführungen zu der Entwicklung und den Erkenntnissen der Medienwirkungsforschung untersucht werden. Dazu erfolgt in Kapitel 1 zunächst ein Überblick über deren Anfänge, in dem die Gegenstände und Probleme dieses Forschungsfeldes vorgestellt werden. Da das Stimulus-Response-Modell als das erste und somit als klassisches Wirkungsmodell gilt, stellt es eine Art Grundlage für alle nachfolgenden Modelle dar und findet deshalb zu Beginn dieser Ausführungen besondere Beachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Stimulus-Response-Modell als Basistheorie
- 2. Der Einfluss der Systemtheorie auf die Medienwirkungsforschung
- 2.1 Die Entwicklung der Systemtheorie
- 2.2 Niklas Luhmann - Die Theorie sozialer Systeme
- 2.2.1 Doppelte Kontingenz
- 2.2.2 Komplexität
- 2.2.3 Sinn und Selektivität
- 2.2.4 Erleben und Handeln
- 2.3 Handlung und Kommunikation
- 3. Der Einfluss des Radikalen Konstruktivismus auf die Medienwirkungsforschung
- 3.1 Vorwort
- 3.2 Die Konstruktion von Wirklichkeit
- 3.3 Der Einfluss von Massenmedien auf die Konstruktion von Wirklichkeit
- 3.3.1 Massenmedien und das Problem der Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation
- 3.3.2 Das Fernsehen als Konstrukteur von Wirklichkeiten
- 4. Zwischenfazit
- 5. Erweiterte Wirkungsmodelle
- 5.1 Rezipienten-orientierte Ansätze
- 5.1.1 Die Theorie des Zweistufenflusses der Kommunikation
- 5.1.2 Der Uses-and-Gratification-Approach
- 5.2 Medien-orientierte Ansätze
- 5.2.1 Die Kultivierungshypothese
- 5.2.2 Die Knowledge-Gap-Hypothese
- 5.1 Rezipienten-orientierte Ansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Medienwirkungsforschung und analysiert deren Entwicklung und Erkenntnisse. Sie beleuchtet die Frage, welche Aufgaben und Herausforderungen diese Forschungsrichtung hat und welche Erkenntnisse sie liefern kann.
- Das Stimulus-Response-Modell als Ausgangspunkt der Medienwirkungsforschung
- Der Einfluss der Systemtheorie und des Radikalen Konstruktivismus auf die Medienwirkungsforschung
- Die Entwicklung und Ausdifferenzierung von Wirkungsmodellen
- Die Frage nach der tatsächlichen Leistung und den Herausforderungen der Medienwirkungsforschung
- Die Analyse verschiedener Argumentationen im Kontext der Medienwirkungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem klassischen Stimulus-Response-Modell als Ausgangspunkt der Medienwirkungsforschung. Dieses Modell, das auf die Überlegungen von Aristoteles zurückgeht, beschreibt die Kommunikation als eine einseitige Übertragung von Reizen, die bei den Rezipienten bestimmte Reaktionen auslösen.
Kapitel 2 beleuchtet den Einfluss der Systemtheorie auf die Medienwirkungsforschung. Hierbei steht die Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann im Fokus. Luhmann kritisiert das Stimulus-Response-Modell und betont die Komplexität sozialer Systeme und die Rolle von Sinn und Selektivität bei der Konstruktion von Wirklichkeit.
Kapitel 3 behandelt den Radikalen Konstruktivismus und dessen Einfluss auf die Medienwirkungsforschung. Der Radikal Konstruktivismus geht davon aus, dass die Wirklichkeit nicht objektiv existiert, sondern von den Menschen aktiv konstruiert wird.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der ersten drei Kapitel zusammen und zeigt auf, wie die Medienwirkungsforschung durch die Erkenntnisse der Systemtheorie und des Radikalen Konstruktivismus beeinflusst wurde.
Kapitel 5 befasst sich mit verschiedenen Wirkungsmodellen, die unter dem Einfluss der Systemtheorie und des Radikalen Konstruktivismus entstanden sind. Hierbei werden sowohl rezipienten-orientierte als auch medien-orientierte Ansätze betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Medienwirkungsforschung, darunter Stimulus-Response-Modell, Systemtheorie, Radikaler Konstruktivismus, Wirkungsmodelle, Rezipienten-orientierte Ansätze, Medien-orientierte Ansätze, Zweistufenfluss der Kommunikation, Uses-and-Gratification-Approach, Kultivierungshypothese, Knowledge-Gap-Hypothese und die Konstruktion von Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was will die Medienwirkungsforschung leisten?
Sie untersucht, wie Medieninhalte das Denken, Fühlen und Verhalten von Rezipienten beeinflussen und welche gesellschaftlichen Folgen daraus entstehen.
Was besagt das Stimulus-Response-Modell?
Es ist ein klassisches Modell, das davon ausgeht, dass Medienreize (Stimuli) unmittelbare und berechenbare Reaktionen (Responses) beim Publikum auslösen.
Welchen Einfluss hat der Radikale Konstruktivismus?
Er geht davon aus, dass Medien keine objektive Realität abbilden, sondern Rezipienten ihre eigene Wirklichkeit aktiv auf Basis der Medienangebote konstruieren.
Was ist der Uses-and-Gratification-Approach?
Dieser rezipienten-orientierte Ansatz fragt nicht, was die Medien mit den Menschen machen, sondern was die Menschen mit den Medien machen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Was besagt die Kultivierungshypothese?
Sie besagt, dass langfristiger Fernsehkonsum die Wahrnehmung der sozialen Realität prägt (z. B. eine verzerrte Wahrnehmung von Gewalt in der Welt).
- Arbeit zitieren
- M.A. Manuela Feldkamp (Autor:in), 2004, Was will und kann die Medienwirkungsforschung leisten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45728