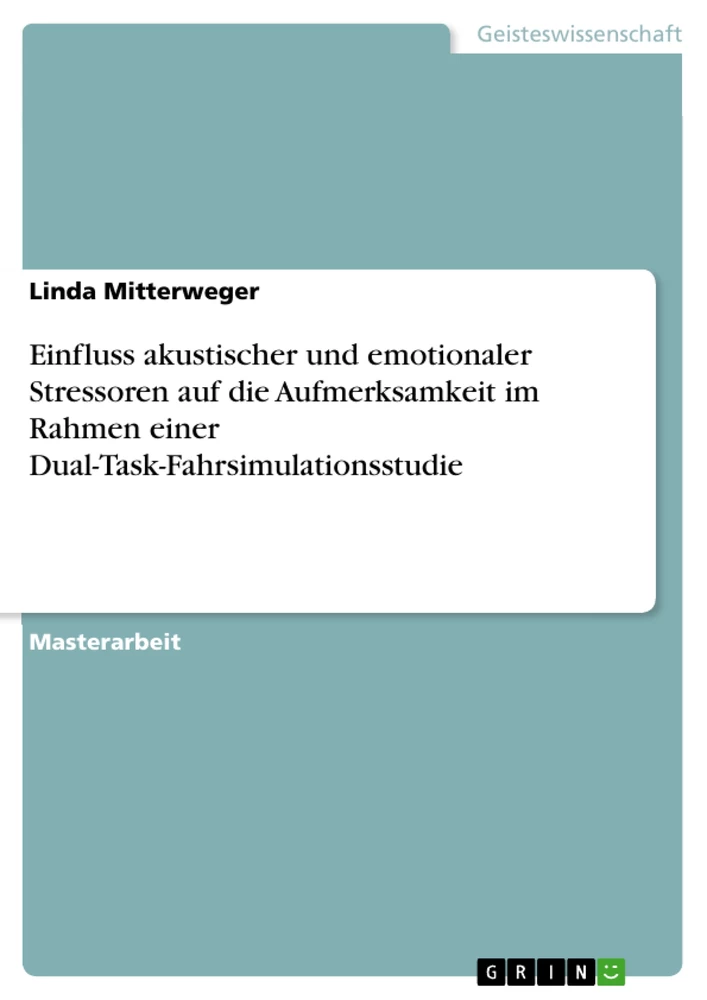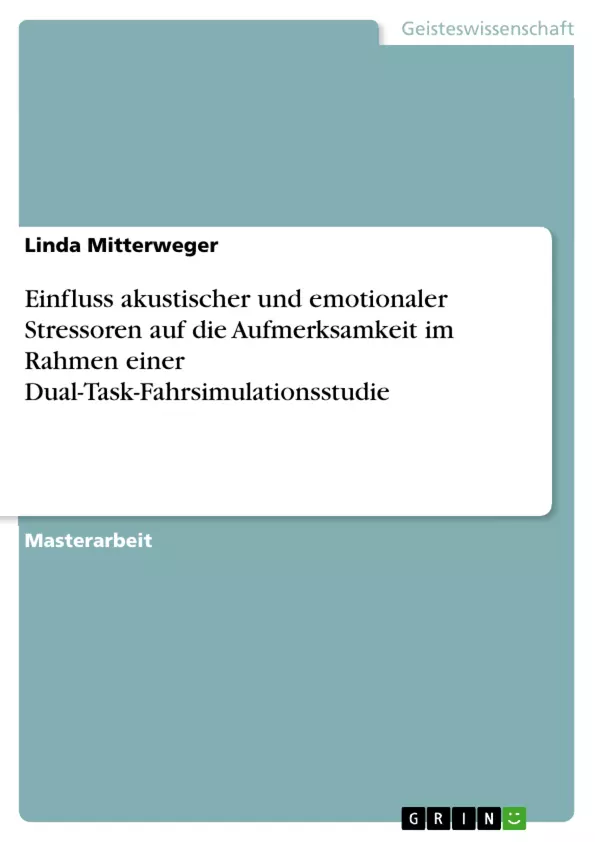Die vorliegende Dual-Task-Fahrsimulationsstudie untersucht den Einfluss akustischer und emotionaler Stressoren auf die Aufmerksamkeit der Probanden. Hierzu wurde die Aufmerksamkeit von 40 Versuchspersonen durch ihre Fahrleistung im Lane-Change-Task, einer Fahrsimulation, gemessen, während sie nebenbei im Rahmen einer Zweitaufgabe passende Geldsummen in drei Schwierigkeitsgraden aus einem Geldbeutel entnehmen mussten. Die Probanden der drei Experimentalgruppen wurden emotional, mittels Bildern aus dem IAPS, und/oder akustisch, via weißen Rauschens, gestresst. Ihr Stresslevel wurde mithilfe des NASA-TLX gemessen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Ausführungen und aktueller Forschungsstand
- 2.1 Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit
- 2.2 Dual-Task-Aufgaben
- 2.3 Stress
- 2.3.1 Akustische Stressinduktion
- 2.3.2 Emotionale Stressinduktion
- 2.4 Problemstellung und Hypothesen
- 3. Methode
- 3.1 Probanden
- 3.2 Experimentaldesign und Durchführung
- 3.3 Datenanalyse
- 4. Ergebnisse
- 5. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit zielt darauf ab, den Einfluss akustischer und emotionaler Stressoren auf die Aufmerksamkeit im Rahmen einer Dual-Task-Fahrsimulationsstudie zu untersuchen. Die Arbeit untersucht, wie sich die Aufmerksamkeit von Personen unter dem Einfluss verschiedener Stressoren auf die Fahrleistung und die Bewältigung einer zusätzlichen Aufgabe auswirkt.
- Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit
- Dual-Task-Aufgaben und ihre Auswirkungen auf die Leistung
- Die Rolle von Stress und seine Induktion durch akustische und emotionale Reize
- Die Interaktion von Stressoren mit der Aufmerksamkeit im Kontext einer Fahrsimulation
- Die Auswirkungen der Stressoren auf die Fahrleistung und die Bewältigung der zusätzlichen Aufgabe
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Aufmerksamkeit im Kontext des Autofahrens. Es werden relevante Studien erwähnt, die die Bedeutung von Aufmerksamkeit für die Sicherheit im Straßenverkehr belegen. Zudem werden die Herausforderungen für den Autofahrer im Straßenverkehr sowie ablenkende Faktoren im Auto selbst dargelegt.
- Kapitel 2: Theoretische Ausführungen und aktueller Forschungsstand In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erörtert, einschließlich der Konzepte des Arbeitsgedächtnisses, der Aufmerksamkeit, der Dual-Task-Aufgaben und des Stresses. Es werden verschiedene Modelle und Theorien zur Verarbeitung von Informationen und zur Bewältigung von Dual-Task-Aufgaben vorgestellt. Zudem wird der aktuelle Forschungsstand zu akustischer und emotionaler Stressinduktion und deren Einfluss auf die Aufmerksamkeit zusammengefasst.
- Kapitel 3: Methode Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Studie, einschließlich der Versuchspersonengruppe, des Experimentaldesigns, der Durchführung und der Datenanalyse. Es werden die eingesetzten Messinstrumente und Verfahren detailliert dargestellt.
- Kapitel 4: Ergebnisse Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Die Daten werden analysiert und interpretiert, um zu ermitteln, ob und wie sich die Stressoren auf die Aufmerksamkeit der Probanden ausgewirkt haben.
- Kapitel 5: Diskussion Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Kontext der theoretischen Grundlagen und des aktuellen Forschungsstandes. Es werden mögliche Erklärungen für die Ergebnisse gegeben und die Limitationen der Studie betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Masterarbeit sind Aufmerksamkeit, Dual-Task-Aufgaben, Stress, akustische Stressinduktion, emotionale Stressinduktion, Fahrsimulation, Fahrleistung und die Interaktion von kognitiven Fähigkeiten mit realen Situationen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben akustische Stressoren auf Autofahrer?
Die Studie untersucht, wie weißes Rauschen als akustischer Stressor die Aufmerksamkeit und damit die Fahrleistung in einer Simulation beeinflusst.
Was ist eine Dual-Task-Fahrsimulation?
Probanden müssen gleichzeitig eine Hauptaufgabe (Fahren im Lane-Change-Task) und eine Nebenaufgabe (z. B. Geld aus einem Beutel entnehmen) bewältigen.
Wie wird emotionaler Stress in der Studie induziert?
Emotionaler Stress wird durch das Zeigen spezifischer Bilder aus dem International Affective Picture System (IAPS) hervorgerufen.
Was misst der NASA-TLX in diesem Experiment?
Der NASA-TLX ist ein Instrument zur Messung des subjektiven Stresslevels und der kognitiven Belastung der Versuchspersonen während der Aufgaben.
Warum ist die Erforschung von Aufmerksamkeit im Straßenverkehr wichtig?
Aufmerksamkeit ist ein kritischer Faktor für die Verkehrssicherheit, da Ablenkungen im Auto eine der Hauptursachen für Unfälle darstellen.
- Quote paper
- Linda Mitterweger (Author), 2018, Einfluss akustischer und emotionaler Stressoren auf die Aufmerksamkeit im Rahmen einer Dual-Task-Fahrsimulationsstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457300