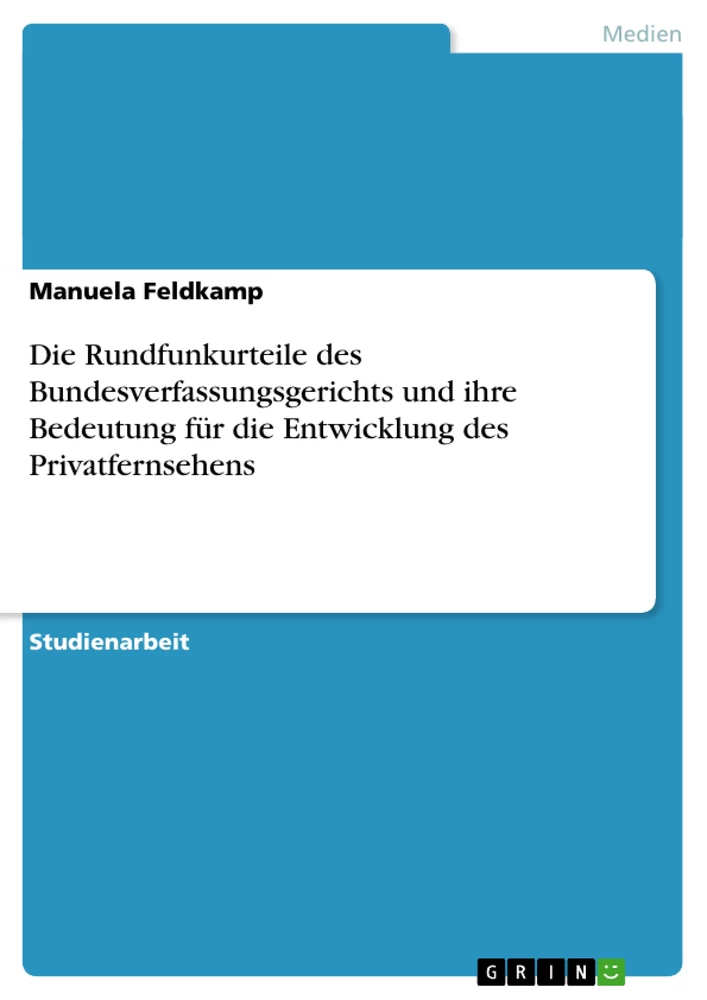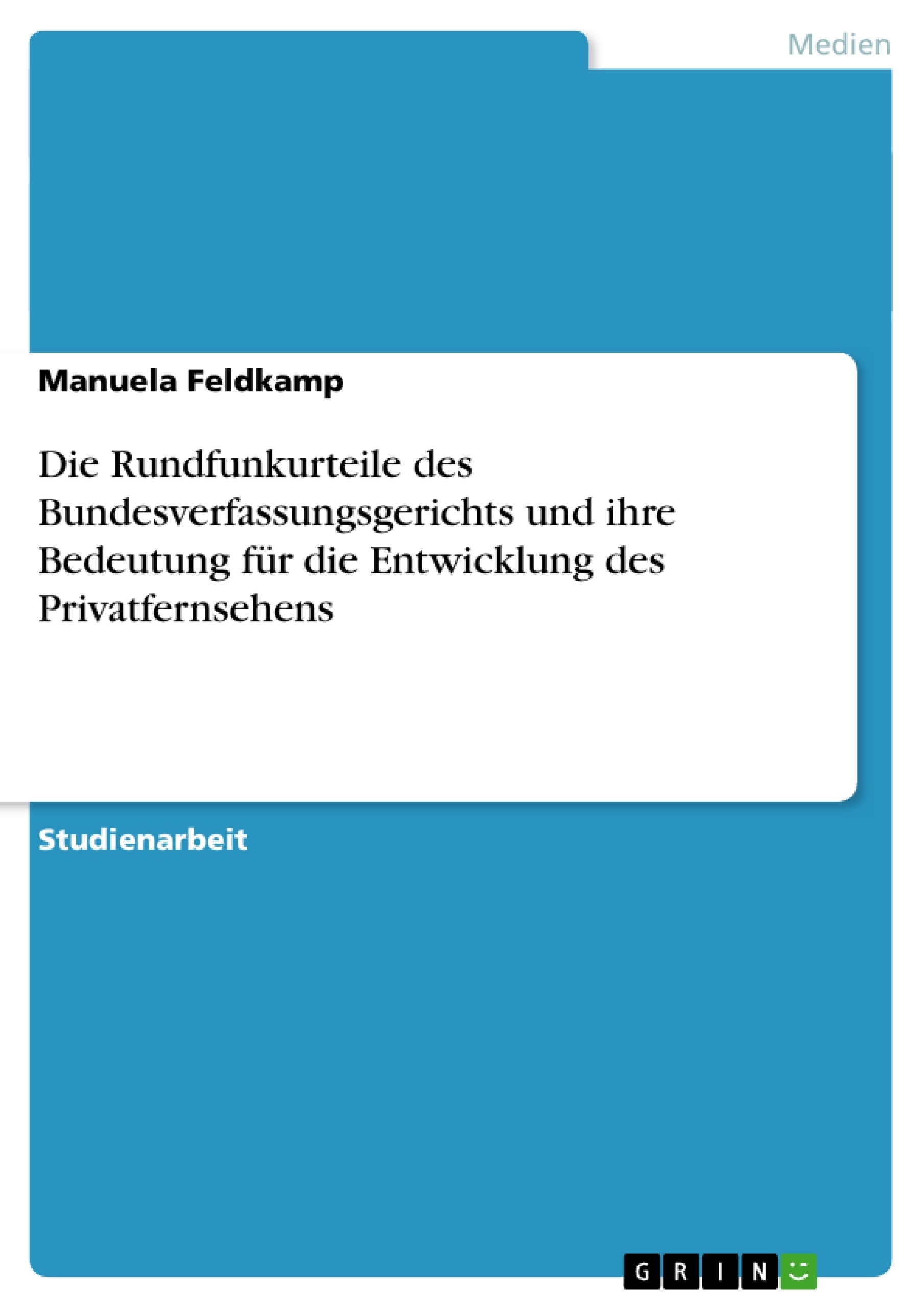Die Entwicklung des deutschen Rundfunks findet ihren Anfang im Jahre 1923. Damals wurden die von Heinrich Herz im Jahre 1887 entdeckten elektromagnetischen Schwingungen allerdings vornehmlich vom Militär im Bereich des See- und Küstenfunks genutzt. Dass der Rundfunk im Laufe der Entwicklung auch in Deutschland zum Massenmedium fungierte, ist dem Umstand zu verdanken, dass er in den USA und in Großbritannien großes Interesse hervorrief und sich somit als lukrative Einnahmequelle darstellte. Diesem Beispiel wollte deshalb auch die Reichspost als damalige Inhaberin der technischen Verfügungsgewalt folgen. Aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten mussten aber private Gesellschaften beteiligt werden.
Bereits damals wurde das enorme Machtpotential dieses Mediums erkannt. Aus diesem Grunde wurde ein Punkt festgelegt, der neben der Frage, ob die Rundfunkhoheit dem Bund oder den Ländern zusteht, Streitpunkt nahezu aller Urteile des Bundesverfassungsgerichtes war: ob der Rundfunk in Deutschland als öffentliche Aufgabe der Allgemeinheit dienen muss und nicht der Erfüllung privater Interessen dienen darf.
Zunächst definierte sich der Rundfunk in der Bundesrepublik ausschließlich über das Radio. Das änderte sich, nachdem sich die Rundfunkanstalten der BRD im Jahre 1950 zur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich - rechtlichen Rundfunkanstalten der BRD (ARD)zusammengeschlossen hatten. So gibt es seit 1954 ein Fernsehprogramm, welches von allen ARD-Landesrundfunkanstalten bundesweit ausgestrahlt wird. Nach der Erschließung neuer Frequenzen in den 50-er Jahren wurde das Fernsehangebot durch ein zweites Programm erweitert. An diesem Punkt setzte die Diskussion um die Einführung des privaten Rundfunks, der heutzutage wie selbstverständlich zum Programmangebot gehört, ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. 1961 - Das Fernsehurteil (BVerfGE 12, 205)
- 1.1 Der Auslöser – die Gründung der Deutschland-Fernsehen GmbH
- 1.2 Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 2. 1981 - Das FRAG-Urteil (BVerfGE 57, 295)
- 2.1 Die Ausgangssituation
- 2.2 Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 3. 1986 - Das Niedersachsen-Urteil (BVerfGE 73, 118)
- 3.1 Der Streitgegenstand: Das niedersächsische Landesrundfunkgesetz
- 3.2 Elemente der Grundversorgung
- 4. 1991 - Das Nordrhein-Westfalen-Urteil (BVerfGE 83, 283)
- 5. 1992 - Der Hessen-3-Beschluss (BVerfGE 87, 153)
- 6. 1994 - Das Rundfunkgebührenurteil (BVerfGE 90, 60)
- 7. Weitere Urteile des Bundesverfassungsgerichts
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Entwicklung des deutschen Rundfunks, insbesondere des Privatfernsehens. Sie untersucht die Rolle des Gerichts in der Transformation des Rundfunks von einer staatlich kontrollierten zu einer vielfältigen Medienlandschaft.
- Die Entwicklung des deutschen Rundfunks und das Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Rundfunk
- Die Bedeutung der Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts für die Entwicklung des Privatfernsehens
- Die Konzepte der Grundversorgung und der Programmvielfalt im Rundfunk
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland
- Die rechtliche Entwicklung und Gestaltung des privaten Rundfunks in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Entwicklung des Rundfunks in Deutschland beleuchtet und den Kontext der Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts einführt. Anschließend werden die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in chronologischer Reihenfolge analysiert:
- Kapitel 1 behandelt das Fernsehurteil von 1961, das die Gründung der Deutschland-Fernsehen GmbH und die Rolle des Staates im Rundfunk thematisiert.
- Kapitel 2 analysiert das FRAG-Urteil von 1981, das die Zulässigkeit von privaten Rundfunkanstalten in Deutschland feststellt.
- Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Niedersachsen-Urteil von 1986, das den Begriff der Grundversorgung im Rundfunk präzisiert.
- Kapitel 4 behandelt das Nordrhein-Westfalen-Urteil von 1991, das die Einführung des Zwei-Säulen-Modells im Rundfunk erlaubt.
- Kapitel 5 untersucht den Hessen-3-Beschluss von 1992, der die Frage nach der Zulässigkeit von Werbung im dritten Programm öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten behandelt.
- Kapitel 6 analysiert das Rundfunkgebührenurteil von 1994, das die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Gebühren behandelt.
- Kapitel 7 bietet eine kurze Übersicht über weitere Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts.
- Kapitel 8 bietet ein Resümee der wichtigsten Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich des Rundfunks.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen des deutschen Rundfunks, insbesondere auf die Entwicklung des Privatfernsehens und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in diesem Prozess. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Rundfunkrecht, Bundesverfassungsgericht, Fernsehurteil, FRAG-Urteil, Grundversorgung, Programmvielfalt, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Privatfernsehen, Rundfunkgebühren, EG-Fernsehrichtlinie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Fernsehurteil von 1961?
Es verhinderte die Gründung eines staatlich kontrollierten Fernsehens durch die Bundesregierung und stärkte die Rundfunkhoheit der Länder.
Was besagt das FRAG-Urteil von 1981?
Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass privater Rundfunk grundsätzlich zulässig ist, sofern eine gesetzliche Ordnung die Vielfalt der Meinungen sichert.
Was wird unter der „Grundversorgung“ im Rundfunk verstanden?
Die Grundversorgung verpflichtet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ein Programm anzubieten, das die gesamte Breite der Gesellschaft informiert, bildet und unterhält.
Wie beeinflusste das Niedersachsen-Urteil (1986) das Privatfernsehen?
Es definierte die Anforderungen an die duale Rundfunkordnung, in der privater Rundfunk geringeren Anforderungen genügen muss, solange der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Grundversorgung leistet.
Warum sind Rundfunkgebühren verfassungsrechtlich geschützt?
Laut dem Gebührenurteil von 1994 sichert die Finanzierung durch Gebühren die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von staatlicher und wirtschaftlicher Einflussnahme.
- Citar trabajo
- M.A. Manuela Feldkamp (Autor), 2004, Die Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Privatfernsehens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45730