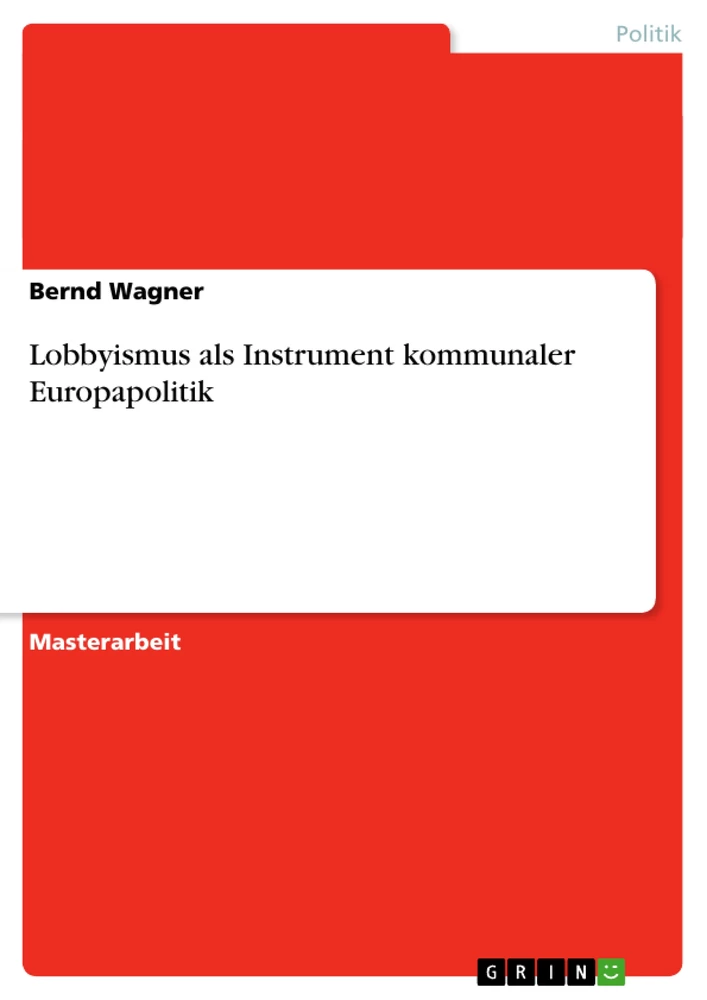Der Blick der deutschen Kommunen „nach oben“, d.h. zu den höheren staatlichen Ebenen, ist traditionell durch einen sorgenvollen, ängstlichen Gesichtsausdruck gekennzeichnet. Die Furcht vor einer Schmälerung der eigenen Handlungsspielräume und vor der Übertragung von kostenintensiven zusätzlichen Aufgaben ohne angemessenen finanziellen Ausgleich haben hier inzwischen manche Falte hinterlassen. Ein hoffnungsfrohes Leuchten ist lediglich dann zu vermelden, wenn die Kommunen mit Hilfe ihrer Selbstverwaltungsgarantie und einer darauf gestützten verfassungsgerichtlichen Entscheidung staatlichen Eingriffen oder Kostenabwälzungen Einhalt geboten haben.
Zu dieser nationalen Besorgnis ist mit dem europäischen Einigungsprozess ein zweites Bedrohungsszenario hinzugetreten, dessen Gefahren die Gemeinden und Gemeindeverbände in der Bundesrepublik Deutschland hilflos ausgesetzt zu sein scheinen. So wird in der Literatur etwa eine „internationale Kraftlosigkeit“ der Kommunen im Integrationsprozess konstatiert. An anderer Stelle heißt es pointiert, die Europäische Union (EU) würde die Kommunen wie „wehrlose Verwalter“ behandeln. Bisweilen wird in diesem Zusammenhang gar die martialische Ausdrucksweise bemüht, die kommunale Daseinsvorsorge befinde sich in einem „Mehrfrontenkrieg“.
Um der wachsenden Einflussnahme der europäischen Rechtsetzung auf die kommunalen Aufgaben Rechnung zu tragen, sollen kommunaler Sachverstand und die spezifischen kommunalen Interessen deshalb mittels „Lobbying“ in den europäischen Entscheidungsprozess eingebracht werden. Der durchschnittlich informierte Bürger verbindet mit Lobbyarbeit regelmäßig negative Vorstellungen: Lobbyisten seien öffentlichkeitsscheue Gestalten, die mit illegitimen Machenschaften Politiker und Parteifunktionäre zum gefügigen Werkzeug ihrer Interessengruppen machen würden.5
Diese Beschreibung hat mit dem Arbeitsalltag organisierter Interessenvertretung nur wenig zu tun. Der Verfasser dieser Arbeit hatte während eines Praktikums im Europabüro der bayerischen Kommunen (EBBK) in Brüssel die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und die Arbeitsweise kommunaler Lobbyisten auf europäischer Ebene zu gewinnen. Diese Erfahrung war auch ausschlaggebend dafür, die Europaaktivitäten deutscher Kommunen unter besonderer Berücksichtigung des Lobbyismus zum Thema der vorliegenden Arbeit zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Die Rolle der deutschen Kommunen in Europa
- I. Vom „wehrlosen Verwalter“ zum aktiven Gestalter?
- II. Modelle des europäischen Mehrebenensystems
- III. Gang der Untersuchung
- IV. Begriffserklärungen
- a. Lobbyismus
- b. Kommunale Selbstverwaltung
- B. Der Einfluss der Europäischen Union auf die deutschen Kommunen
- I. Überblick über die „Europa-Betroffenheit“ der Kommunen
- II. Binnenmarkt und kommunale Daseinsvorsorge
- III. Öffentliches Auftragswesen
- IV. Europäische Umweltbestimmungen
- V. Europäische Sozialpolitik
- VI. Europäische Förderpolitik
- VII. Zwischenergebnis
- C. Die kommunale Interessenwahrnehmung in europäischen Angelegenheiten
- I. Überblick über die Möglichkeiten „kommunaler Europapolitik“
- II. Kommunale Interessenvertretung in Deutschland
- a. Situation auf Landesebene
- b. Situation auf Bundesebene
- c. Zwischenergebnis
- III. Institutionalisierte Mitwirkung der Kommunen auf europäischer Ebene
- a. Der Ausschuss der Regionen (AdR)
- 1. Regionale und lokale Gebietskörperschaften in Europa
- 2. Geschichte und Gründung des AdR
- 3. Kompetenzen, Arbeitsweise und Mitglieder des AdR
- b. Die Kommunen und der Europarat
- c. Zwischenergebnis
- IV. Informelle Aktivitäten der Kommunen auf europäischer Ebene
- a. Das Lobbysystem der Europäischen Union
- 1. Entwicklung des Euro-Lobbying
- 2. Adressaten und Akteure des Euro-Lobbying
- 3. Zwischenergebnis
- b. Kommunale Verbandsarbeit
- 1. Die kommunalen Vertretungen in Brüssel
- aa. Die Europabüros der deutschen kommunalen Spitzenverbände
- bb. Die Europabüros der bayerischen, baden-württembergischen und sächsischen Kommunen
- cc. Funktionen des kommunalen Lobbying
- dd. Methoden des kommunalen Lobbying
- 2. Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)
- 3. Der Europäische Zentralverband der Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung (CEEP)
- 4. Zwischenergebnis
- c. Bildung kommunaler Netzwerke
- 1. Eurocities als europäisches Städtenetzwerk
- 2. European Local Authorities Network (ELAN)
- 3. Zwischenergebnis
- d. Lobbyarbeit in der Praxis
- 1. Beispiele für kommunales Lobbying
- 2. Leitregeln des kommunalen Lobbying
- 3. Zwischenergebnis
- e. Kommunale Lobbyisten - die „fünfte Gewalt“ in Europa?
- D. Bilanz und Perspektiven des Lobbyismus als Instrument kommunaler Europapolitik
- Die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung im europäischen Kontext
- Der Einfluss der EU auf die deutschen Kommunen in verschiedenen Politikfeldern
- Möglichkeiten der Interessenvertretung durch kommunale Verbände und Netzwerke
- Die Rolle des Lobbyismus in der europäischen Politikgestaltung
- Die Herausforderungen und Chancen des Lobbyismus als Instrument kommunaler Europapolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie deutsche Kommunen im europäischen Mehrebenensystem aktiv werden können, um ihre Interessen zu vertreten. Sie untersucht die Rolle des Lobbyismus als Instrument der kommunalen Europapolitik und analysiert dessen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Untersuchung der Rolle der deutschen Kommunen in Europa, indem sie den Wandel vom „wehrlosen Verwalter“ zum „aktiven Gestalter“ beleuchtet. Dabei werden verschiedene Modelle des europäischen Mehrebenensystems vorgestellt. Die Analyse der Kapitel B und C konzentriert sich auf den Einfluss der EU auf die deutschen Kommunen in verschiedenen Politikbereichen und die Möglichkeiten der kommunalen Interessenvertretung in Deutschland und auf europäischer Ebene. Das Kapitel IV befasst sich mit dem Lobbyismus als Instrument kommunaler Europapolitik, wobei die Entwicklung des Euro-Lobbying, die verschiedenen Akteure und Adressaten sowie die Funktionen und Methoden des kommunalen Lobbying untersucht werden.
Schlüsselwörter
Kommunale Europapolitik, Lobbyismus, Mehrebenensystem, Interessenvertretung, Selbstverwaltung, EU-Einfluss, Kommunale Verbände, Netzwerke, Europabüros, Euro-Lobbying, Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE).
- Quote paper
- Bernd Wagner (Author), 2005, Lobbyismus als Instrument kommunaler Europapolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45737