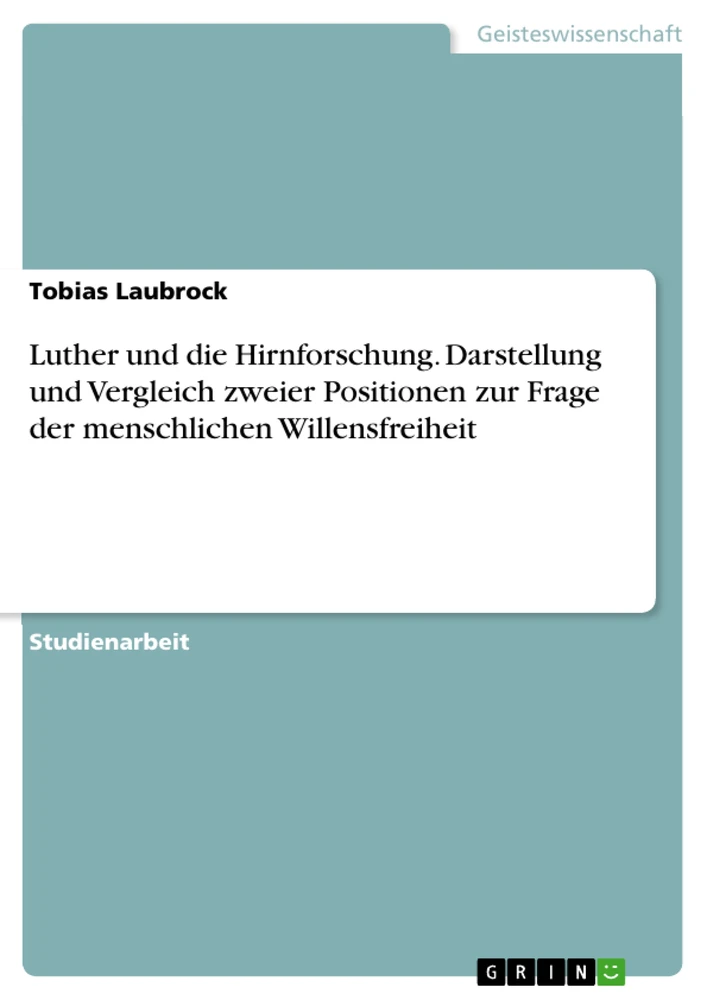In meiner Ausarbeitung beschäftige ich mich mit der Frage, inwieweit es zwischen Luther und der Hirnforschung (bei gemeinsamer Ablehnung der Willensfreiheit) methodische und inhaltliche Übereinstimmungen sowie Differenzen gibt. Neben einer vergleichenden Gegenüberstellung formuliere ich in meiner Ausarbeitung abschließend einen theologischen Ertrag für die Moderne, der sich aus der Erkenntnis der Unfreiheit des menschlichen Willens ergibt.
"Gott weiß nichts zufällig voraus, sondern sieht alles voraus, nimmt es sich vor und tut es nach seinem unwandelbaren, ewigen und unfehlbaren Willen. Dieser Donnerschlag streckt den freien Willen nieder und zermalmt ihn ganz und gar." Mit diesen Worten begründete Martin Luther in seiner Schrift "Vom unfreien Willen" (1525) seine Position von der Unfreiheit des menschlichen Willens. Aufgrund der Voraussicht und Unwandelbarkeit des göttlichen Willens widerspreche die Vorstellung einer menschlichen Willensfreiheit sämtlichen glaubwürdigen Konzeptionen des Gott-Mensch-Verhältnisses.
Luther macht in jener Schrift den Begriff der göttlichen Gnade stark und verknüpft ihn unmittelbar mit der menschlichen Ohnmacht, die aus der Erkenntnis der Unfreiheit des menschlichen Willens erwächst. In den letzten Jahren (und Jahrzehnten) bekommt Luthers Ablehnung des freien Willens dabei viel Zustimmung von überraschender Seite: auch die moderne Hirnforschung kommt auf der Grundlage experimenteller Befunde zu dem Schluss, dass der Mensch durch seine neurologische Konstitution determiniert sei. Auch die bedeutenden Neurowissenschaftler der letzten Jahre sehen daher keinen Raum für einen freien menschlichen Willen.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Luthers Haltung zum freien Willen
- B.I. Vom unfreien Willen
- B.I.1. Luthers Definition des freien Willens
- B.I.2. Gottes Voraussicht oder menschliche Freiheit?
- B.I.3. Sola gratia – allein die Gnade
- B.I.4. Pecca fortiter – sündige tapfer!
- B.II. Auswertung der Position Luthers
- C Die Hirnforschung und der freie Wille
- C.I. Das Libet-Experiment
- C.I.1. Das menschliche Erleben von Freiheit
- C.I.2. Freier Wille und Gehirnstimulation
- C.II. Die Negation der Willensfreiheit und ihre Folgen
- C.II.1. Folgen für das Rechtsdenken
- C.II.2. Schuldfähigkeit von Straftätern
- C.II.3. Verzicht auf den persönlichen Schuldbegriff
- C.III. Luther und die Hirnforschung – ein Vergleich
- C.III.1. Luther und die Hirnforschung: Unterschiede
- C.III.2. Luther und die Hirnforschung: Gemeinsamkeiten
- C.III.3. Luther und die Hirnforschung: Resümee
- C.IV. Theologischer Ertrag der empirischen Befunde
- D Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage der Willensfreiheit im Spannungsfeld zwischen der lutherischen Theologie und der modernen Hirnforschung. Ziel ist es, die Positionen beider Seiten zu beleuchten und in einem Vergleich aufzuzeigen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich darin erkennen lassen.
- Die theologische Position Martin Luthers zur Willensfreiheit und ihre Beweggründe
- Das Libet-Experiment und seine Interpretation im Kontext der Hirnforschung
- Die Folgen der Negation der Willensfreiheit für das Rechtsdenken
- Der Vergleich zwischen lutherischer Theologie und moderner Hirnforschung
- Die Ableitung eines theologischen Ertrags aus den Erkenntnissen der Neurowissenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Einleitung zur Arbeit gegeben. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Luthers Haltung zum freien Willen. Hierbei werden die Grundzüge seiner Kritik an der Vorstellung der Willensfreiheit, seine Definition des freien Willens, die Motive seiner Ablehnung und die Auswirkungen auf seine Theologie dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der neurowissenschaftlichen Perspektive auf den freien Willen. Es wird das Libet-Experiment und seine Folgen für die Frage nach der Willensfreiheit sowie die Auswirkungen der neurobiologischen Erkenntnisse auf die Schuldfähigkeit im Rechtssystem erörtert. Schließlich wird ein Vergleich zwischen den Positionen Luthers und der Hirnforschung gezogen.
Im vierten Kapitel wird der theologische Ertrag der Erkenntnisse der Neurowissenschaften diskutiert. Es wird gezeigt, wie die Erkenntnisse der Hirnforschung neue Impulse für ein humaneres christliches Menschenbild liefern können und welche Konsequenzen sich für die christliche Orthopraxie ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Willensfreiheit, Luther, Hirnforschung, Libet-Experiment, Schuldfähigkeit, Rechtssystem, Theologie, Orthopraxie, Gnade, Sünde. Sie behandelt wichtige Konzepte wie die Abhängigkeit des Menschen von der Gnade Gottes, die Unfreiheit des Willens und die Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf das Menschenbild und die ekklesiale Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was war Martin Luthers Position zum freien Willen?
In seiner Schrift "Vom unfreien Willen" (1525) argumentierte Luther, dass der menschliche Wille durch Gottes Voraussicht und Gnade determiniert sei.
Was besagt das Libet-Experiment in der Hirnforschung?
Es legt nahe, dass neuronale Prozesse einer bewussten Entscheidung vorausgehen, was viele Forscher als Beleg für die Unfreiheit des Willens deuten.
Welche Gemeinsamkeiten haben Luther und die moderne Neurowissenschaft?
Beide lehnen (wenn auch aus unterschiedlichen Gründen) die Vorstellung einer absoluten menschlichen Willensfreiheit ab.
Welche Folgen hat die Negation der Willensfreiheit für das Recht?
Sie stellt den klassischen Schuldbegriff infrage und fordert eine Debatte über die Schuldfähigkeit von Straftätern.
Was ist der "theologische Ertrag" dieser Erkenntnisse?
Die Erkenntnis der Ohnmacht des Willens kann zu einem humaneren christlichen Menschenbild führen, das stärker auf Gnade und Mitgefühl basiert.
- Citar trabajo
- Tobias Laubrock (Autor), 2019, Luther und die Hirnforschung. Darstellung und Vergleich zweier Positionen zur Frage der menschlichen Willensfreiheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457423