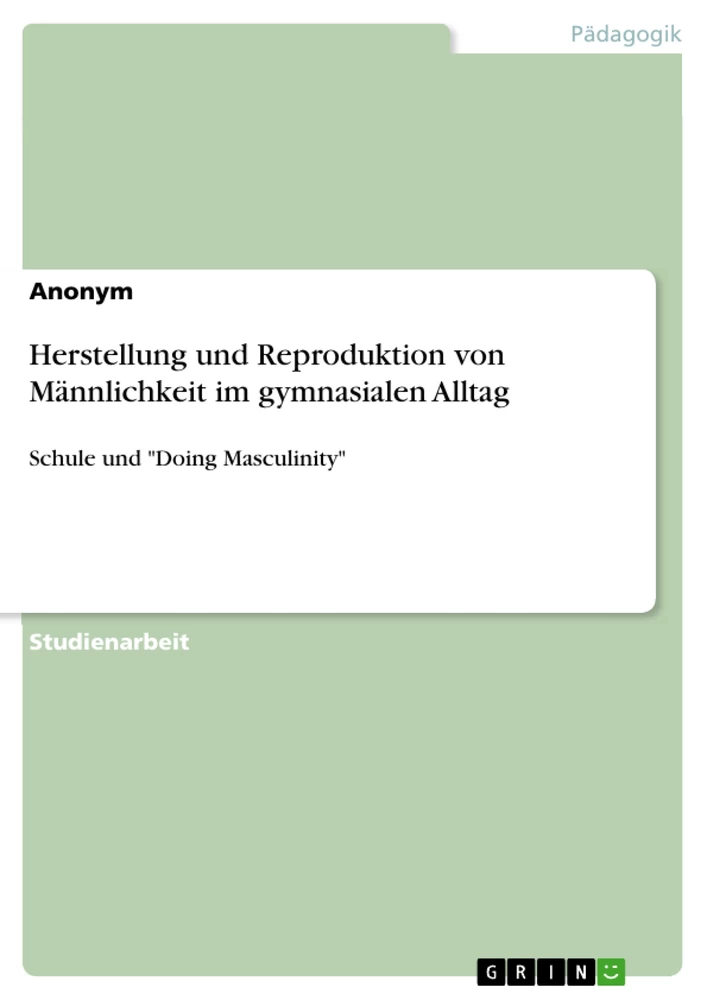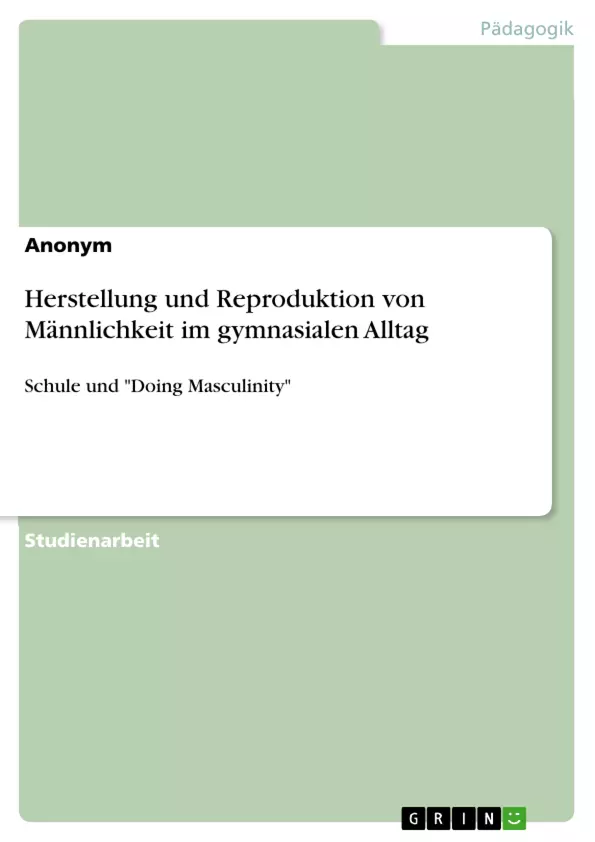Im Rahmen dieser Hausarbeit wird sich mit den Fragen "Wie wird Männlichkeit hergestellt und wie produzieren und reproduzieren Jungen im gymnasialen Alltag Formen von Männlichkeit?" auseinandergesetzt. Wenn von Jungenverhalten gesprochen wird, hört man häufig Aussagen wie "Jungen sind rebellisch und laut." "Jungen werden immer gewalttätiger in der Schule." "Jungen sind eben so." Oft wird das Verhalten der Jungen im Schulalltag von Lehrkräften und Pädagogen stereotypisch betrachtet. Daraus ergibt sich die Frage, wie das scheinbar natürliche, laute und unangepasste Verhalten der Jungen entsteht und wieso man sich mit dem Thema Jungen und Männlichkeit im Schulalltag überhaupt auseinandersetzen sollte.
Zu Beginn werden die Begriffe "Geschlecht und Doing Gender/ Doing Masculinity" definiert, um eine Basis für die darauffolgenden theoretischen Überlegungen zu legen. Pierre Bourdieus Theorie zur männlichen Herrschaft und Robin W. Connells Theorie der hegemonialen Männlichkeit werden zur Definition und Konstruktion von Männlichkeit herangezogen. Die Beispiele aus der Praxis werden auf die zuvor erläuterten theoretischen Überlegungen von Bourdieu und Connell bezogen und zeigen, auf welche Weise sich die Konstruktionsprozesse von Männlichkeit bei Jungen vollziehen.
Die Geschlechterordnung in der Gesellschaft ist keineswegs neutral, sondern basiert auf männlicher Dominanz und Machtverhältnissen, die Männern trotz formeller Gleichberechtigung von Frauen Vorteile in jeglichen gesellschaftlichen Bereichen wie Arbeitsmarkt, Einkommen, Führungspositionen, Politik und so weiter bietet. Die Schule als pädagogische Institution reproduziert die symbolische Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit und die damit zusammenhängenden Machtverhältnisse entsprechend ihrer Sozialisations- und Enkulturationsfunktion. Der schulische Alltag ist somit kein geschlechtsneutraler Raum, in dem Jungen und Mädchen untereinander frei von Erwartungen und Vorannahmen bezüglich ihres Geschlechts agieren können. Das Thema Männlichkeit ist in der Schule relevant, um zu beleuchten, wie Jungen untereinander Männlichkeit herstellen, da es sich in diesem Prozess um gesellschaftliche Konstruktionen handelt. Jungen, die das Abitur absolvieren, befinden sich in der Regel im Alter von 6 bis 19 Jahren in der Institution Schule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen zur zweiteiligen Geschlechterordnung
- Geschlecht als soziale Konstruktion
- Herstellungsprozesse von Geschlecht
- Definition Geschlechtsidentität
- Definition Doing Gender
- Definition Doing Masculinity
- Theoretische Überlegungen zur Konstruktion männlicher Vorherrschaft
- Pierre Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft
- Bourdieus Forschungen in der kabylischen Gesellschaft
- Einteilung der Geschlechter in der kabylischen Gesellschaft
- Die männliche Herrschaft
- Habitus und Herstellung von Männlichkeit
- Robin Connells Theorie der hegemonialen Männlichkeit
- Männlichkeit bei Connell
- Hegemonie und hegemoniale Männlichkeit
- Untergeordnete Männlichkeiten
- Komplizenhafte und marginalisierte Männlichkeiten
- Pierre Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft
- Praxisbeispiele zur Herstellung von Männlichkeit unter Jungen im gymnasialen Alltag
- Studie am Edith Benderoth- Gymnasium
- Doing Masculinity in Schülerinteraktionen - Statusaushandlungen als Konstruktion von Männlichkeit in der Schule
- Symbolische Verweiblichung und Entwertungen
- Homosexualitätszuschreibungen
- Zusammenfassung Praxisbeispiele
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herstellung und Reproduktion von Männlichkeit im gymnasialen Alltag. Sie analysiert, wie Jungen im schulischen Kontext Männlichkeitsvorstellungen konstruieren und reproduzieren. Die Arbeit zielt darauf ab, die sozialen Prozesse hinter dem vermeintlich natürlichen „Jungenverhalten“ aufzuzeigen und die Rolle der Schule in der Reproduktion geschlechtlicher Machtverhältnisse zu beleuchten.
- Soziale Konstruktion von Geschlecht und Männlichkeit
- Theorien der männlichen Herrschaft (Bourdieu, Connell)
- Doing Gender/Doing Masculinity im schulischen Kontext
- Praxisbeispiele aus dem gymnasialen Alltag
- Reproduktion geschlechtlicher Machtverhältnisse in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Herstellung und Reproduktion von Männlichkeit im gymnasialen Alltag. Sie problematisiert die stereotypischen Vorstellungen von „Jungenverhalten“ und hebt die Bedeutung der Schule als Sozialisationsraum hervor. Die Arbeit untersucht, wie Jungen Männlichkeit konstruieren und reproduzieren und wie die Schule dabei eine Rolle spielt.
Theoretische Grundlagen zur zweiteiligen Geschlechterordnung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Geschlecht, Doing Gender und Doing Masculinity. Es wird die soziale Konstruktion von Geschlecht betont und die zweiteilige Geschlechterordnung als nicht naturgegeben, sondern als sozial und historisch veränderbar dargestellt. Die Kapitel erläutert die Bedeutung von Interaktionen und der permanenten Herstellung von Geschlecht in sozialen Kontexten. Die theoretischen Grundlagen werden für die spätere Analyse der Praxisbeispiele gelegt. Dabei wird hervorgehoben, dass Geschlechtsidentität nicht statisch ist, sondern durch ständige Positionierung und Anerkennung in sozialen Interaktionen hergestellt wird.
Theoretische Überlegungen zur Konstruktion männlicher Vorherrschaft: Dieses Kapitel präsentiert die Theorien von Pierre Bourdieu und Robin Connell. Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft wird im Kontext der kabylischen Gesellschaft erläutert und auf den Habitus und die Herstellung von Männlichkeit angewendet. Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit wird eingeführt, sowie die Konzepte von untergeordneten, komplizenhaften und marginalisierten Männlichkeiten, die ein differenziertes Bild männlicher Identitäten ermöglichen. Diese theoretischen Konzepte dienen als Analyseinstrumentarium für die Interpretation der empirischen Daten.
Praxisbeispiele zur Herstellung von Männlichkeit unter Jungen im gymnasialen Alltag: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert Praxisbeispiele aus einer Studie, die die Herstellung von Männlichkeit im schulischen Alltag untersucht. Es beleuchtet Mechanismen wie symbolische Verweiblichung und Homosexualitätszuschreibungen als Strategien der Statusaushandlung und der Konstruktion von Männlichkeit unter Jungen. Die Beispiele veranschaulichen die theoretischen Konzepte und zeigen, wie Jungen Männlichkeit aktiv in ihren Interaktionen herstellen und reproduzieren. Der Fokus liegt auf der Analyse von Interaktionen zwischen Schülern und der Konstruktion von Männlichkeit im schulischen Kontext.
Schlüsselwörter
Männlichkeit, Doing Masculinity, Doing Gender, soziale Konstruktion von Geschlecht, hegemoniale Männlichkeit, Pierre Bourdieu, Robin Connell, gymnasialer Alltag, Schülerinteraktionen, Geschlechterverhältnisse, Machtverhältnisse, Schule, Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Herstellung und Reproduktion von Männlichkeit im gymnasialen Alltag
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herstellung und Reproduktion von Männlichkeit im gymnasialen Alltag. Sie analysiert, wie Jungen im schulischen Kontext Männlichkeitsvorstellungen konstruieren und reproduzieren und beleuchtet die Rolle der Schule in der Reproduktion geschlechtlicher Machtverhältnisse.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien der sozialen Konstruktion von Geschlecht, Doing Gender und Doing Masculinity. Im Mittelpunkt stehen die Theorien von Pierre Bourdieu (männliche Herrschaft, Habitus) und Robin Connell (hegemoniale Männlichkeit, untergeordnete, komplizenhafte und marginalisierte Männlichkeiten).
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Praxisbeispiele aus einer Studie am Edith Benderoth-Gymnasium. Im Fokus stehen Schülerinteraktionen, in denen Männlichkeit durch Mechanismen wie symbolische Verweiblichung und Homosexualitätszuschreibungen konstruiert und ausgehandelt wird.
Wie wird Männlichkeit im schulischen Kontext konstruiert?
Die Analyse zeigt, wie Jungen Männlichkeit aktiv in ihren Interaktionen herstellen und reproduzieren. Statusaushandlungen und die Abgrenzung von vermeintlich „weiblichen“ Verhaltensweisen spielen dabei eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Reproduktion geschlechtlicher Machtverhältnisse?
Die Arbeit beleuchtet, wie die Schule als Sozialisationsraum zur Reproduktion geschlechtlicher Machtverhältnisse beiträgt. Sie untersucht, wie schulische Interaktionen die Konstruktion und Reproduktion von Männlichkeit beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Männlichkeit, Doing Masculinity, Doing Gender, soziale Konstruktion von Geschlecht, hegemoniale Männlichkeit, Pierre Bourdieu, Robin Connell, gymnasialer Alltag, Schülerinteraktionen, Geschlechterverhältnisse, Machtverhältnisse, Schule und Sozialisation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen der zweiten Geschlechterordnung, ein Kapitel zu den Theorien männlicher Herrschaft (Bourdieu und Connell), ein Kapitel mit Praxisbeispielen aus dem gymnasialen Alltag und eine abschließende Betrachtung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die sozialen Prozesse hinter dem vermeintlich natürlichen „Jungenverhalten“ aufzuzeigen und die Rolle der Schule in der Reproduktion geschlechtlicher Machtverhältnisse zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Herstellung und Reproduktion von Männlichkeit im gymnasialen Alltag, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457438