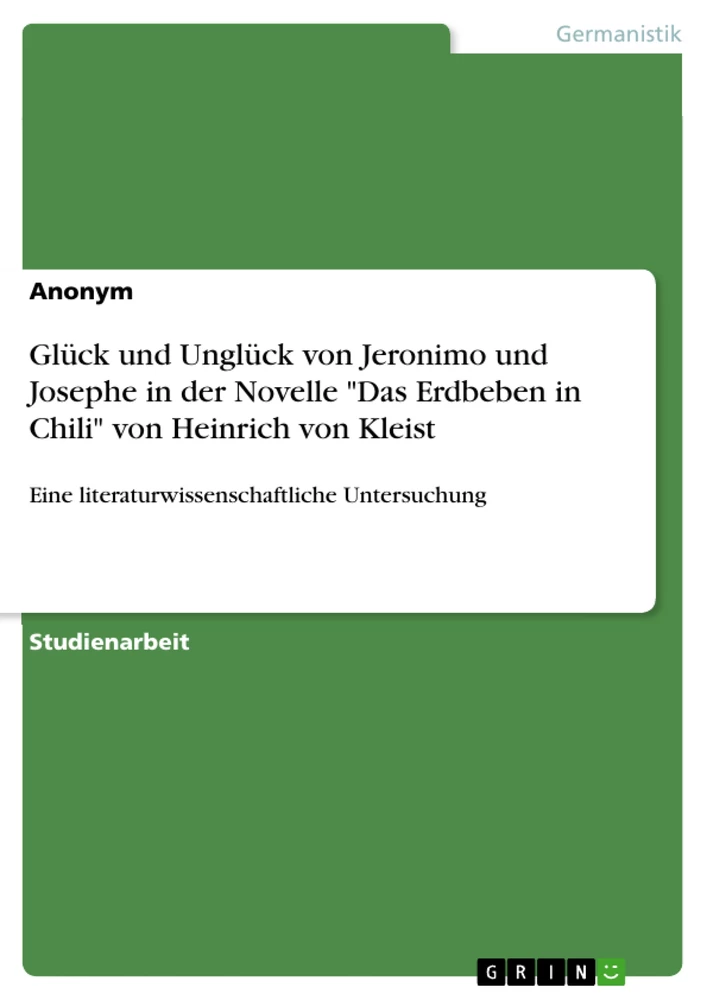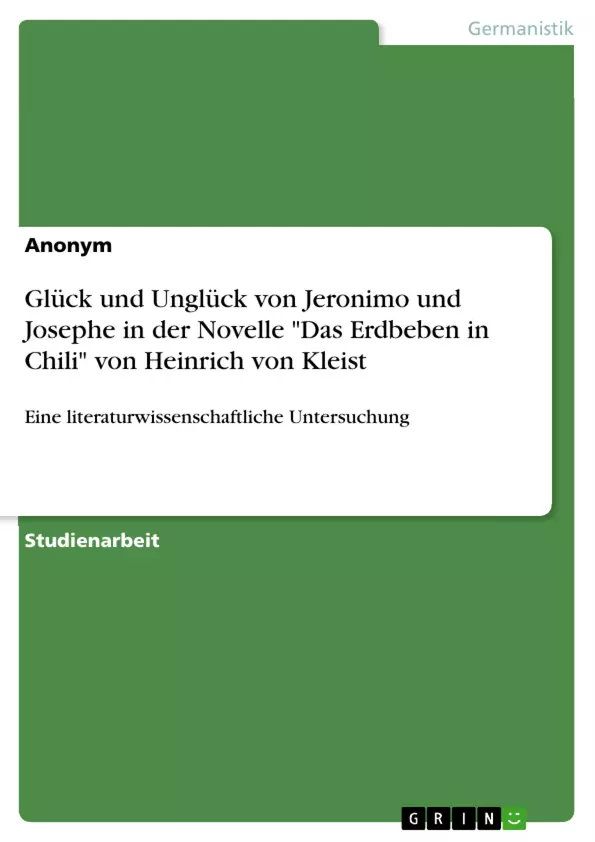Diese Arbeit befasst sich mit der Novelle "Das Erdbeben in Chili" von Heinrich von Kleist. "Jeder ist seines Glückes Schmied" lautet ein bekanntes Sprichwort, doch bei Heinrich von Kleists Novelle "Das Erdbeben in Chili" mutet eher der Zufall an, des Glückes Schmied zu sein. Denn hier scheint der Zufall immer wieder dazu zu führen, dass Glück Unglück und Unglück Glück ablöst. Besonders auffällig an der Novelle ist, dass es zu einem beständigen Wechsel von Glück und Unglück kommt, ohne dass die Figuren etwas dagegen tun können, denn die gesamte Handlung wird von plötzlichen Zufällen bestimmt. Wie genau diese Wechsel sich vollziehen und ob sie als Glück oder Unglück der Protagonisten zu verstehen sind, soll die folgende Untersuchung der Novelle zeigen.
Dabei wird zunächst erläutert, was im weiteren Verlauf unter Glück, Unglück und Katastrophe zu verstehen ist. Im Anschluss an die Untersuchung erfolgt ein Fazit, bei welcher die Frage, ob das Erdbeben Glück oder Unglück für Jeronimo und Josephe gebracht hat, und inwiefern der Erzähler eben jenes dem Leser vermittelt oder auch nicht, diskutiert wird.
"Das Erdbeben in Chili" wirft bei dem Leser immer wieder Fragen auf, welche jedoch bis zum Schluss keine wirklichen Antworten erhalten, nicht zuletzt weil der Erzähler vieles undurchsichtig lässt und er einen immer wieder in die Irre führt. Gerade eben war es noch Glück, welches die Protagonisten erfahren, im nächsten kommt ein Zufall und verkehrt das ganze wieder ins Unglück für die beiden. Nie kann der Leser sicher sein, was als nächstes passieren wird und ob es denn tatsächlich Glück für Jeronimo und Josephe bedeutet oder nicht. Denn Glück und Unglück scheinen wie zwei Seiten derselben Münze zu sein, denn immer wieder werden sie in widersprechender Art und Weise eingesetzt. Dies ermöglicht dem Leser unendliche Möglichkeiten einer Interpretation, und selbst wenn man glaubt, zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen zu sein, werfen sich plötzlich wieder neue Fragen auf und es kommt zu neuen Spekulationen auf die Auswirkungen bestimmter Ereignisse, Handlungen und Zufälle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Glück und Unglück bei Jeronimo und Josephe in „Das Erdbeben in Chili“
- Glück und Unglück in Teil A - Das Erdbeben
- Glück und Unglück in Teil B – Die Idylle und Täuschung
- Glück und Unglück in Teil C - Der Mord
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wechsel von Glück und Unglück bei den Protagonisten Jeronimo und Josephe in Heinrich von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Zufall und Schicksal und deren Auswirkungen auf die Figuren. Dabei wird die Dreiteilung der Novelle nach Wellbery zugrunde gelegt.
- Definition und Interpretation von Glück und Unglück im Kontext der Novelle
- Analyse des Wechsels zwischen Glück und Unglück in den einzelnen Abschnitten der Novelle
- Die Rolle des Zufalls und des Schicksals in der Gestaltung von Glück und Unglück
- Die Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse vor und nach dem Erdbeben
- Die Wirkung der Erzählperspektive auf die Interpretation von Glück und Unglück
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des Erdbebens als Glück oder Unglück für Jeronimo und Josephe. Sie definiert die Begriffe Glück, Unglück und Katastrophe und skizziert die Methodik der Analyse, die auf der Dreiteilung der Novelle durch Wellbery basiert.
Glück und Unglück in Teil A – Das Erdbeben: Dieser Abschnitt analysiert den Beginn der Novelle, in dem Jeronimo und Josephe kurz vor ihrem Tod stehen. Das Erdbeben unterbricht diese Situation und rettet sie scheinbar. Der Erzähler präsentiert jedoch ein ambivalentes Bild, indem er Glück und Unglück miteinander verwebt und durch die Verwendung von „Als-ob“-Sätzen die Interpretation verkompliziert. Jeronimo erlebt einen ständigen Wechsel zwischen Freude über sein Überleben und Reue, während Josephe durch das Erdbeben vor ihrer Hinrichtung gerettet wird, aber auch den Verlust der Äbtissin betrauert. Trotz des Chaos findet die Wiedervereinigung der Liebenden statt, wodurch das Erdbeben letztlich als Glück interpretiert werden kann.
Glück und Unglück in Teil B - Die Idylle und Täuschung: Dieser Teil beschreibt die scheinbar idyllische Situation nach dem Erdbeben. Die Gesellschaft hat sich verändert, und Jeronimo und Josephe finden scheinbar Aufnahme in einer neuen, gerechteren Ordnung. Die Idylle stellt einen Zustand des Glücks dar, in dem die Protagonisten das Erlebte vergessen und an eine glückliche Fügung des Himmels glauben. Dieser Abschnitt hebt den Gegensatz zwischen dem Schein der Idylle und der möglicherweise dahinterliegenden Täuschung hervor, die im folgenden Kapitel thematisiert wird.
Schlüsselwörter
Das Erdbeben in Chili, Heinrich von Kleist, Glück, Unglück, Zufall, Schicksal, Idylle, Täuschung, Erzählperspektive, Ambivalenz, Gesellschaftliche Verhältnisse, Moral, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu „Das Erdbeben in Chili“: Glück und Unglück bei Jeronimo und Josephe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Wechsel von Glück und Unglück der Protagonisten Jeronimo und Josephe in Heinrich von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Zufall und Schicksal und deren Auswirkungen auf die Figuren. Die Analyse stützt sich auf die Dreiteilung der Novelle nach Wellbery.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Definition und Interpretation von Glück und Unglück im Kontext der Novelle, analysiert den Wechsel zwischen Glück und Unglück in den einzelnen Abschnitten, untersucht die Rolle von Zufall und Schicksal, beleuchtet die gesellschaftlichen Verhältnisse vor und nach dem Erdbeben und betrachtet die Wirkung der Erzählperspektive auf die Interpretation von Glück und Unglück.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Kapitel, die die drei Teile der Novelle nach Wellbery (Das Erdbeben, Die Idylle und Täuschung, Der Mord) untersuchen, und ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert den Wechsel von Glück und Unglück für Jeronimo und Josephe im jeweiligen Abschnitt.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des Erdbebens als Glück oder Unglück für Jeronimo und Josephe. Sie definiert die Begriffe Glück, Unglück und Katastrophe und beschreibt die Methodik der Analyse, die auf Wellberys Dreiteilung basiert.
Was wird im Kapitel „Das Erdbeben“ analysiert?
Dieses Kapitel analysiert den Beginn der Novelle, in dem Jeronimo und Josephe kurz vor ihrem Tod stehen und durch das Erdbeben gerettet werden. Es wird das ambivalente Bild von Glück und Unglück, das der Erzähler präsentiert, untersucht, und der ständige Wechsel zwischen Freude und Reue bei Jeronimo sowie Josephen´s ambivalente Gefühle werden beleuchtet. Trotz des Chaos findet die Wiedervereinigung der Liebenden statt.
Was ist der Inhalt des Kapitels „Die Idylle und Täuschung“?
Dieses Kapitel beschreibt die scheinbar idyllische Situation nach dem Erdbeben und die veränderte Gesellschaft. Es analysiert den Zustand des Glücks, in dem die Protagonisten das Erlebte vergessen und an eine glückliche Fügung glauben. Der Gegensatz zwischen dem Schein der Idylle und der möglicherweise dahinterliegenden Täuschung wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Das Erdbeben in Chili, Heinrich von Kleist, Glück, Unglück, Zufall, Schicksal, Idylle, Täuschung, Erzählperspektive, Ambivalenz, Gesellschaftliche Verhältnisse, Moral, Gerechtigkeit.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Analyse basiert auf der Dreiteilung der Novelle nach Wellbery und untersucht die Darstellung von Glück und Unglück in den einzelnen Teilen. Die Arbeit betrachtet die Rolle von Zufall und Schicksal und die Wirkung der Erzählperspektive.
Welche zentrale Frage wird gestellt?
Die zentrale Frage ist, welche Bedeutung das Erdbeben als Glück oder Unglück für Jeronimo und Josephe hat.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Glück und Unglück von Jeronimo und Josephe in der Novelle "Das Erdbeben in Chili" von Heinrich von Kleist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457598