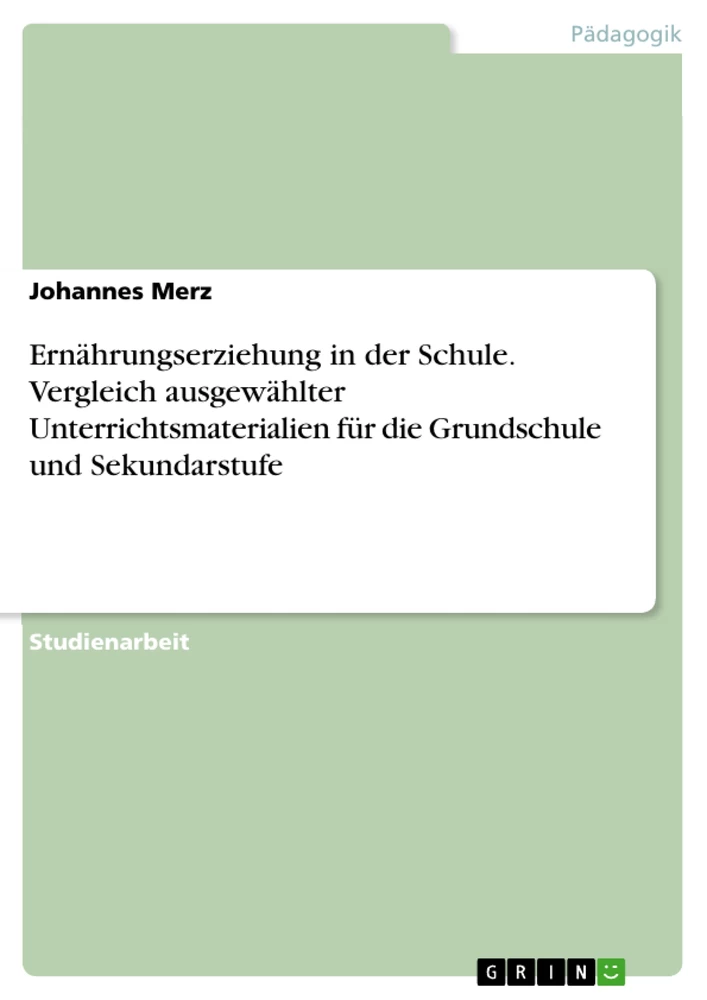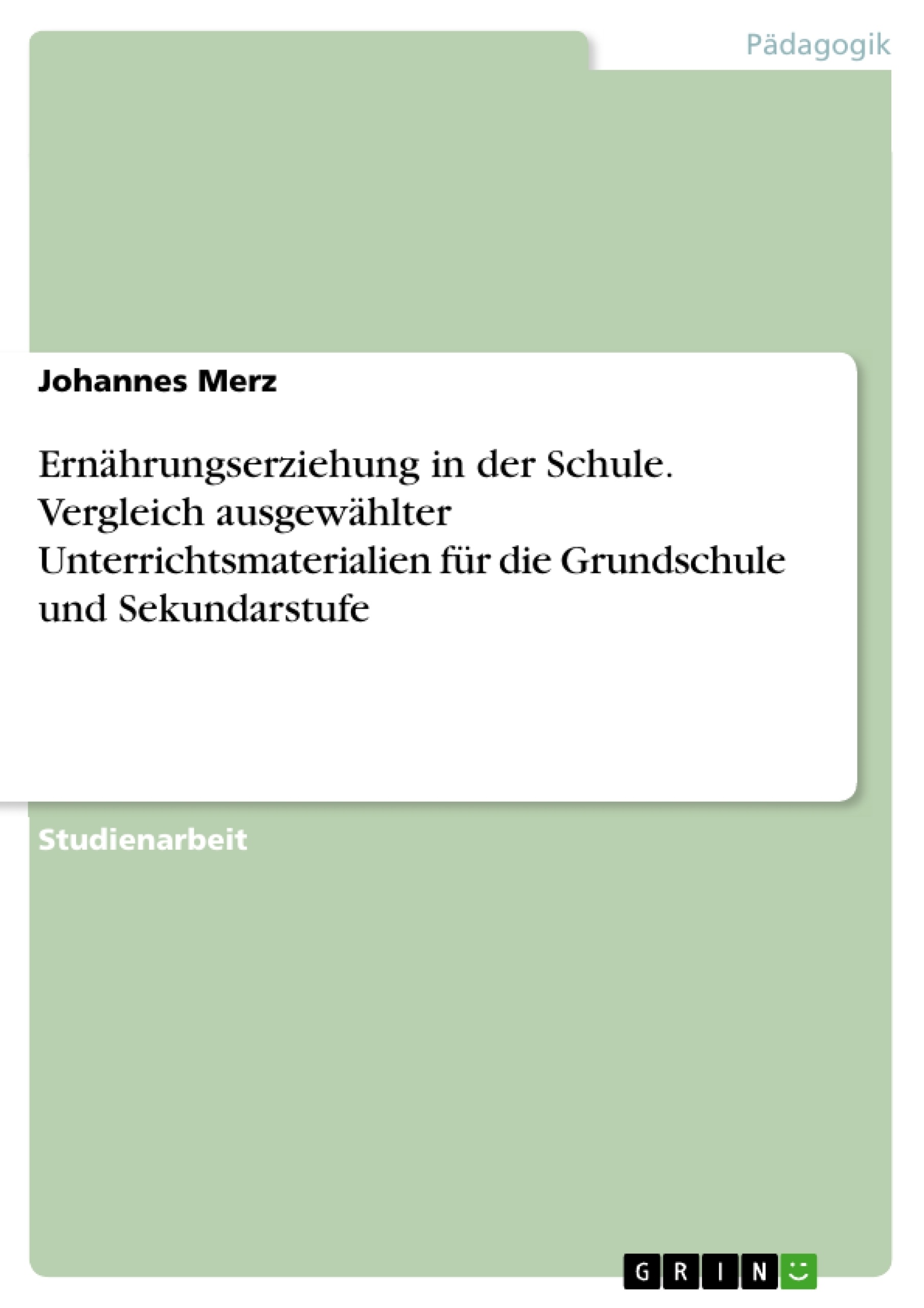Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, ausgewählte Unterrichtsmaterialien zum Thema Ernährung vorzustellen und Unterschiede zwischen den Altersstufen heraus zu arbeiten. Dabei soll gezeigt werden, dass in der Grundschule besonders die praktischen Erfahrungen mit Ernährung im Mittelpunkt stehen, und dass in der Sekundarstufe die Wissensvermittlung und Reflexion zunehmend an Bedeutung gewinnt.
„Es gibt keine Maßnahme zur Vorbeugung gegen Krankheiten, die wirkungsvoller und kostengünstiger wäre als richtige Ernährung“. Diese Tatsache sollte man auch aus folgenden Gründen als Leitfaden und Motivation für die Ernährungserziehung in der Schule übernehmen: Zum einen ist eine gesunde Ernährung für das Wachstum und die Entwicklung von Kindern sehr wichtig, zum anderen werden die im Kindesalter eingeübten Essgewohnheiten größtenteils im Erwachsenenalter beibehalten. Als ein Teil übergeordneter Lernziele muss daher die Ernährungserziehung eine entscheidende Rolle in der Schule spielen. Sie muss dafür sorgen, dass aus gesunden Kindern gesunde Erwachsene werden, denn die Gesundheit ist eine entscheidende Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.
Zu Beginn dieser Hausarbeit werde ich jedoch zunächst den heutigen Stand der Ernährung von Kindern und Jugendlichen aufzeigen und anschließend argumentieren, dass die Ernährungserziehung nicht den geforderten Stellenwert in den Curricula der hessischen Schulformen hat. Im letzten Kapitel möchte ich schließlich alle gesammelten Informationen zusammenführen und ein Fazit ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ernährung im Kindes- und Jugendalter
- Empfehlungen der DGE
- Ernährungsbericht 2008 (VELS und EsKiMo)
- Ernährungserziehung in der Schule
- Vergleich von Unterrichtsmaterialien
- Materialien für die Grundschule
- „5 am Tag“ macht Schule
- „Die Kuh“
- Materialien für die Sekundarstufe I und II
- „5 am Tag“ macht Schule
- Lerneinheit „Verschiedene Vorstellungen vom Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit“
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Materialien für die Grundschule
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Vorstellung und dem Vergleich ausgewählter Unterrichtsmaterialien für die Grundschule und Sekundarstufe zum Thema Ernährung. Das Ziel ist es, Unterschiede zwischen den Altersstufen hinsichtlich der Inhalte und Methoden der Ernährungserziehung aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Praxisorientierung in der Grundschule und der zunehmenden Bedeutung von Wissensvermittlung und Reflexion in der Sekundarstufe.
- Der aktuelle Stand der Ernährung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
- Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
- Die Rolle der Ernährungserziehung in der Schule
- Der Vergleich verschiedener Unterrichtsmaterialien für die Grundschule und Sekundarstufe
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Materialien
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung der Ernährungserziehung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hervorgehoben. Kapitel zwei beleuchtet den aktuellen Stand der Ernährung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland anhand der Empfehlungen der DGE und der Ergebnisse des Ernährungsberichtes 2008. Dabei werden Defizite in der Nährstoffzufuhr, insbesondere im Bereich von Obst und Gemüse, aufgezeigt. Der Fokus des dritten Kapitels liegt auf der Rolle der Ernährungserziehung in der Schule. Es wird argumentiert, dass diese einen entscheidenden Beitrag zur Förderung einer gesunden Lebensweise leistet und dass sie einen höheren Stellenwert in den Curricula der hessischen Schulformen einnehmen sollte. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Vergleich von Unterrichtsmaterialien zum Thema Ernährung für die Grundschule und Sekundarstufe. Es werden verschiedene Materialien vorgestellt, die sich in ihrer Ausrichtung und Methodik unterscheiden. Im fünften Kapitel werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der vorgestellten Unterrichtsmaterialien zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Ernährungserziehung, Unterrichtsmaterialien, Grundschule, Sekundarstufe, DGE, Ernährungsbericht 2008, VELS, EsKiMo, Obst, Gemüse, Ernährungskreis, Lebensmittelpyramide, gesunde Ernährung, Praxisorientierung, Wissensvermittlung, Reflexion
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Ernährungserziehung in der Schule?
Ziel ist es, Kindern eine gesunde Lebensweise zu vermitteln, da Essgewohnheiten aus der Kindheit meist bis ins Erwachsenenalter beibehalten werden.
Wie unterscheiden sich Materialien für Grundschule und Sekundarstufe?
In der Grundschule stehen praktische Erfahrungen im Vordergrund, während in der Sekundarstufe die Wissensvermittlung und Reflexion an Bedeutung gewinnen.
Was besagt der Ernährungsbericht 2008 über Kinder?
Der Bericht (VELS und EsKiMo) zeigt Defizite in der Nährstoffzufuhr auf, insbesondere einen zu geringen Verzehr von Obst und Gemüse.
Welche Rolle spielt die DGE in der Ernährungserziehung?
Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) dienen als wissenschaftliche Basis für die Unterrichtsinhalte.
Was ist das Projekt "5 am Tag"?
Es ist ein vorgestelltes Unterrichtsmaterial, das die Bedeutung von fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag spielerisch und informativ vermittelt.
Hat Ernährungserziehung einen hohen Stellenwert in den Lehrplänen?
Die Arbeit kritisiert, dass Ernährungserziehung in den Curricula (am Beispiel Hessens) oft noch nicht den geforderten und notwendigen Stellenwert einnimmt.
- Quote paper
- Johannes Merz (Author), 2009, Ernährungserziehung in der Schule. Vergleich ausgewählter Unterrichtsmaterialien für die Grundschule und Sekundarstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457702