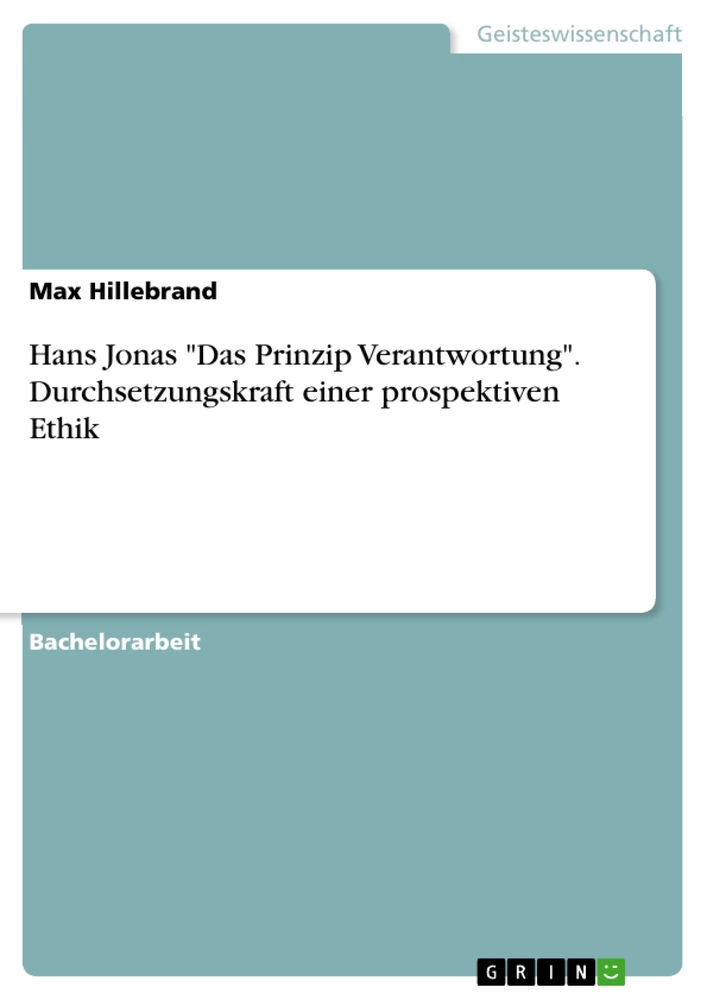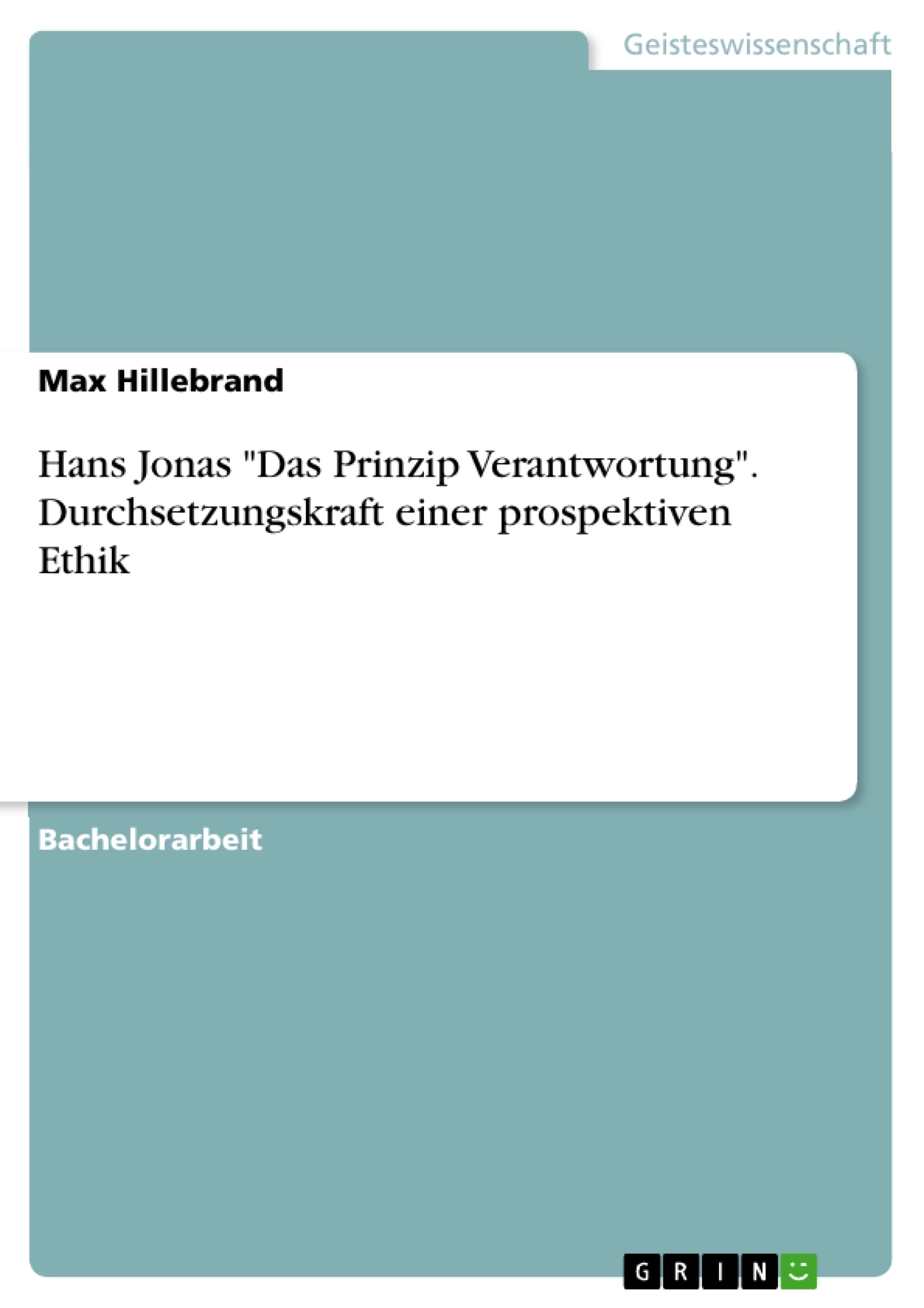Diese Arbeit strebt eine Untersuchung der Verantwortungsethik von Hans Jonas an und überprüft, ob seine Ethik die fortgeschrittene technologisierte Zivilisation trifft und seinem Anspruch den Handlungsbereich der Ethik um eine zeitliche Komponente zu erweitern, gerecht wird. Folgend gilt es in Betrachtung dessen, die Frage zu stellen, wie sich der Erfolg des Prinzips Verantwortung in umweltethischen Diskursen manifestieren konnte.
„Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ (Jonas, H., 2017)
Die Menschheit lebt ein offenes Fortschrittsdenken. Große Weltunternehmen handeln für ihre eigenen Profitinteressen und gegen soziale oder ökologische Richtwerte. So ist die Lösung zur Endlagerung von Atommüll bis heute nicht endgültig geregelt. Aktuelle Diskurse über die Luftverschmutzung durch Dieselfahrzeuge polarisieren in den Medien und nach dem Austritt der USA aus dem Klimaschutzabkommen scheinen die Werte der ökologischen Aufklärung ins Nichts zu verlaufen. In diesem Zusammenhang bildet der Begriff „Verantwortung“ eine große Bedeutung, wie es Hans Jonas 1979 in seinem
ökologischen Imperativ vorstellt, denn die „technische Intervention des Menschen“ (Ebd.) verdeutlicht die Verletzlichkeit der Natur und stellt den Menschen somit in Verantwortung für „die gesamte Biosphäre des Planeten, [...] weil wir Macht darüber
haben“. (Ebd.)
Mit seinem Spätwerk „Das Prinzip Verantwortung“ förderte Hans Jonas die ethischen Diskurse der achtziger Jahre. Zu jener Zeit galt das Buch als ein „philosophischer Bestseller“. (Hubig, C., 1995) Fast 40 Jahre nach Erstveröffentlichung richtet sich
Jonas’ Zukunftsvision mehr denn je auf unsere heutige Gesellschaft. Angelegt an die Allgemeingültigkeit des kategorischen Imperativs verdeutlicht Jonas ein naturbewusstes Handeln, in dem er eine Ethik für die technologisierte Zivilisation entwirft. Jedoch ist die vorgebrachte Technikfeindlichkeit unserer modernen Risikogesellschaft fremd: „So sehr wurde [die Risikogesellschaft] zur Selbstverständlichkeit, dass jede Fragwürdigkeit verschwinden konnte und eine konturlose Fraglosigkeit kaum einen Anknüpfungspunkt mehr zuzulassen scheint [...]. Damalige Normativität gilt als falsifiziert durch heutige Normalität.“ (Schmidt, J. C., 2007)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Person Hans Jonas: Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Geschichte
- Das Prinzip Verantwortung
- Definition von Verantwortung
- Ursachenanalyse: Veränderung im Handeln des Menschen
- Begründung: Pflicht zur Existenzerhaltung
- Erweiterung des kategorischen Imperativs: Gesinnungsethik und Verantwortungsethik
- Begründungssätze der Umweltethik
- Kant als Umweltethiker
- Probleme des ökologischen Imperativs
- Der Erfolg des Prinzips Verantwortung
- Problemlage und Ausblick des Verantwortungsbegriffs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit Hans Jonas' „Prinzip Verantwortung“ und seiner Bedeutung für die heutige Gesellschaft. Die Arbeit analysiert, wie Jonas' Verantwortungsethik die ethischen Diskurse der achtziger Jahre beeinflusst hat und welche Relevanz sie für die Herausforderungen unserer technologisierten Zivilisation besitzt.
- Die Person Hans Jonas und sein Lebenswerk im Kontext von Umweltschutz und Nachhaltigkeit
- Die Definition und Begründung des Prinzips Verantwortung
- Die Erweiterung des kategorischen Imperativs im Kontext der Umweltethik
- Die Herausforderungen und Chancen des Prinzips Verantwortung für die heutige Gesellschaft
- Der Einfluss des Prinzips Verantwortung auf umweltethische Diskurse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Problemlage, die durch die Folgen von Fortschrittsdenken, Konsumverhalten und die technische Intervention des Menschen geprägt ist. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Hans Jonas' Leben und Werk, indem es die geschichtliche Einordnung des Prinzips Verantwortung im Kontext von Umweltschutz und Nachhaltigkeit beleuchtet. Kapitel drei befasst sich mit der Definition und Begründung des Prinzips Verantwortung, während Kapitel vier die Erweiterung des kategorischen Imperativs durch Jonas' Verantwortungsethik in den Vordergrund stellt. Dabei werden die Begründungssätze der Umweltethik sowie Kants Position in diesem Kontext näher beleuchtet. Das fünfte Kapitel fokussiert sich auf den Erfolg des Prinzips Verantwortung in umweltethischen Diskursen. Die Problemlage und die Zukunft des Verantwortungsbegriffs werden in Kapitel sechs behandelt.
Schlüsselwörter
Hans Jonas, Prinzip Verantwortung, Umweltethik, ökologischer Imperativ, technologisierte Zivilisation, Risikogesellschaft, Nachhaltigkeit, Kants Moralphilosophie, anthropozentrische Ethik, Existenzerhaltung.
- Citar trabajo
- Max Hillebrand (Autor), 2018, Hans Jonas "Das Prinzip Verantwortung". Durchsetzungskraft einer prospektiven Ethik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457730