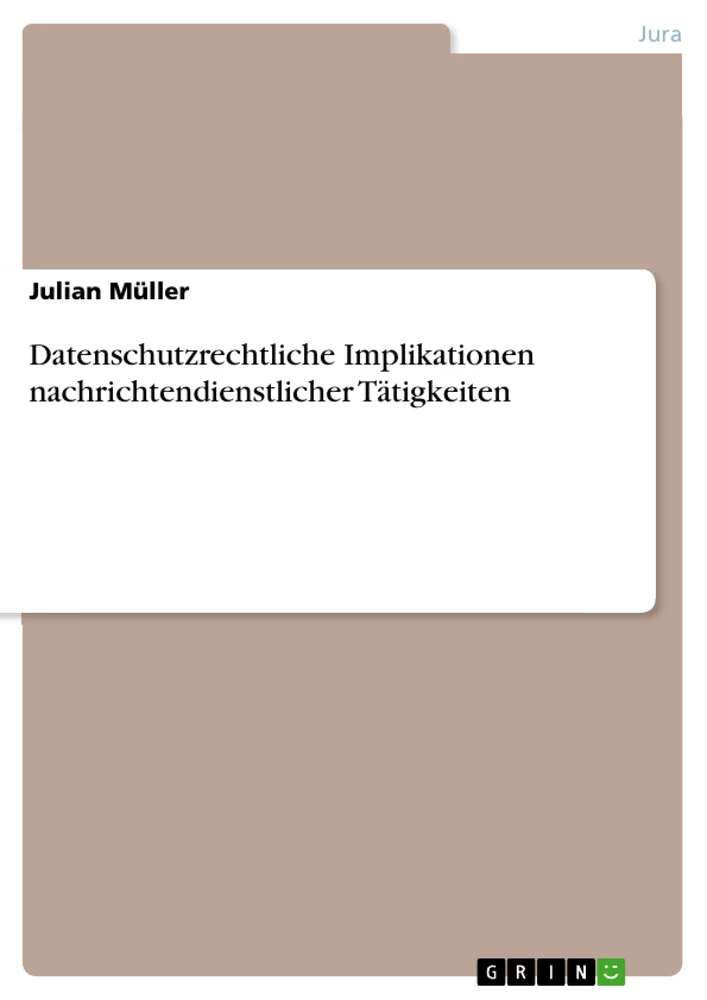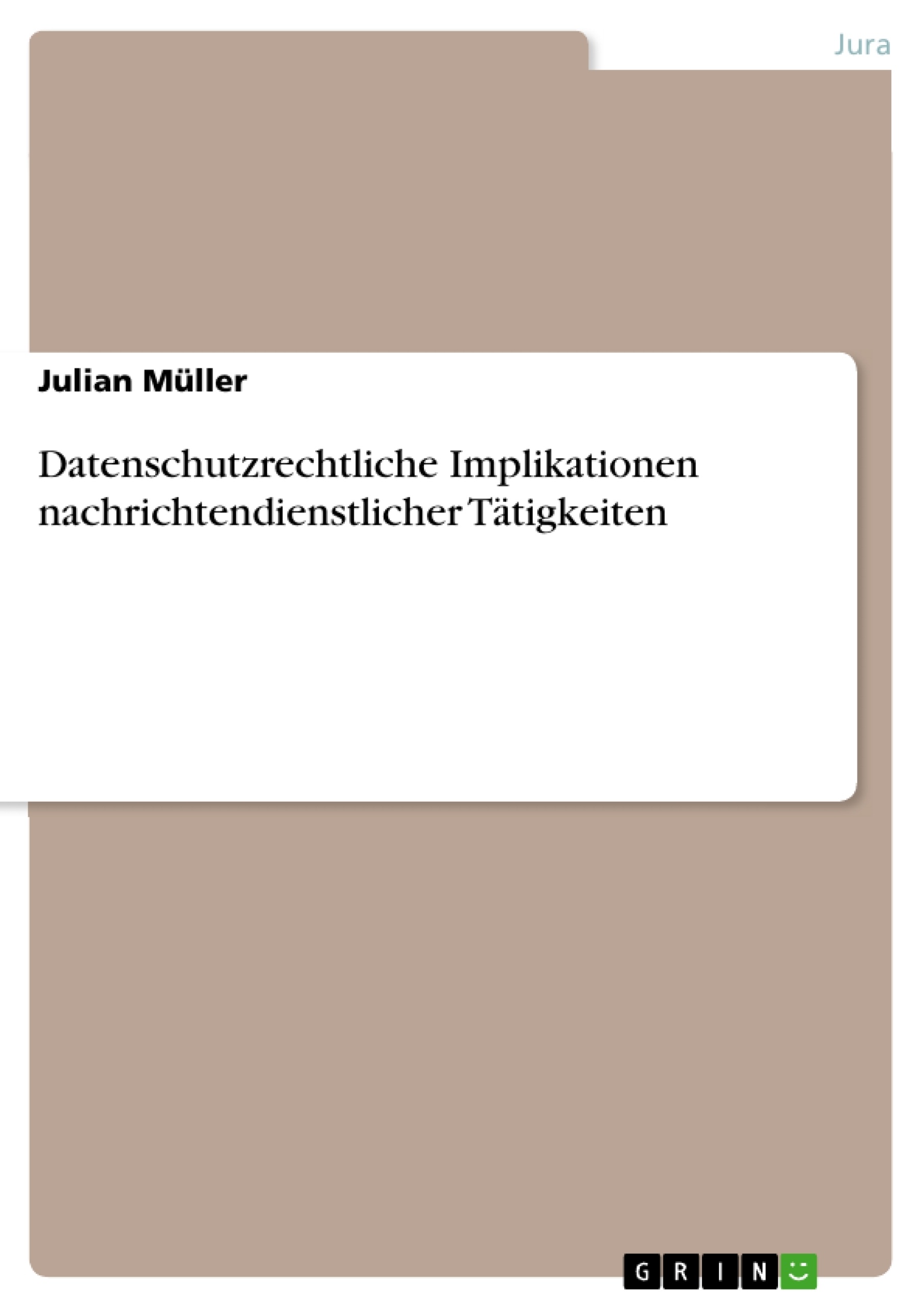Die Ausarbeitung beleuchtet, inwiefern die Datenübermittlung von personenbezogenen Daten zwischen Nachrichtendiensten reguliert wird.
Der 11. September 2001 – ein historisches Datum, das eine der größten Krisen nach dem Ende des Kalten Krieges hervorgerufen hat. Als Folge des islamistischen Terroraktes rüsteten die Sicherheitsbehörden auf, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, gleichwohl aber auch in faktisch allen abendländisch geprägten Ländern. Auch der Austausch von personenbezogenen Daten nahm weltweit zu.
Heute, im Jahr 2018 hat sich die Lage abermals verschärft. Mit dem Aufkommen des sogenannten islamischen Staates (IS) hat sich die sicherheitspolitische Lage in der gesamten Welt radikal geändert. Anders als Al-Qaida animiert und rekrutiert der IS insbesondere auch im Bereich der virtuellen Welt. Durch Instant-Messenger-Dienste wie WhatsApp, Viber, Skype und Telegram oder aber mithilfe von klassischen sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter verbinden sich weltweit Salafisten, Jihadisten und radikale Islamisten. Längst hat der IS das sogenannte „Cyber-Kalifat“ ausgerufen. Im Konkreten bedeutet dies, dass kein physisches Treffen mehr zwischen Anwerbern und potenziellen Interessenten stattfinden muss.
In der Vergangenheit haben deutsche Sicherheitsbehörden, hierbei insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) festgestellt, dass Kontakte zu Islamisten sowie die Radikalisierungsverläufe im Allgemeinen hauptsächlich online stattfinden. Inzwischen können sich Sympathisanten und Aktivisten der islamistischen Szene immer weiter als Teil einer Gesamtbewegung begreifen, die offensichtlich annährend weltumfassend agiert. Diese Aktivitäten werden seit geraumer Zeit auch als der „globale Jihad“ bezeichnet. Die Weltdeutung der Islamisten fußt hier insbesondere auf ihre Eigenwahrnehmung als Opfer und um eine vermeintliche universale Gerechtigkeit wiederherzustellen, sollen weltweit Kämpfer über das Internet rekrutiert werden.
Aus dieser Erkenntnis folgt, dass die Bekämpfung dieses Problems nicht an nationalen Grenzen Halt machen kann. Vielmehr ist ein ganzheitlicher Ansatz zu verfolgen. Nationale Sicherheitsbehörden können nur in begrenzten Umfang Nachrichten über islamistische und jihadistische Strömungen beschaffen und auswerten. Von essenzieller Relevanz ist daher ein organisierter, planbarer Datenaustausch zwischen den einzelnen Nachrichtendiensten auf nationaler, aber insbesondere auch auf internationaler Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Notwendigkeit für internationale nachrichtendienstliche Kooperationen
- Das nachrichtendienstliche System
- Rechtsgrundlagen für die internationale Datenübermittlung deutscher Nachrichtendienste
- Bundesnachrichtendienst
- Verfassungsschutzverbund
- Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst
- Lex specialis: Artikel 10-Gesetz und Sicherheitsüberprüfungsgesetz
- Artikel 10-Gesetz
- Sicherheitsüberprüfungsgesetz
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den datenschutzrechtlichen Implikationen nachrichtendienstlicher Tätigkeiten im Kontext des Datenaustauschs mit Drittstaaten. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die den internationalen Datenaustausch deutscher Nachrichtendienste regeln, und untersucht die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und nationaler Sicherheit ergeben.
- Rechtliche Grundlagen für den internationalen Datenaustausch
- Datenschutzrechtliche Implikationen
- Herausforderungen im Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und nationaler Sicherheit
- Internationale Kooperation von Nachrichtendiensten
- Der Datenaustausch mit Drittstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung
Die Einführung beleuchtet die Notwendigkeit für internationale nachrichtendienstliche Kooperationen im Kontext des globalen Terrorismus, insbesondere des islamistischen Terrors. Darin wird der zunehmende Einfluss des „Cyber-Kalifats“ des Islamischen Staats (IS) und die Relevanz von Online-Aktivitäten für die Radikalisierung von Personen hervorgehoben. Der Text unterstreicht die Wichtigkeit eines internationalen Datenaustauschs zwischen Nachrichtendiensten, um diesem Problem effektiv zu begegnen. Zusätzlich werden weitere Phänomene wie Linksextremismus und Rechtsextremismus angesprochen, die ebenfalls von grenzübergreifender Zusammenarbeit profitieren. Die Einführung stellt fest, dass die rechtlichen Regularien im Bereich der Nachrichtendienste weltweit stark variieren, was Herausforderungen für die internationale Kooperation mit sich bringt.
1.2 Das nachrichtendienstliche System
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau des nachrichtendienstlichen Systems und den Herausforderungen, die sich im Kontext der internationalen Kooperation stellen. Die Notwendigkeit für internationale Zusammenarbeit zwischen Nachrichtendiensten wird erneut betont und es wird auf die datenschutzrechtlichen Aspekte der Zusammenarbeit eingegangen.
2. Rechtsgrundlagen für die internationale Datenübermittlung deutscher Nachrichtendienste
Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Rechtsgrundlagen, die den internationalen Datenaustausch deutscher Nachrichtendienste regeln. Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Datenaustausch des Bundesnachrichtendienstes, des Verfassungsschutzverbundes und des Bundesamts für den militärischen Abschirmdienst.
2.4 Lex specialis: Artikel 10-Gesetz und Sicherheitsüberprüfungsgesetz
Dieses Kapitel behandelt die beiden Gesetze, die eine wichtige Rolle im Bereich des Datenaustauschs spielen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des Datenschutzes und der nationalen Sicherheit, insbesondere im Kontext der internationalen Kooperation von Nachrichtendiensten. Schlüsselbegriffe sind: Datenschutzrecht, Nachrichtendienste, Datenübermittlung, Drittstaaten, Verfassungsschutz, Islamischer Staat (IS), Terrorismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Artikel 10-Gesetz, Sicherheitsüberprüfungsgesetz, Lex specialis.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Datenaustausch zwischen Nachrichtendiensten reguliert?
Die Arbeit analysiert Rechtsgrundlagen wie das Artikel 10-Gesetz und das Sicherheitsüberprüfungsgesetz für die internationale Datenübermittlung.
Was ist das „Cyber-Kalifat“ des IS?
Es bezeichnet die Strategie des Islamischen Staates, Rekrutierung und Propaganda fast ausschließlich über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste zu betreiben.
Dürfen deutsche Dienste Daten an Drittstaaten übermitteln?
Ja, dies ist unter Einhaltung spezifischer datenschutzrechtlicher Vorgaben möglich, um Bedrohungen wie den globalen Jihad zu bekämpfen.
Welche deutschen Behörden sind am Datenaustausch beteiligt?
Untersucht werden der Bundesnachrichtendienst (BND), der Verfassungsschutzverbund (BfV) und der militärische Abschirmdienst (MAD).
Wie stehen Datenschutz und nationale Sicherheit zueinander?
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz personenbezogener Daten und der Notwendigkeit effektiver Gefahrenabwehr.
- Arbeit zitieren
- Julian Müller (Autor:in), 2018, Datenschutzrechtliche Implikationen nachrichtendienstlicher Tätigkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457802