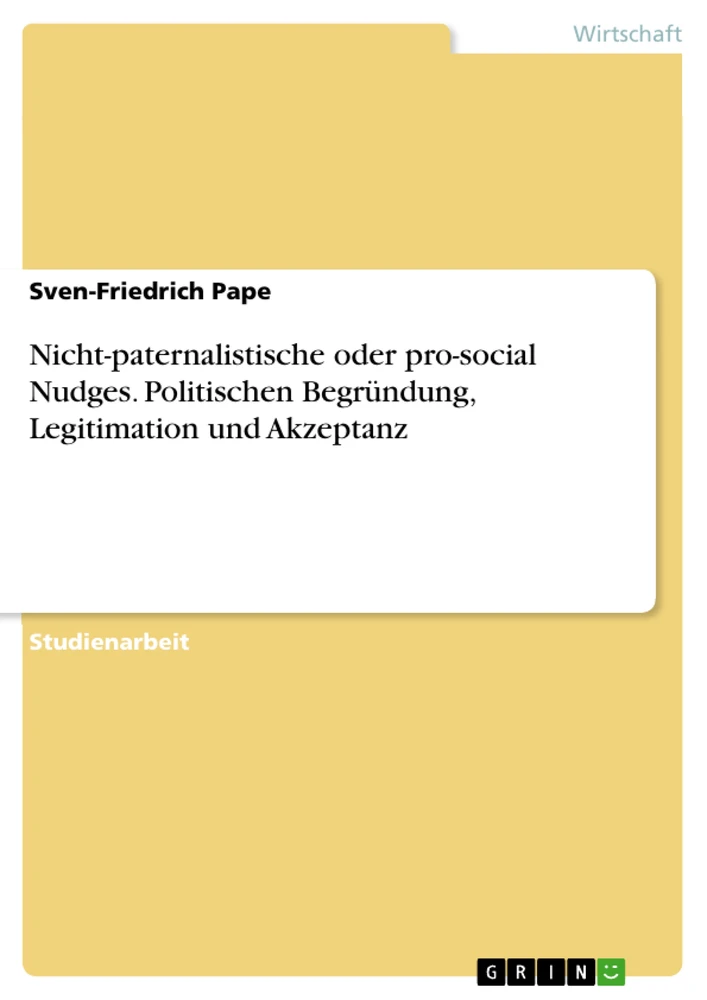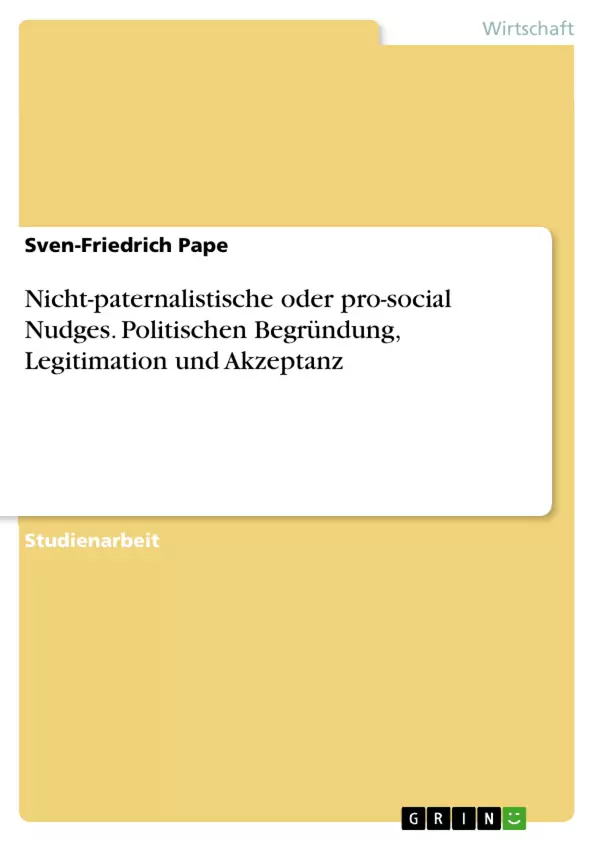Die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises des Jahres 2017 an Richard Thaler für seine Verdienste um die Verhaltensökonomik haben die von ihm miterfundenen Nudges einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. In der Politik hingegen werden Nudges als möglicher Bestandteil des politischen Werkzeugkastens schon länger von immer mehr Regierungen weltweit mit großem Interesse betrachtet; 2014 wurde eine entsprechende Regierungsabteilung in den Vereinigten Staaten gegründet, 2015 folgten Australien und Deutschland diesem Beispiel.
Viele der im Bereich der Politik denkbaren und angedachten Nudges gehen in ihren Absichten und Zielen über die Überlegungen Thalers hinaus. Sie werden in der Literatur als nicht-paternalistische oder auch pro-social Nudges bezeichnet und stehen im Mittelpunkt dieser Hausarbeit. Es soll im Folgenden aufgezeigt werden, wo ihre Möglichkeiten liegen – aber auch, wo sie an Grenzen stoßen.
Dazu wird zunächst definiert, was ein nicht-paternalistischer Nudge in Abgrenzung zu den Vorstellungen von Thaler und Sunstein ist, bevor zwei Untersuchungen vorgestellt werden, die sich mit der Akzeptanz unterschiedlicher Nudges in unter-schiedlichen Staaten von Seiten der Bevölkerung befassen. Daran anschließend werden drei verschiedene nicht-paternalistische Nudges vorgestellt und näher auf ihre Möglichkeiten und Grenzen hin untersucht. Schlussendlich werden die Ergebnisse zusammengefasst und kritisch gewürdigt. Dabei wird deutlich werden, dass sich bei der Nutzung von Nudges als politisches Instrument nicht nur die Frage danach stellt, ob sie funktionieren, sondern immer auch die Frage nach ihrer jeweili-gen politischen Begründung, Legitimation und Akzeptanz.
Da das Feld möglicher Nudges sehr weit und die wissenschaftliche Literatur dazu mannigfaltig ist, kann im Rahmen dieser Hausarbeit keine umfassende Darstellung und Systematisierung aller denkbaren nicht-paternalistischer Nudges erfolgen. Vielmehr geht es darum, anhand der drei ausgewählten Beispiele einen möglichst breiten Überblick über die Arten und Anwendungsfelder von nicht-paternalistischen Nudges zu bieten und allgemeine Fragen und Probleme aufzuwerfen, die so auch für andere Nudges übertragbar erscheinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Akzeptanz von Nudges
- Beispiele
- Stromverbrauch
- Organspende
- Altersvorsorge
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit nicht-paternalistischen Nudges und untersucht ihre Möglichkeiten und Grenzen. Der Fokus liegt auf Nudges, die nicht das Individuum, sondern die Gesellschaft besserstellen sollen. Es werden zwei Studien zur Akzeptanz von Nudges vorgestellt, bevor drei konkrete Beispiele für nicht-paternalistische Nudges im Bereich des Stromverbrauchs, der Organspende und der Altersvorsorge analysiert werden.
- Definition und Abgrenzung von nicht-paternalistischen Nudges
- Akzeptanz von Nudges in der Bevölkerung und mögliche Unterschiede zwischen Staaten und Nudge-Typen
- Möglichkeiten und Grenzen nicht-paternalistischer Nudges anhand von drei Beispielen
- Politische Begründung, Legitimation und Akzeptanz von Nudges als politisches Instrument
- Die Bedeutung der individuellen und gesellschaftlichen Perspektive bei der Beurteilung von Nudges
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit führt in das Thema der nicht-paternalistischen Nudges ein, die im Gegensatz zu den von Richard Thaler und Cass Sunstein beschriebenen Nudges nicht das Individuum, sondern die Gesellschaft besserstellen sollen. Die Arbeit befasst sich mit der Definition, Akzeptanz und den Einsatzmöglichkeiten von nicht-paternalistischen Nudges.
- Definitionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Nudge" und unterscheidet zwischen paternalistischen und nicht-paternalistischen Nudges. Es wird erläutert, dass sich die beiden Nudge-Typen in ihren Zielen unterscheiden: Paternalistische Nudges sollen das Individuum besser stellen, während nicht-paternalistische Nudges der Gesellschaft zugutekommen sollen.
- Akzeptanz von Nudges: Zwei Studien untersuchen die öffentliche Einstellung gegenüber Nudges in Schweden und den USA sowie in sechs europäischen Staaten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Akzeptanz von Nudges von Land zu Land unterschiedlich ist und von der Art des Nudges und dem zugrundeliegenden Ziel abhängt.
- Beispiele für nicht-paternalistische Nudges: Dieses Kapitel stellt drei konkrete Beispiele für nicht-paternalistische Nudges vor: Die Senkung des Stromverbrauchs durch den Vergleich des eigenen Verbrauchs mit dem der Nachbarschaft, die Steigerung der Organspendebereitschaft durch einen Opt-out-Default und die Förderung der Altersvorsorge durch standardmäßige Sparprogramme.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Thema nicht-paternalistische Nudges. Dabei werden wichtige Themen wie "Green Nudges", "Defaults", "Opt-in" und "Opt-out", "Choice Architecture", "libertärer Paternalismus", "soziokulturelle Hintergründe", "politische Begründung" und "Akzeptanz" behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Nudge" in der Politik?
Ein Nudge (Anstupser) ist eine Methode, um das Verhalten von Menschen ohne Verbote oder finanzielle Anreize in eine bestimmte Richtung zu lenken, indem die "Entscheidungsarchitektur" angepasst wird.
Was unterscheidet nicht-paternalistische von paternalistischen Nudges?
Paternalistische Nudges sollen das Individuum selbst besser stellen (z.B. gesündere Ernährung), während nicht-paternalistische Nudges der Gesellschaft zugutekommen sollen (z.B. Umweltschutz).
Wie wird Nudging bei der Organspende eingesetzt?
Durch einen "Opt-out-Default" wird jeder automatisch zum Spender, es sei denn, er widerspricht aktiv. Dies erhöht die Spendenbereitschaft signifikant im Vergleich zum "Opt-in".
Akzeptiert die Bevölkerung den Einsatz von Nudges?
Die Akzeptanz hängt stark vom Ziel des Nudges und dem Land ab. Während "Green Nudges" oft akzeptiert werden, gibt es bei Eingriffen in die private Lebensführung mehr Skepsis.
Was sind die Grenzen von Nudging als politisches Instrument?
Grenzen liegen in der ethischen Legitimation, der Transparenz der Beeinflussung und der Frage, ob Nudges langfristige Verhaltensänderungen ohne echte Einsicht bewirken können.
- Quote paper
- Sven-Friedrich Pape (Author), 2018, Nicht-paternalistische oder pro-social Nudges. Politischen Begründung, Legitimation und Akzeptanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457827