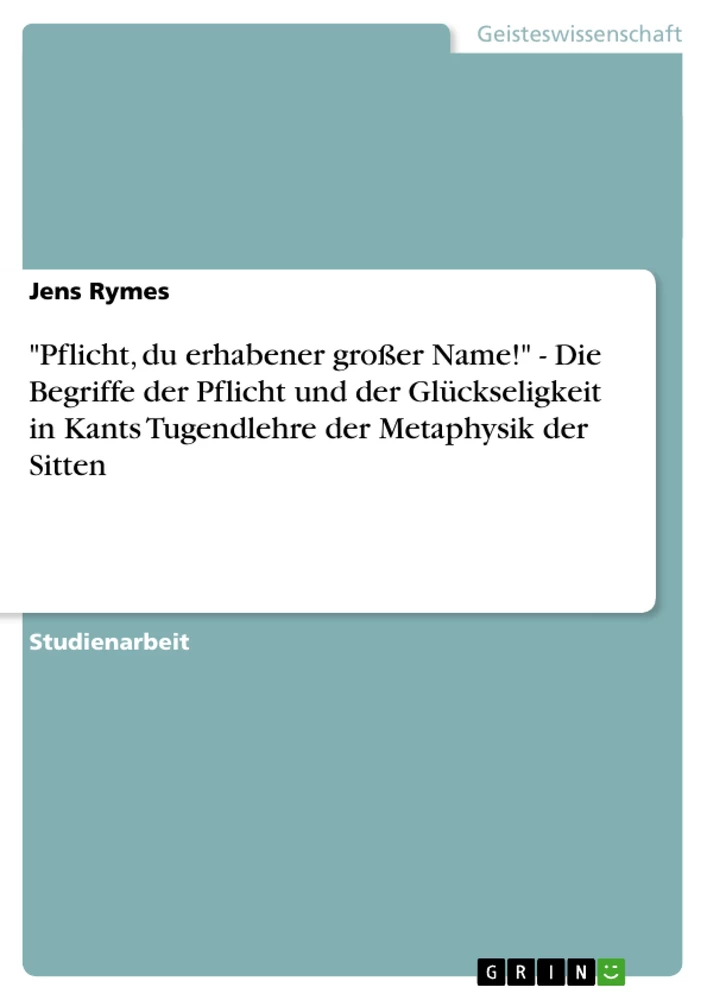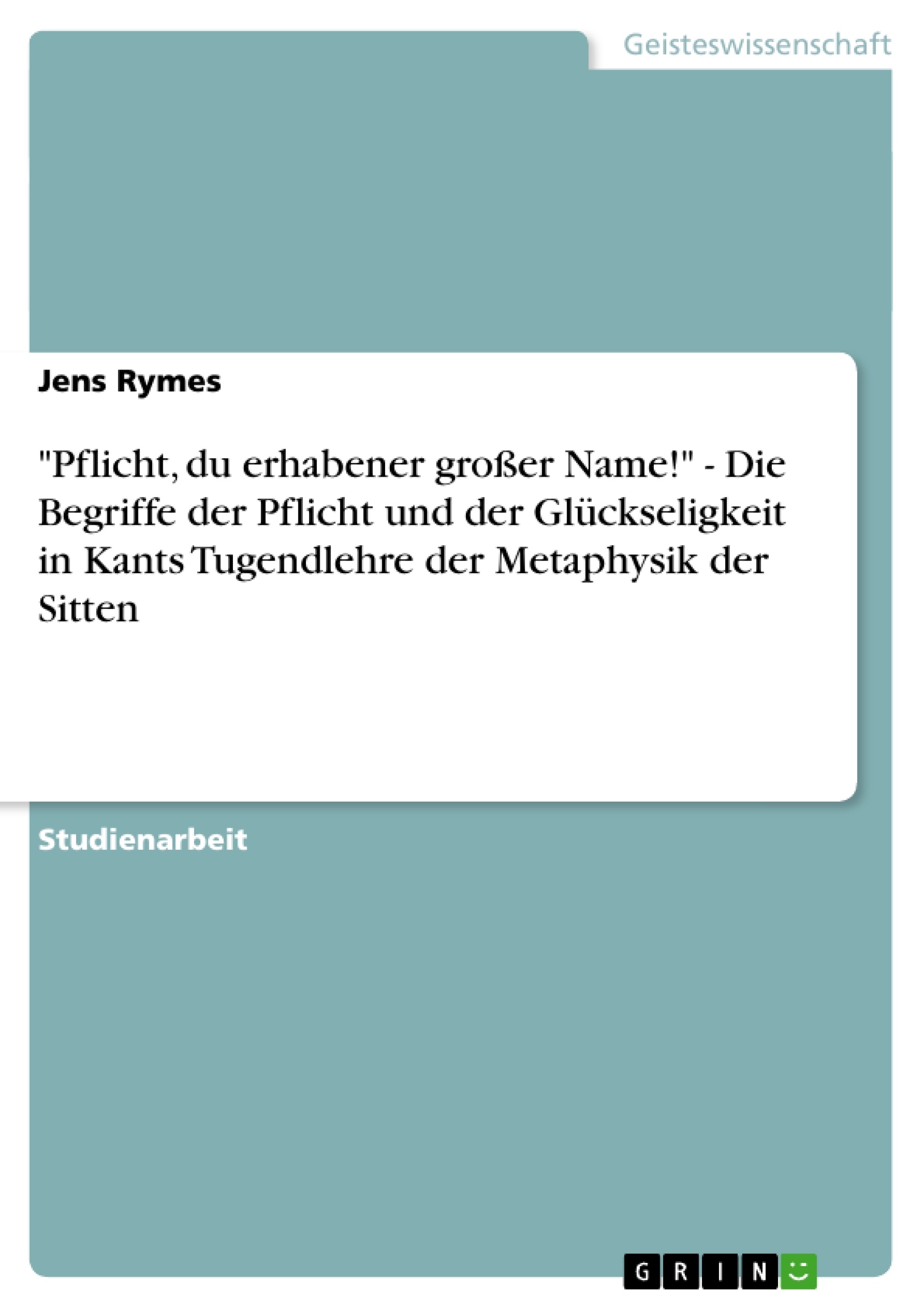In der Tugendlehre wendet sich Kant der Ethik als einer Lehre von Pflichten zu. Diese möchte er auf ihre „metaphysischen Anfangsgründe“ zurückführen und die Ethik als eine Lehre von allgemein verpflichtenden Zwecken, „von allem Empirischen (jedem Gefühl) gereinigt“ entwickeln. Die Metaphysik der Sitten führt somit die Untersuchungen der Kritik der praktischen Vernunft und der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten fort. Als „Kritik“ versteht Kant nicht Skepsis oder Anfechtung, sondern eine sorgfältige Prüfung durch die Vernunft. Zunächst hatte er den Begriff der reinen, später den der (reinen) praktischen Vernunft, kritisch untersucht, mit dem Ziel, legitime von illegitimen Zuschreibungen zu trennen. Die Leitfrage lautete dabei ‚was vermögen reine und reine praktische Vernunft, und was vermögen sie nicht?’. Es ging also um eine Schärfung der Begriffe durch Begrenzung. Die Kritiken sind grundlegende Schriften, die die Voraussetzung für die Epistemologie und die Ethik liefern sollten. Die Metaphysik stellt im Anschluss an sie die eigentliche philosophische Untersuchung dar. Sie ist konzipiert als ein System aufbauend auf „reinen, von aller Anschauungsbedingung unabhängigen Vernunftbegriffe n“2. Sowohl die Grundlegung,als auch die Kritik der praktischen Vernunftstellen also wichtige Grundlegungsschriften zur Moralphilosophie Kants dar. Diese ist eine Gesinnungsethik, die das Augenmerk auf die Art und Weise der inneren Zwecksetzung und ihre Übereinstimmung mit einer objektiven Pflicht hat. In der Vorrede zur Tugendlehre weist Kant die Idee einer eudaimonistischen Ethik von sich. Solche Glückseligkeitsethiken, als deren Hauptvertreter Aristoteles gilt, haben zum Gegenstand das gute Leben, sowohl im moralischen Sinne als auch im Sinne eines Lebens in Annehmlichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 „Das moralische Gesetz in mir“
2.1 Natürliche Dialektik
2.2 Maximen, Gesetze und Regeln
3 Rechtslehre und Tugendlehre
4 Zwecke und Selbstzwecke
4.1 Zwei Zwecklehren
4.2 Der Begriff des Zweckes, der zugleich Pflicht ist
4.3 Eigene Vollkommenheit
4.4 Fremde Glückseligkeit
5 Glückseligkeit
5.1 Der „Widerspruch des Eudaimonisten“
5.2 Glückseligkeit als inhärenter Zweck
5.3 Das Verhältnis von Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit
6 Schluss
7 Bibliographie
1 Einleitung
In der Tugendlehre wendet sich Kant der Ethik als einer Lehre von Pflichten zu. Diese möchte er auf ihre „metaphysischen Anfangsgründe“ zurückführen und die Ethik als eine Lehre von allgemein verpflichtenden Zwecken, „von allem Empirischen (jedem Gefühl) gereinigt“[1] entwickeln. Die Metaphysik der Sitten führt somit die Untersuchungen der Kritik der praktischen Vernunft und der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten fort. Als „Kritik“ versteht Kant nicht Skepsis oder Anfechtung, sondern eine sorgfältige Prüfung durch die Vernunft. Zunächst hatte er den Begriff der reinen, später den der (reinen) praktischen Vernunft, kritisch untersucht, mit dem Ziel, legitime von illegitimen Zuschreibungen zu trennen. Die Leitfrage lautete dabei ‚was vermögen reine und reine praktische Vernunft, und was vermögen sie nicht?’. Es ging also um eine Schärfung der Begriffe durch Begrenzung. Die Kritiken sind grundlegende Schriften, die die Voraussetzung für die Epistemologie und die Ethik liefern sollten. Die Metaphysik stellt im Anschluss an sie die eigentliche philosophische Untersuchung dar. Sie ist konzipiert als ein System aufbauend auf „reinen, von aller Anschauungsbedingung unabhängigen Vernunftbegriffen“[2]. Sowohl die Grundlegung, als auch die Kritik der praktischen Vernunft stellen also wichtige Grundlegungsschriften zur Moralphilosophie Kants dar. Diese ist eine Gesinnungsethik, die das Augenmerk auf die Art und Weise der inneren Zwecksetzung und ihre Übereinstimmung mit einer objektiven Pflicht hat.
In der Vorrede zur Tugendlehre weist Kant die Idee einer eudaimonistischen Ethik von sich. Solche Glückseligkeitsethiken, als deren Hauptvertreter Aristoteles gilt, haben zum Gegenstand das gute Leben, sowohl im moralischen Sinne als auch im Sinne eines Lebens in Annehmlichkeiten. Auch Kant spricht dem Menschen einen inhärenten Wunsch nach einem guten Leben zu. Dieser dürfe jedoch nicht zum Prinzip der Sittlichkeit erhoben werden:
Das Prinzip der Glückseligkeit … , kann wohl generelle, aber niemals universelle Regeln, d.i. solche, die im Durchschnitte am öftersten zutreffen, nicht aber solche, die jederzeit und notwendig gültig sein müssen, geben, mithin können keine praktischen Gesetze darauf gegründet werden[3].
Denn die Selbstliebe vermag nur, uns zu bestimmten Handlungen anzuraten, das moralische Gesetz hingegen verpflichte uns. Im Folgenden möchte ich auf den Zusammenhang zwischen dem Anspruch, den die Tugendpflichten erheben und dem inhärenten Wunsch nach Glückseligkeit näher eingehen. Kann es tugendhaftes Handeln geben, das gleichzeitig dem Streben nach einem guten Leben gerecht wird? Zu diesem Zweck werde ich zunächst auf einige Voraussetzungen, die in den Grundlegungsschriften für den Begriff des sittlichen Handelns geschaffen werden, eingehen. Anschließend möchte ich mich dem Unterschied zwischen der Rechts- und der Tugendlehre zuwenden, der primär in der Zwecksetzung des Subjekts liegt. Dies führt mich zu einer Untersuchung des Zweckbegriffs, insbesondere den der Zwecke, die zugleich Pflichten sind. In der Tugendlehre führt Kant derer zwei an: eigene Vollkommenheit und fremde Glückseligkeit. Abschließen möchte ich mit einer Diskussion der Glückseligkeit als inhärenten Zweck des Menschen. An einigen Stellen werde ich Kants Kritik an der evaluativen Ethik des Aristoteles aufgreifen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden herauszustellen und somit das Verständnis für Kants Begriffe zu schärfen.
2 „Das moralische Gesetz in mir…“
In der Grundlegung, die die Thematik der Metaphysik der Sitten vorbereitet und die Grundlagen für deren Untersuchung schafft, macht Kant es sich zur Aufgabe, das Prinzip für ein Sittengesetz und seine unbedingte Gültigkeit zu finden, also einen kategorischen Imperativ. Dabei setzt er den hypothetischen vom kategorischen Imperativ ab: der hypothetische Imperativ hat die Form einer „wenn,…dann“-Aussage, er bezieht sich demnach nur auf Handlungen, die nur als Mittel zu einem Zweck dienen[4]. Die Eignung als Mittel sagt jedoch nicht aus, ob der Zweck verallgemeinert werden kann. Der kategorische Imperativ hingegen gründet nicht auf einer solchen Mittel-Zweck-Relation, sondern schreibt Handlungen einem Zweck zu, der objektiv notwendig ist. Er enthält keine konkreten Handlungsanweisungen, sondern bestimmt den Willen durch seine bloße Form. Kant verwendet mehrere unterschiedliche Formulierungen, sie alle entsprechen jedoch der Formel: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“[5]. Moralische Bewertung soll niemals situativ erfolgen, sondern nur anhand dieser Grundformel:
Man tut aber besser, wenn man in der sittlichen Beurteilung immer nach der strengen Methode verfährt, und die allgemeine Formel des kategorischen Imperativs zum Grunde legt.[6]
Die Lehre von moralischen Grundbegriffen wird demnach identifiziert mit der Such nach der Form des kategorischen Imperativs und der Festlegung seiner unbedingten Gültigkeit. Dieses Sittengesetz habe apriorischen Status, seine Verbindlichkeit liege nicht „in der Natur des Menschen, oder den Umständen der Welt, […] sondern a priori […] in Begriffen der reinen Vernunft“[7]. Demnach sei jeder Mensch in der Lage, dieses Gesetz aus sich selbst heraus zu erkennen und seine Handlungen danach auszurichten.
2.1 Natürliche Dialektik
Die menschliche Natur enthält jedoch mehr als die Fähigkeit, allgemeine Gesetze der Vernunft zu erkennen. Als „natürliche Dialektik“ bezeichnet Kant den jedem Menschen innewohnenden „Hang, wider jene strenge Gesetze der Pflicht zu vernünfteln, und ihre Gültigkeit, wenigstens ihre Reinigkeit und Strenge in Zweifel zu ziehen und sie, wo möglich, unsern Wünschen und Neigungen angemessener zu machen“[8].
Der Mensch sei ein animal rationale, habe sozusagen Teil an zwei verschiedenen Welten: einerseits an der Natur und der damit verbundenen Sinnlichkeit, andererseits an der Sphäre reiner Vernunft. Er sei, im Gegensatz zum Tier, ein Wesen, das durch die Sinne zwar affiziert, aber nicht determiniert ist.
Damit lehnt Kant den Freiheitsbegriff nach Aristoteles ab, denn dieser versteht darunter die Fähigkeit zum klugen Wählen und zum zweckmäßigen Handeln. Freie Handlungen sind diejenigen, deren Prinzip in dem Handelnden ist „und zwar so, dass er auch die einzelnen Umstände der Handlung kennt“[9]. Das bedeutet, dass richtiges Handeln situationsabhängig ist, denn es laufe darauf hinaus, zur richtigen Zeit die richtigen Affekte zu haben.
Kants Prinzip der Freiheit des Willens besteht in der Möglichkeit, diesen vom Begehrungsvermögen unabhängig bilden zu können. Das Begehrungsvermögen richte sich auf Zustände oder Tätigkeiten, deren Wirklichkeit begehrt wird, weil ihr Erreichen Lust verspricht. Dazu zählt Kant ausdrücklich auch „geistige Freuden, die intellektuellen, kreativen oder sozialen Tätigkeiten entspringen“[10]. Es gibt bei Kant also kein „besseres“ oder „schlechteres“ Begehren im Sinne von höheren und niederen Freuden, denn man ist in beiden Fällen von der Annehmlichkeit bestimmt, die man aus dem entsprechenden Tun erwartet. Moralisches Handeln aber müsse als von sinnlichen Gegenständen getrennt gedacht werden: „In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehrten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muss, besteht das alleinige Prinzip der Sittlichkeit“[11].
Das heißt dass auch die Freiheit selbst nicht aus Erfahrung bestimmt werden kann. Der Begriff der Freiheit ist ein Produkt der Spontaneität des Subjekts, das aus sich selbst heraus tätig wird, um sich von der Naturkausalität, also einer Determination von außen, zu lösen und eine selbstverursachte Kausalität herbeizuführen. Das, was ich aus freiem Willen tue, muss seinen Ursprung in mir allein haben.
Diese Unabhängigkeit ist die negative Definition der Freiheit, ihre positive Benennung sei die Gesetzgebung der reinen praktischen Vernunft. Die Vernunft drückt jedoch durch den kategorischen Imperativ eine Pflicht aus, insofern ist freies Handeln immer auch ein Handeln aus Pflicht[12].
2.2 Maximen, Gesetze und Regeln
Kant geht also davon aus, dass vernünftige Wesen nur aus Vernunftgründen heraus aktiv werden sollen. Unser Handeln ist demnach nicht zufällig oder ungeordnet, sondern vorsätzlich, zweckgemäß und von Maximen geleitet[13]. Maximen sind subjektive Grundsätze an denen wir unser Handeln ausrichten. In der Regel verfolgen sie materiale Zwecke, als Beispiele kann man etwa das Verlangen nach Selbsterhaltung oder das Streben nach Glückseligkeit anführen. Sie sind Regeln, die keinen Allgemeinheitsanspruch hegen, sondern die unser Verhalten in einander vergleichbaren Sachlagen bestimmen. Damit sind sie deutlich vom objektiven Prinzip des praktischen Gesetzes unterschieden. Dieses legt die Grundsätze fest, die sich ein Individuum zueigen machen soll. Dieses „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“, der kategorische Imperativ, drückt die Forderung aus, dass nach denjenigen Maximen gehandelt werden soll, die sich verallgemeinern lassen. Nur dann erfüllt eine Handlung den moralischen Anspruch des Sittengesetzes, von der reinen Vernunft bestimmt, und nicht von der Natur „pathologisch-affiziert“[14], zu sein.
Die Unterscheidung zwischen Regel und Gesetz fasst Rüdiger Bubner unter dem Gesichtspunkt zusammen, das Regeln dazu dienen, Gleichförmigkeit (unter gegebenen Vorzeichen, etwa in einander ähnlichen Situationen) herzustellen, wohingegen das Gesetz eine Gleichheit hinsichtlich der Handlungsebenen herbeiführen soll[15]. So könne ein und das selbe Gesetz durch unterschiedliche Maximen erfüllt werden, da es sich unabhängig von deren subjektiven Handlungsmotivationen konstituiert.
Ob ein subjektiver Grundsatz der Forderung des kategorischen Imperativs, zugleich als allgemeines Gesetz gelten zu können, erfüllen kann, lässt sich erst beurteilen, nachdem er der Prüfung durch die Vernunft unterzogen wurde.
Deine Handlungen musst du […] zuerst nach ihrem subjektiven Grundsatze betrachten: ob aber dieser Grundsatz auch objektiv gültig sei, kannst du nur daran erkennen, dass, weil deine Vernunft ihn der Probe unterwirft, durch denselben dich zugleich als allgemein gesetzgebend zu denken, er sich zu einer solchen allgemeinen Gesetzgebung qualifiziert.[16]
Das Kriterium für die Sittlichkeit einer Handlung ist demnach, ob die dem Willen zugrunde liegende Maxime der Prüfung durch den kategorischen Imperativ standhält. Der moralische Wert einer Handlung aus Pflicht hängt also „bloß von dem Prinzip des Wollens, nach welchem die Handlung, unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens, geschehen ist“[17], ab.
Die Grundlegung zur Metaphysik gibt jedoch nur eine rein formale Darstellung des Sittengesetzes, unbeantwortet bleibt die Frage, wie diese ‚Blaupause’ eines Gesetzes mit konkreten Inhalten gefüllt werden kann. Unbeantwortet bleibt zunächst, wie eine Maxime im Einzelnen aussehen muss, damit sie dem moralischen Anspruch des kategorischen Imperativ genügt, und welche Handlungszwecke mit ihm vereinbar sind. Diese Fragen greift er in der Tugendlehre auf, in der er konkrete Pflichten der Tugend inhaltlich benennt und die entscheidende Rolle der Gesinnung für tugendhaftes Handeln untersucht.
3 Rechtslehre und Tugendlehre
Aristoteles unterscheidet nicht zwischen rechtskonformem und ethischem Handeln, im Rahmen der Polis wurden sie weitgehend miteinander identifiziert. Kant hingegen stellt der Rechtslehre, deren Ziel es ist, eine Freiheitsordnung der Öffentlichkeit zu schaffen – d.h. den Freiheitsraum jedes Einzelnen festzulegen und ihn zu garantieren – die Tugendlehre entgegen. Diese soll die in den Grundlegungsschriften begonnenen Untersuchungen über die Voraussetzungen sittlichen Handelns fortführen und Richtlinien für eine praktische Umsetzung vorgeben.
Die Rechtslehre soll individuelle Freiheit gegen die Willkür Anderer absichern. Damit ein Zusammenleben garantiert werden kann, müssen die Handlungsmöglichkeiten jedes Mitglieds der Gesellschaft eingeschränkt werden, analog zu Hobbes’ Gesellschaftsvertrag, in dem jeder sein Recht auf alles abgibt[18]. Auch Kants Rechtslehre basiert auf einem solchen verallgemeinerungsfähigen Kompromiss. Die Grenze der Willkür jedes Einzelnen soll der Freiheitsraum des Anderen bilden: „Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann“[19].
Die Rechtslehre schaut auf die äußeren Handlungen, und inwiefern sie die Rechte des Anderen achten oder verletzen, sie schaut jedoch nicht auf die Triebfeder der Handlungen. Diese kann sowohl eine äußere als auch eine innere sein. Der Gesetzgeber übt einen äußeren Zwang aus, indem er demjenigen, der Gesetze bricht, mit Sanktionen droht. Eine Handlung, deren Vorsatz in dieser Nötigung von außen liegt, und die bloß auf Gesetzeskonformität zielt, ist eine Handlung aus Legalität. Sie wird pflichtgemäß vollzogen. Einem Menschen in einer Notlage zu helfen, beispielsweise, wird in jedem Fall als gut und richtig bewertet, unabhängig von den Motiven des Helfers. Kant stellt jedoch die Frage, ob es nicht verdienstlicher und besser sei, wenn die Hilfeleistung aus einer moralischen Verpflichtung zu helfen geschieht, anstatt aus Furcht vor möglicher Strafe bei Unterlassung. Denn in einem solchen Falle entscheide ich mich, alleine die Pflicht, die das Sittengesetz mir auferlegt, meiner Willensbildung zugrunde zu legen. Was Pflicht sei, so Kant, „bietet sich jedermann von selbst dar“[20], denn sie wird uns vom Gesetz der Sittlichkeit auferlegt. Wir haben demnach gewisse Pflichten in uns, die aller Erfahrung vorausgehen. Insofern ist Handeln aus Pflicht situationsunabhängiges, freies Handeln. Kants Verständnis der Ethik lässt keine Sittlichkeit ohne Nötigung zu; Tugend wird als Pflichtbefolgung Hindernissen zum Trotz verstanden. Im Falle der Tugendlehre ist es ein Selbstzwang, den wir uns auferlegen müssen:
Da […] der Mensch doch ein freies (moralisches) Wesen ist, so kann der Pflichtbegriff keinen anderen als den Selbstzwang […] enthalten, wenn es auf die innere Willensbestimmung […] angesehen ist, denn dadurch allein wird es möglich, jene Nötigung (selbst wenn sie eine äußere wäre) mit der Freiheit der Willkür zu vereinigen, wobei aber alsdann der Pflichtbegriff ein ethischer sein wird.[21]
Die rechtliche Gesetzgebung schaut nicht auf die Maximen die Handlungen zugrunde liegen, da es nicht ihre Bestimmung ist, Sittlichkeit einzufordern. Ihr Zweck liegt lediglich darin, durch äußeren Zwang die äußere Freiheit, also das Recht des Menschen zu garantieren.
Tugendhaft hingegen sind in Kants Sinne deshalb nur Handlungen aus Moralität, bei denen ich mir die Pflichterfüllung selbst zur Maxime mache. Ausschlaggebend für die moralische Bewertung meiner Handlung ist also nicht die Tat selbst im Rahmen ihrer Umstände, sondern die Kompatibilität meiner Maxime mit dem kategorischen Imperativ. Das Gesetz selbst soll letzten Endes der Bestimmungsgrund allen Handelns sein.
Rechts- und Tugendlehre sind jedoch keine unabhängigen, von einander getrennten Gebilde. Wolfgang Kerstin schreibt, jede Rechtspflicht sei
immer auch eine indirekt-ethische Pflicht; der jeder Pflicht a priori zukommende ethische Verpflichtungsmodus wird für die Klasse der Rechtspflichten nicht darum außer Kraft gesetzt, weil sie auf juridische Weise gegeben werden können und daher eine heteronome Pflichterfüllung für sie moralisch zulässig ist.[22]
Nicht jedes Vernunftgesetz könne demnach juridisch durch Zwang eingefordert werden, wohl aber ethisch, indem ich es mir selbst zum Bestimmungsgrund meines Willens mache. Die rechtliche Gesetzgebung urteilt nur über meine Handlungen, basiert also auf dem Prinzip der Fremdverpflichtung, das ethische Gesetz hingegen über den inneren Bereich meiner eigenen „Zwecksetzung und Maximenbildung“[23] und setzte somit eine Selbstverpflichtung voraus.
4 Zwecke und Selbstzwecke
Kant zufolge ist das Wollen eines vernünftigen Wesens stets auf Zwecke gerichtet. Ein Zweck wird gemeinhin als Gegenstand einer Handlung verstanden, dessen Setzung den Willen für diese bestimmte Handlung hervorbringt. In der Grundlegung führt Kant den Zweckbegriff folgendermaßen ein:
Nun ist das, was dem Willen zum objektiven Grunde seiner Selbstbestimmung dient, der Zweck, und dieser, wenn er durch bloße Vernunft gegeben wird, muss für alle vernünftige Wesen gleich gelten. Was dagegen bloß den Grund der Möglichkeit der Handlung enthält, deren Wirkung Zweck ist, heißt das Mittel. Der subjektive Grund des Begehrens ist die Triebfeder, der objektive des Wollens der Bewegungsgrund; daher der Unterschied zwischen subjektiven Zwecken, die auf Triebfedern beruhen, und objektiven, die auf Bewegungsgründe ankommen, welche für jedes vernünftige Wesen gelten.[24]
Durch die Fähigkeit, sich selbst Zwecke zu setzen, unterscheide sich, so Kant, die vernünftige Natur von der unvernünftigen[25]. Der Mensch könne sich, im Gegensatz zum Tier, seine Ziele selbst abstecken und teleologisch handeln, während die unvernünftige Natur eine reine Kausalkette von Ursache und Wirkung abspule. Zweckmäßiges Handeln ist demzufolge reflektierendes Handeln „nach Prinzipien“[26], wenngleich nicht zwingend durch reine Vernunft bestimmtes Handeln.
4.1 Zwei Zwecklehren
Kant unterscheidet zwischen zwei Zwecklehren. Auf der einen Seite die Zwecklehre, die jene Ziele beinhaltet, die auf Affekten beruhen und sinnlich motiviert sind. Die Wahl der Ziele beruht hier auf einem klugen Abwägen, das sich auf Erfahrungswerte stützt. Die Zwecke die aus dieser Wahl hervorgehen sind also subjektiv, weil situationsbedingt und affektiv. Kant nennt diese Zwecklehre daher „technisch“ oder „pragmatisch“[27] ; die aus ihr zugehörigen Ziele nennt er relative Zwecke. Jene aber, die wir uns unabhängig von Erfahrungsdaten geben, heißen objektive Zwecke.
Neben frei gewählten Zwecken existieren jedoch offenbar auch Zwecke, die schon vor jeder Willenswahl existieren und nicht von Menschen gesetzt werden. So stützt sich der praktische Imperativ — „handle so, dass du die Menschheit [...] jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest“[28] — auf die Annahme, dass vernünftige Wesen Zweck an sich selbst seien, denn: „Ein Ding in der Natur ist ein Mittel des andern, daher muss zuletzt ein Ding sein, das kein Mittel mehr, sondern Zweck an sich selbst ist“[29].
Ausschlaggebend für die Eigenschaft, Zweck an sich zu sein, sind die Eigenschaften, Vernunft zu haben und über einen freien Willen zu verfügen. Vernunft benötigen wir, weil sie uns ein Bewusstsein des eigenen Daseins und der Sittlichkeit vermittelt. Die reine Vernunft kann jedoch immer nur einen Handlungsrahmen bieten (wie in der Form des kategorischen Imperativs), nie aber konkrete Handlungsanweisungen liefern, d.h. wir wählen unsere Zwecke der Vernunft entsprechend, aber die Mittel und Wege kann sie uns nicht geben. Vernunft ist also ein Mittel, während die Freiheit eigentlich ausschlaggebend ist für die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen. Denn sie ermöglicht es, sich von der Naturnotwendigkeit zu lösen und eine eigene (selbstverursachte), zielgerichtete Kausalität in Gang zu setzen[30]. Der praktische Imperativ verknüpfe deshalb alle Vernunftwesen zu einem „Reich der Zwecke“[31]. Als Reich bezeichnet Kant die wechselseitige Verknüpfung vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Regeln. Man trete in das Reich der Zwecke ein, indem man die innere Vernunftgesetzgebung, und damit den praktischen Imperativ, annehme und alle Handlungen an diesem ausrichte.
Wie aber wird die Annahme, dass Menschen ein Zweck-an-sich seien, genau begründet? Kant hält fest, dies lasse sich nicht der Erfahrung entlehnen,
erstlich, wegen seiner Allgemeinheit, da es auf alle vernünftige Wesen überhaupt geht, worüber etwas zu bestimmen keine Erfahrung zureicht; zweitens, weil darin die Menschheit nicht als Zweck der Menschen […], d.i. als Gegenstand, den man sich von selbst wirklich zum Zwecke macht, sondern als objektiver Zweck, der, […], als Gesetz die oberste einschränkende Bedingung aller subjektiven Zwecke ausmachen soll, vorgestellt wird, mithin aus reiner Vernunft entspringen muss.[32]
Im folgenden Abschnitt möchte ich näher beleuchten, wie Kant die Ableitung einer inhärenten Zweckhaftigkeit des Menschen a priori vornimmt.
4.2 Der Begriff des Zweckes, der zugleich Pflicht ist
Das moralische Gesetz gebietet in seiner praktischen Anwendung die Zwecke der sittlichen Selbstvervollkommnung und der Förderung fremder Glückseligkeit. Kant hatte letzteren zwar schon in der Kritik der praktischen Vernunft eingeführt[33], insgesamt stellt jedoch die Darstellung dieser zwei Tugendpflichten in der Metaphysik eine Konkretisierung dar, die über die rein formalen Benennungen der vorbereitenden Schriften der Grundlegung und der Kritik der praktischen Vernunft hinausgehen.
Die „moralische“ Zwecklehre, im Gegensatz zur „technischen“ beinhaltet Ziele, die uns von der reinen praktischen Vernunft vermittelt, aber nicht von ihr gesetzt werden, denn sie bestehen als Zwecke-an-sich schon vor der reinen Vernunft. Daher seien diese sowohl Zweck als auch Pflicht. Sie seien „Gegenstände der freien Willkür“, also durch einen autonomen, situationsunabhängigen Willen motiviert, und deshalb objektiv[34]. Die Existenz solcher Pflichten müssen wir annehmen,
denn gäbe es keine dergleichen, so würden, weil doch keine Handlung zwecklos sein kann, alle Zwecke für die praktische Vernunft immer nur als Mittel zu anderen Zwecken gelten und ein kategorischer Imperativ wäre unmöglich; welches alle Sittenlehre aufhebt.[35]
Freiheit wird als zwecksetzend, nicht nur Mittel wählend verstanden, die reine praktische Vernunft definiert Kant als Vermögen der Zwecke überhaupt[36]. Schmucker spricht in diesem Zusammenhang von einer wichtigen Ergänzung der Grundlegungsschriften durch die Tugendlehre, denn das oberste Prinzip der Ethik rücke in seiner allgemeinen Form in den Bereich der Grundprinzipien des reinen Willens auf, wobei dessen nähere Bestimmung immer nur durch die spezifische Natur des betreffenden Vernunftwesens erfolgen könne[37]. Das bedeutet, dass Freiheit explizit mit dem Vermögen zur Zwecksetzung identifiziert werde, was wiederum die Notwendigkeit materialer Zwecke einschließe:
auf das Prinzip des selbständigen Zwecks der Person als negative einschränkende Bedingung der Maxime und auf die in der Einleitung zur Tugendlehre entwickelten positiven materialen ( = zu bewirkenden) Zwecke der eigenen Vervollkommenheit und der fremden Glückseligkeit lässt sich in der Tat das ganze in der Metaphysik der Sitten entwickelte System seiner inhaltlichen Tugendlehre zurückführen.[38]
Die Tugendlehre, basierend auf Zwecken, die zugleich Pflicht sind, fordert also das Befolgen von Handlungsstrukturen, denen eine ethische Gesinnung als ausschließlicher Beweggrund zu Grunde liegt. Diese Handlungsstrukturen beruhen auf den Tugendpflichten der eigenen Vollkommenheit und der Glückseligkeit des Anderen, welche, so Kant, als Zwecke schon a priori vor jeder moralischen Gesetzgebung bestehen. Sie sind für deren praktische Realisierung unentbehrlich und daher notwendige Zwecke, die sich jeder Mensch zueigen machen müsse.
4.3 Eigene Vollkommenheit
Wenn Kant von Vollkommenheit als einer Tugendpflicht spricht, meint er Vervollkommnung im sittlichen Sinne. Denn jede materiale Verbesserung, wie etwa Wohlstand, Ansehen, Macht und dergleichen, wären empirisch affizierte Beweggründe, welche nicht zur Verallgemeinerung taugen. Vielmehr gehe es darum,
sich aus der Rohigkeit seiner Natur, aus der Tierheit […], immer mehr zur Menschheit, durch die er allein fähig ist, sich Zwecke zu setzen, empor zu arbeiten: seine Unwissenheit durch Belehrung zu ergänzen und seine Irrtümer zu verbessern, und dieses ist ihm nicht bloß die technisch-praktische Vernunft zu seinen anderweitigen Absichten (der Kunst) anrätig, sondern die moralisch-praktische gebietet es ihm schlechthin und macht diesen Zweck ihm zur Pflicht, um der Menschheit, die in ihm wohnt, würdig zu sein.
Wenn ich mir sittliche Vollkommenheit zum Zwecke mache, handle ich dem praktischen Imperativ gemäß, denn mein Zweck beinhaltet damit auch die Förderung menschlicher Kultur überhaupt. Kultur bedeutet, das Essentielle, das den Menschen ausmacht und ihn vom Rest der Schöpfung abhebt – nämlich die Fähigkeit zur Zwecksetzung – zu bewahren und zur vollen Entfaltung zu bringen. Denn wenn ich sittlich handle, also nicht sinnlich-affiziert, mache ich mir meine eigene „Bestheit“ zum Zwe name="_ftnref39" title="">[39]. Erst die fortschreitende Kultivierung im sittlichen Sinne, die ihn Schritt für Schritt aus der „Rohigkeit der Natur“ und ihrer Kausalität löst, ist als das der Welt immanente Telos zu sehen[40].
4.4 Fremde Glückseligkeit
Im Hinblick auf die Glückseligkeit hält Kant fest, dass es immer nur die Wohlfahrt des Anderen sein kann, die meinen Willen bestimmen soll. Meine eigene Glückseligkeit darf ich mir nicht zum Zweck machen, denn sie ist Gegenstand meines Begehrungsvermögens, das auf subjektive, materiale Zwecke zielt, sie kann daher kein tugendhaftes Handeln hervorbringen. Darüber hinaus könne nichts als Pflicht aufgefasst werden, was „was jeder unvermeidlich schon von selbst will, […]; denn diese ist eine Nötigung zu einem ungern genommenen Zweck“[41].
Daraus folgt jedoch dass fremde Glückseligkeit das Objekt des Willens eines vernünftigen Wesens sein kann, weil wir das Streben nach eigener Glückseligkeit bei jedem endlichen Wesen voraussetzen können (Kant nimmt überirdische Vernunftwesen wie Engel oder Gott explizit davon aus[42] ): „[Glückseligkeit], wenn ich sie jedem beilege (wie ich es in der Tat bei endlichen Wesen tun darf), kann nur alsdenn ein objektives praktisches Gesetz werden, wenn ich anderer ihre in dieselbe mit einschließe“[43]. Allerdings darf nicht die Wohlfahrt des Einen oder Anderen an sich zum Bestimmungsgrund unseres Willens gemacht werden. Allein die Möglichkeit, dass die Maxime „verhelfe Anderen zur Glückseligkeit!“ sich verallgemeinern lässt, „um ihr die Allgemeinheit eines Gesetzes zu verschaffen, und sie so der reinen praktischen Vernunft angemessen zu machen“, erhebt sie zur Tugendpflicht.
Wenn sich unser Wille diese Pflicht zueigen macht, dient ihm der Wille des anderen Mensch als „Motivlieferant“. Wir können, so Kant uns nicht die Vollkommenheit des Anderen zum Zweck machen, da Sittlichkeit immer nur aus dem Subjekt selbst heraus verwirklicht werden kann. Fremde Glückseligkeit zu fördern heißt jedoch, den Anderen von „Widerwärtigkeiten, Schmerz und Mangel“ fernzuhalten, die allesamt „große Versuchungen zur Übertretung seiner Pflicht“[44] sind und ihn am sittlichen Handeln, und somit dem Streben nach der eigenen Vervollkommnung, behindern. Fremde Glückseligkeit und eigene Vollkommenheit sind in diesem Sinne miteinander verschränkt. Kant fasst zusammen, das ‚Du’ werde zum notwendigen Zweck, an dem sich die praktische Urteilskraft orientiert:
Damit manifestiert sich eine ‚affirmative’ […] Anerkennung des Anderen als Du, die so in den ‚praktischen Stand’ versetzt, (auch) sich als existierenden Endzweck der Schöpfung ansehen zu dürfen: ‚fremde Glückseligkeit’ ist so betrachtet zwar nicht einfach ‚Bestimmungsgrund des Willens’, sie bleibt aber insofern für das Praktisch-werden der Vernunft dennoch maß-gebend, weil je anderer Glückseligkeit mit der je eigenen Vollkommenheit und deren subjektiven Impetus verbunden ist.[45]
5 Glückseligkeit
In einem vorhergehenden Abschnitt habe ich festgehalten, dass der Mensch, das animal rationale, zwischen den zwei Welten des sinnlichen Begehrens und der Sphäre sittlichen Pflichten zu stehen scheint. Der Wunsch nach einem guten Leben, gleichsam ein Gebot seiner Natur, steht auf den ersten Blick dem moralischen Gebot nach affektunabhängiger Sittlichkeit diametral entgegen. In diesem Abschnitt möchte ich mich der Frage zuwenden, ob Kants Ethik nicht dennoch eine Synthese der beiden ‚Gebote’ ermöglicht.
5.1 Der „Widerspruch des Eudaimonisten“
In der Vorrede zur Tugendlehre der Metaphysik der Sitten greift Kant eudaimonistische Glückstheorien auf, um seine eigenes deontologische Konzept von ihnen abzusetzen. Ich möchte hier kurz darauf näher eingehen um Kants Position anhand von Aristoteles’ Verständnis der Eudaimonia zu umreißen.
In der Kritik der reinen Vernunft definiert Kant die Glückseligkeit als „die Befriedigung aller unserer Neigungen“[46] ; also weitgehend deckungsgleich mit Aristoteles’ Begriff. Diesem zufolge ist jede Handlung auf ein Gut gerichtet. Die Gesamtheit der menschlichen Handlungen richte sich jedoch auf ein Gut, das mehr ist als die Summe der einzelnen Zwecke; ein Gut, welches zwar durch die einzelnen Tätigkeiten bewirkt wird, aber mit keiner der einzelnen Handlungen identifiziert werden kann. Dieses oberste Ziel, das summum bonum, ist, laut Aristoteles, die Glückseligkeit.
Maximilian Forschner fasst das aristotelische Konzept folgendermaßen zusammen: „ Eudaimonia ist etwas Zusammengesetztes. Ein gelungenes menschliches Leben wird zu einem idealen nicht durch ein Element, das es enthält, sondern erfüllt eine Vielzahl von Kriterien und Desiderata“[47]. Diese sind äußere Güter einerseits und tugendhaftes Handeln andererseits. Im Einzelnen nennt Aristoteles die folgenden äußeren Güter: Freunde, die einem beistehen, Reichtum, Einfluss im Staat, ehrbare Herkunft, brave Kinder, sowie körperliche Schönheit. Wem es an einem der Teile mangele, könne nicht als vollendst glücklich gelten[48]. Aristoteles bringt auch hier einen starken common-sense -Aspekt ins Spiel: zunächst einmal machen demnach die Dinge glückselig, die wir unserer Erfahrung nach als angenehm und wünschenswert erachten. Dieser Rekurs auf das durch die Erfahrung Gegebene hat bei Aristoteles einen systematischen Stellenwert. In der Nikomachischen Ethik greift er mehrfach auf Beobachtungen und gültige Meinungen zurück, um zu Urteilen zu gelangen[49].
Auf diesem Wege gelangt er in der Nikomachischen Ethik zu einer Mehrzahl guter Lebensentwürfe, also einer Art Skala der Glückseligkeit[50]. Denn die Eudaimonia erschöpft sich natürlich nicht im Besitz äußerer Güter. Sie seien, so Aristoteles, vielmehr Mittel zum Zweck. Sie sollen Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen gewährleisten und dem Menschen auf diese Weise zu tugendhaftem Lebenswandel verhelfen. Das beste Leben führe derjenige, der den bios theoretikos lebt, sich also der Kontemplation und der Philosophie verschreibe. Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass, obwohl Aristoteles die Annehmlichkeiten des Lebens und äußere Güter nicht als letzten Zweck festhält, er auch betont dass ohne sie niemand wirklich glückselig sein könne.
Kant hingegen lehnt die Motivation durch Neigungen, welcher Art sie auch sein mögen ab: die eigene Glückseligkeit könne nicht sittliche Pflicht sein. Wenn ‚der Eudaimonist’ jedoch diese seiner Willensbildung zu Grunde legt, trete er in einen Zirkel:
Er kann nämlich nur hoffen, glücklich (oder innerlich selig) zu sein, wenn er sich seiner Pflichtbeobachtung bewusst ist; er kann aber zur Beobachtung seiner Pflicht nur bewogen werden, wenn er voraussieht, dass er sich dadurch glücklich machen werde.[51]
Daraus ergebe sich der Widerspruch, dass er nur das, was ihn der Glückseligkeit näher bringe als seine moralische Pflicht anerkennen könne; die Sittlichkeit erwarte jedoch gleichzeitig von ihm, uneigennützig zu handeln, ohne auf den Lohn zu blicken, der ihm dadurch erwächst. ‚Der Eudaimonist’ könne somit nie widerspruchsfrei zu moralischem Handeln motiviert werden[52].
Kants stellt der aristotelischen Glückseligkeitsethik die Forderung entgegen, allein das Sittengesetz solle unsere Handlungen bestimmen, obwohl die Glückseligkeit unserem Wollen stets als Zweck eingepflanzt ist.
5.2 Glückseligkeit als inhärenter Zweck
An dieser Stelle tut sich in der Metaphysik der Sitten ein Widerspruch auf in zwei zentralen Prämissen auf, die Kant in der Einleitung zur Tugendlehre anführt. In Abschnitt III hält er fest, niemand könne einen Zweck haben, „ohne sich den Gegenstand seiner Willkür selbst zum Zweck zu machen“, daher sei es ein „Akt der Freiheit, […] nicht eine Wirkung der Natur“[53]. Dies erscheint vollkommen unverträglich mit der im nächsten Abschnitt folgenden Annahme, eigene Glückseligkeit sei ein Zweck, den „alle Menschen (vermöge des Antriebs ihrer Natur) haben“[54]. Wie lässt sich die Behauptung, dass Zwecke stets an eine freie Willenswahl gebunden sind, mit der Idee vereinbaren, dass die menschliche Natur unvermeidbar, vor jeder Willensbildung, schon Ziele verfolgt?
Dieses Problem, das ausführlich und kontrovers in der Kant-Literatur diskutiert wird[55], kann ich hier nicht erschöpfend behandeln, und möchte mich daher auf die Frage beschränken, wie sich der „natürliche“ Zweck der Glückseligkeit mit den Tugendpflichten praktisch vereinbaren lässt.
Das Streben nach Glückseligkeit entspringt subjektiven Neigungen, unserem Begehrungsvermögen, und es verleitet dazu, Handlungen als Mittel zur Beförderung dieser einzusetzen. Wenn wir jedoch ethisch handeln wollen, dürfen wir den Wunsch nach Glückseligkeit nicht zum Bestimmungsgrund unseres Willens machen, da nur diejenigen Maximen dem Sittengesetz genügen können, deren Triebfedern vom Begehrungsvermögen vollkommen unabhängig sind. Eine andere Wahl wäre unfrei, denn alle einzelnen Aspekte, die die Glückseligkeit ausmachen, sind von der Erfahrung vermittelte Vorstellungen. Das gute Leben ist immer als ein gut-in-der-Welt-leben zu verstehen, und somit äußeren Bedingungen, und den Gefühlen und Affekten, die wir diesen Bedingungen entgegenbringen, unterworfen. So mögen wir, mit Aristoteles gesprochen, beispielsweise die Achtung, die uns Mitmenschen entgegenbringen als angenehm und daher als erstrebenswert empfinden. Mit Kant allerdings begeben wir uns damit in die Fremdbestimmung und Unfreiheit.
Diese Heteronomitätsfalle versucht Kant zu umgehen, indem er Glückseligkeit als einen diffusen Begriff darstellt. Das Streben nach ihr ist uns in die Wiege gelegt, allerdings ist sie nicht mehr als ein uneinheitliches Konzept, eine Idee, die keine tatsächliche Entsprechung hat[56]: sie sei „nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildungskraft“; sie beruhe auf bloß empirischen Gründen[57]. Der Begriff der Glückseligkeit ist leer weil er lediglich ein Sammelbegriff für die Vielzahl subjektiver Bestimmungsgründe ist.[58] Unter diesen Vorzeichen lässt sich der Widerspruch entschärfen, wenn nicht ausräumen: Wir können sittlich handeln, wenn die Glückseligkeit der Gegenstand unseres Begehrens ist, solange wir sie nicht zum Bestimmungsgrund unseres Willens machen.
Kant trennt in Bezug auf den Pflichtbegriff das „Verlangen“ von der „Würdigkeit“. In seiner Schrift „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ schreibt Kant, die Moral lehre nicht „wie wir glücklich, sondern der Glückseligkeit würdig werden können“.
Die Würdigkeit, glücklich zu sein, ist diejenige, auf dem selbst eigenen Willen des Subjekts beruhende Qualität einer Person, in Gemäßheit mit welcher eine allgemeine […] gesetzgebende Vernunft zu allen Zwecken dieser Person zusammenstimmen würde. Sie ist also von der Geschicklichkeit, sich sein Glück zu erwerben, gänzlich unterschieden. Denn selbst dieser, und des Talents, welches ihm die Natur dazu verliehen hat, ist er nicht wert, wenn er einen Willen hat, der mit dem, welcher allein sich zu einer allgemeinen Gesetzgebung der Vernunft schickt, nicht zusammen stimmt, und darin nicht mit enthalten sein kann (d.i. welcher der Moralität widerstreitet).[59]
Wir dürfen also auf die Würdigkeit, glücklich zu sein, hinarbeiten – dies ist mit dem Sittengesetz konform – jedoch nicht die Glückseligkeit selbst anstreben. Ungelöst bleibt dabei jedoch das Problem, dass Kant ausdrücklich das Streben nach weltlicher Wohlfahrt als unvermeidbaren Zweck einräumt. Auch wenn dieser Zweck nur auf einen unbestimmten Begriff zielt und uns nicht im eigentlichen Sinne zu einer konkreten Willenswahl bewegt, folgt daraus, dass unsere frei gewählten Zwecke durch diesen Naturzweck mitbedingt sind.
Welchen Gewinn kann der Mensch nun aus einer rigiden moralischen Haltung schlagen, oder ist Tugend stets nur ihr eigener Lohn? Oder, anders gefragt, muss der Mensch eine grundsätzliche Entscheidung zwischen zwei einander widersprüchlichen Begriffen des Strebens nach Wohlfahrt und dem Streben nach Sittlichkeit treffen?
5.3 Das Verhältnis von Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit
Kants Moralphilosophie zielt auf die Vervollkommnung der Freiheit des Menschen, als einen notwendigen Zweck der uns durch die Vernunft vermittelt wird. Dabei grenzt er die Ausübung der freien Willenswahl als höchstem Ziel das die Vernunft gebietet, von dem Streben nach der Glückseligkeit, als einem Zweck den unsere Natur vorgibt, scharf ab. Der Anspruch auf Glückseligkeit kann nicht mit guter Gesinnung in Eins gedacht werden: das Sittengesetz fordert die Ablösung von der Natur, die Glückseligkeit hingegen ist von der Natur abhängig. Die Idee des guten Lebens ist im moralischen Gesetz nicht enthalten. Platon hatte noch das tugendhafte Leben mit der Glückseligkeit gleichgesetzt[60]. Kant jedoch betont wiederholt, dass moralisches Handeln in der Regel bedeutet, in den sauren Apfel zu beißen, da es unseren sinnlichen Neigungen zuwiderlaufen mag. Moralität ist über den Begriff der Pflicht definiert, welcher vom Menschen nur „wider Willen Verehrung“[61] erwerbe.
In der „Tugendlehre“ erwähnt Kant, die Pflicht bringe mit sich eine „ethische Belohnung“, eine „moralische Lust, die über bloße Zufriedenheit mit sich selbst (die bloß negativ sein kann) hinaus geht und von der man rühmt, dass die Tugend in diesem Bewusstsein ihr eigener Lohn sei“[62]. Diese „süße Verdienst“ des sittlichen Handelns ist jedoch nicht der Zweck, der der menschlichen Natur innewohnt und mag deswegen nicht mehr als ein schwacher Trost sein.
Kant lässt jedoch eine Entzweiung von intelligibler und empirisch erscheinender Welt durch die Sittlichkeit nicht zu. Auch wenn sich keine Kausalität von ethischem Handeln und Glückseligkeit weder empirisch noch a priori erkennen lasse, so müsse eine Verbindung postuliert werden:
Ein Glücksanspruch kann mit der guten Gesinnung nicht verbunden werden. Es höbe die Gesinnung auf. Aber eine zweite Ebene der Hoffnung kann nicht vom Menschen abgetrennt werden. Er müsst sonst einen heiligen Willen oder eine mystische Anschauung der Einheit von moralisch-intelligibler und empirisch-natürlicher Welt haben. Die Annahme einer solchen Einheit bildet ein notwendiges Postulat der praktischen Vernunft.[63]
Wenn eine höchste, nach moralischen Gesetzen gebietende, Vernunft als Verursacher der Natur angenommen wird, können wir hoffen (nicht wissen), dass eine moralische Haltung uns auf lange Sicht hin nicht schaden wird. Denn eine höhere Vernunft wird sich nicht der Tugendpflicht entziehen können, die Glückseligkeit anderer Vernunftwesen zu fördern: „Also ist das höchste Gut in der Welt nur möglich, so fern eine oberste [Ursache] der Natur angenommen wird, die eine der moralischen Gesinnung gemäße Kausalität hat“[64].
6 Schluss
Der „erhabene große Name“ der Pflicht, der „nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt“, sondern immer nur Unterwerfung verlange[65], bildet das Prinzip auf dem Kants Ethik aufbaut. Ohne Nötigung und einen gewissen Widerwillen sei kein sittliches Handeln denkbar. Aristoteles Lehre, welche sich an der Alltagspraxis orientiert und die Glückseligkeit als oberstes Ziel tugendhaften Handelns setzt, mag uns in dem Zusammenhang intuitiver und menschlicher erscheinen, als Kants leibfeindlicher Ansatz. Kant zeichnet eine Dichotomie von Geist und Körper, in welcher der Mensch potentiell frei ist, jedoch durch seine Körperlichkeit bedrängt wird. Er müsse sich, wenn er „Vollkommenheit“ anstreben wolle, über diese hinwegsetzen und sich in seiner Willensbildung von allem Begehren und allem Sinnlichen frei machen.
Man darf dabei jedoch nicht vergessen dass dies kein Ausdruck einer misanthropischen Einstellung Kants ist, im Gegenteil: Kant ist bestrebt, dem Menschen den Weg zur vollen Ausfaltung seiner Anlagen zu weisen. Gemeint sind in diesem Zusammenhang die Anlagen, die ihn im Gegensatz zur restlichen Schöpfung auszeichnen, also „menschlich“ machen. Der Wunsch nach Glückseligkeit führe in die Unfreiheit, die Determination durch unsere Natur. Wir sollen uns selbst und unsere Mitmenschen als Zweck an sich begreifen, und dieser Erkenntnis zufolge handeln. Der Antagonismus von intelligibler und sinnlicher Natur, der dem Menschen innewohnt, ist demnach als eine Chance zu begreifen. Durch die Besinnung auf das, was uns Menschen als Vernunftwesen zueigen ist, sollen wir uns von äußeren Zwängen befreien können.
Die Tugendlehre ist vom Aufklärungspathos durchdrungen; Kants Forderung „sapere aude!“ scheint hier hindurch: es obliege jedem Einzelnen, von seiner Vernunft Gebrauch zu machen und seine Beweggründe kritisch zu prüfen. Wir sind, nach Kant, keine Wesen die durch die Natur determiniert sind. Die Ablösung von der Naturkausalität, die die Voraussetzung zur freien Willensbildung darstellt, bedeutet den Ausschluss aller äußerer Einflüsse, auch dem Streben nach Glückseligkeit, das uns von Natur aus zueigen ist.
„Dem kategorischen Gebote der Sittlichkeit Genüge zu leisten, ist in jedes Gewalt zu aller Zeit, der empirisch-bedingten Vorschrift der Glückseligkeit nur selten, und bei weitem nicht, auch nur in Ansehung einer einzigen Absicht, für jedermann möglich“[66]. Aristoteles hatte mit seiner Glückseligkeitslehre eine Ethik nur für diejenigen entworfen, die ‚es sich leisten können’, also die Aristokratie, die reichen Bürger der Polis. Sklaven und banausische Arbeiter waren davon ausgenommen. Kant hingegen spricht mit seiner Tugendlehre jeden Menschen an: man könne sich nur etwas zum Zwecke machen, was zu verwirklichen in der eigenen Macht liegt[67], und das ist den uneingeschränkten Sollensanspruch der moralischen Gesetzgebung für die Willensbildung anzuerkennen und in die Praxis umzusetzen. Der Anspruch der Tugendlehre „handle pflichtgemäß, aus Pflicht“, geht über die Forderung der Rechtslehre „handle pflichtgemäß“ hinaus. Die Autonomie des Einzelnen wird dadurch aufgewertet, dass der Beweggrund meines Handelns, und dessen Übereinstimmung mit einem allgemeinen sittlichen Gesetz, zum moralischen Maßstab wird. Dieser liegt jedoch bei mir allein, er kann nicht zum Gegenstand der Verwaltung und der Behörden gemacht werden, kann nicht institutionalisiert oder verordnet werden.
7 Bibliographie
7.1 Primärtexte
Kant, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. Theorie-Werkausgabe. Bd. VIII. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt a.M., 1977.
-- ders. Kritik der praktischen Vernunft / Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Theorie-Werkausgabe. Bd VII. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt a.M., 1974.
-- ders. Kritik der reinen Vernunft. in Kants gesammelte Schriften. Bd 3. Berlin, 1910.
-- ders. „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ in: Theorie-Werkausgabe Bd. XI. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt a. M., 1977.
-- ders. Vorlesung zum Naturrecht in: Kants gesammelte Schriften. Bd. 27.
7.2 Sekundärtexte
Aristoteles. Nikomachische Ethik. 7. Aufl. Berlin, 1979.
Bubner, Rüdiger. Handlung, Sprache und Vernunft: Grundbegriffe praktischer Philosophie. Frankfurt a.M., 1982.
Forschner, Maximilian. Über das Glück des Menschen. Darmstadt, 1993.
Hobbes, Thomas. Leviathan. 6. Aufl. Frankfurt a.M., 1994.
Höffe, Otfried. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar. Frankfurt a.M., 1989.
Irrlitz, Gerd. Kant Handbuch: Leben und Werk. Stuttgart, 2002
Johnson, Robert N. „Happiness as a Natural End“ in: Kant’s Metaphysics of Morals: Interpretive Essays. Hrsg. von Mark Timmons. Oxford, 2002.
Langthaler, Rudolf. Kants Ethik als „System der Zwecke“. Berlin, New York, 1991.
Schmucker, Josef. „Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants“ in Kant: Analysen – Probleme – Kritik. Bd. III. Hrsg. von Hariolf Oberer. Würzburg, 1997.
7.3 Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] MDS, 503.
[2] ebd.
[3] KPV, 148.
[4] Ein einfaches Beispiel wäre: „Wenn du gesund bleiben willst, dann tue …“.
[5] KPV, 140.
[6] GMS, 70.
[7] GMS, 13.
[8] GMS, 37.
[9] EN, 1111a.
[10] Höffe, Otfried. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar. Frankfurt a.M., 1989: 197.
[11] KPV, 144 A 59.
[12] Höffe, a.a.O., 199: „der Begriff der transzendentalen Freiheit, die Unabhgängigkeit von aller Natur, entpuppt sich in der Ethik als die praktische (moralische) Freiheit, als die Selbstbestimmung. Der von aller Kausalität und Fremdbestimmung freie Wille gibt sich selbst sein Gesetz. Folglich liegt das Prinzip aller moralischen Gesetze in der Autonomie, der Selbstgesetzlichkeit des Willens.“
[13] Forschner erwähnt dass Kant in seinen Reflexionen hervorhebt, der Mensch müsse „seine Zielsetzungen unter einheitsstiftende Grundsätze stellen, um sich selbst eine Identität als freies Wesen zu geben“. Der Mensch tendiere zu Handlungen nach Regeln und Grundsätzen, denn wer ohne sie handle, bleibe zerrissen und schwankend, bilde keine einheitliche Persönlichkeit (Forschner, Maximilian. Über das Glück des Menschen. Darmstadt, 1993: 114f).
[14] KPV, 125.
[15] Vgl. Bubner, Rüdiger. Handlung, Sprache und Vernunft: Grundbegriffe praktischer Philosophie. Frankfurt a.M., 1982: 181.
[16] MDS, 331.
[17] GMS, 26.
[18] Hobbes, Thomas. Leviathan, 100 et passim.
[19] MDS, 337.
[20] KPV, 149.
[21] MDS, 509.
[22] Kersting, Wolfgang. Wohlgeordnete Freiheit: Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie. Frankfurt a.M., 1993: 176.
[23] Kersting, a.a.O., 193.
[24] GMS, 59.
[25] Vgl. GMS.
[26] Vgl. KPV, 176.
[27] Vgl. MDS, 515.
[28] GMS, 61.
[29] Kant, Immanuel. Vorlesung zum Naturrecht in: Kants gesammelte Schriften. Bd. 27: 1321.
[30] Ebd., 1322.
[31] GMS, 74.
[32] GMS, 63 .
[33] Vgl. KPV §8, Anmerkung II.
[34] GMS, 74.
[35] MDS, 514f A 12.
[36] Vgl. Schmucker, Josef. „Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants“ in Kant: Analysen – Probleme – Kritik. Bd. III. Hrsg. von Hariolf Oberer. Würzburg, 1997: 149.
[37] Ebd., 149f.
[38] Ebd., 186.
[39] Vgl. Langthaler, Rudolf. Kants Ethik als „System der Zwecke“. Berlin, New York, 1991: 3f.
[40] Ebd., 5.
[41] MDS, 515.
[42] Vgl. KPV 145 A 60: „Aber dieses Bedürfnis [nach Glückseligkeit] kann ich nicht bei jedem vernünftigen (bei Gott gar nicht) Wesen voraussetzen.“
[43] KPV, 146, meine Hervorhebung.
[44] MDS 518.
[45] Langthaler, a.a.O., 183.
[46] KRV, B 834.
[47] Forschner, a.a.O., 7.
[48] Vgl. EN, 1099b1-8.
[49] Vgl. z.B. EN, 1098: „Die Prinzipien selbst aber werden teils durch Induktion erkannt, teils durch Wahrnehmung, teils durch eine Art Gewöhnung, teils auf noch andere Weise.“; und ebd.: „Wir müssen dasselbe jedoch nicht nur auf Grund der Schlussfolgerung und der begrifflichen Voraussetzungen zu ermitteln suchen, sondern ebenso auf Grund der darüber herrschenden Ansichten. Mit der Wahrheit stimmen alle Tatsachen überein, mit dem Irrtum aber gerät die Wahrheit bald in Zwiespalt“ (meine Hervorhebung).
[50] Dazu gehört das Leben, das von sinnlichen Freuden geprägt ist, das Leben, welches im politischen Engagement aufgeht und sich durch weises und kluges Handeln in der Gesellschaft der Polis auszeichnet, und schließlich das Leben des Philosophen das die kontemplativen Theorie zum Ideal erhebt.
[51] MDS, 506.
[52] Vgl. ebd.
[53] MDS, 514.
[54] MDS, 515.
[55] Siehe bspw. die Zusammenfassung von Johnson in Johnson, Robert N. „Happiness as a Natural End“ in: Kant’s Metaphysics of Morals: Interpretive Essays. Hrsg. von Mark Timmons. Oxford, 2002.
[56] Sie sei „der Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es, im Ganzen seiner Existenz, alles nach Wunsch und Willen geht“ (KPV, 255), also eine Idealvorstellung, die in der Welt wie sie sich uns darbietet, nie erreicht werden kann.
[57] GMS.
[58] Vgl. Johnson, a.a.O., 329.
[59] Kant, Immanuel. „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ in: Kant, Immanuel. Werkasugabe Bd. XI. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt a. M., 1977: 131.
[60] Vgl. Politeia, 354a: „Der Gerechte ist also glücklich, der Ungerechte aber nicht“.
[61] KPV 209.
[62] MDS 521.
[63] Irrlitz, Gerd. Kant Handbuch: Leben und Werk. Stuttgart, 2002: 336f.
[64] KPV, 256.
[65] Ebd., 209.
[66] Ebd., 149.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Language Preview?
Diese Language Preview enthält das Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Zusammenfassungen der Kapitel, Schlüsselwörter und Hauptthemen des vollständigen Textes. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Konzepte und Argumente, die im Text behandelt werden.
Was ist das Hauptthema des Textes?
Das Hauptthema ist die Tugendlehre bei Kant, insbesondere in Bezug auf die "Metaphysik der Sitten". Der Text untersucht Kants Auseinandersetzung mit Ethik, Pflichten, Zwecken und Glückseligkeit. Er vergleicht Kants Ansatz auch mit dem von Aristoteles.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Rechtslehre und Tugendlehre nach Kant?
Die Rechtslehre befasst sich mit äußeren Handlungen und der Gewährleistung der Freiheit jedes Einzelnen durch Gesetze und potenziellen Zwang. Sie betrachtet, ob Handlungen die Rechte anderer verletzen oder achten. Die Tugendlehre hingegen konzentriert sich auf die innere Einstellung und die moralischen Maximen, die den Handlungen zugrunde liegen. Es geht darum, sich selbst zur Pflichterfüllung zu verpflichten.
Welche Rolle spielt der kategorische Imperativ in Kants Ethik?
Der kategorische Imperativ ist das grundlegende Prinzip der Sittlichkeit bei Kant. Er besagt, dass man nur nach der Maxime handeln soll, von der man wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Er dient als Test für die moralische Zulässigkeit von Handlungen.
Was versteht Kant unter „Zwecken, die zugleich Pflichten sind“?
Kant identifiziert zwei Zwecke, die zugleich Pflichten sind: die eigene Vollkommenheit und die fremde Glückseligkeit. Eigene Vollkommenheit bedeutet die sittliche Vervollkommnung und die Entwicklung der eigenen Menschlichkeit. Fremde Glückseligkeit bedeutet, zur Glückseligkeit anderer beizutragen, indem man ihnen hilft, ihre eigenen Zwecke zu erreichen.
Wie steht Glückseligkeit im Verhältnis zur Tugendhaftigkeit in Kants Ethik?
Kant lehnt es ab, die eigene Glückseligkeit zum direkten Ziel moralischen Handelns zu machen. Er argumentiert, dass moralisches Handeln aus Pflicht geschehen sollte, unabhängig von persönlichen Wünschen oder Neigungen. Allerdings postuliert er, dass Tugendhaftigkeit letztendlich zur Würdigkeit führt, glücklich zu sein, und hofft, dass in einer moralisch geordneten Welt Tugend und Glückseligkeit miteinander in Einklang stehen.
Worin besteht der „Widerspruch des Eudaimonisten“ laut Kant?
Der „Widerspruch des Eudaimonisten“ bezieht sich auf die Idee, dass jemand nur dann hoffen kann, glücklich zu sein, wenn er sich seiner Pflichtbeobachtung bewusst ist, aber nur dann zur Beobachtung seiner Pflicht bewegt werden kann, wenn er voraussieht, dass er sich dadurch glücklich machen wird. Dieser Zirkelschluss untergräbt die Unentgeltlichkeit moralischen Handelns.
Was bedeutet „natürliche Dialektik“ im Kontext von Kants Philosophie?
„Natürliche Dialektik“ beschreibt den menschlichen Hang, gegen die strengen Gesetze der Pflicht zu vernünfteln und ihre Gültigkeit oder Strenge in Zweifel zu ziehen, um sie den eigenen Wünschen und Neigungen anzupassen.
Wie unterscheidet sich Kants Freiheitsbegriff von dem von Aristoteles?
Kant lehnt Aristoteles’ Freiheitsbegriff als Fähigkeit zum klugen Wählen und zweckmäßigen Handeln ab, der stark von situativen Faktoren abhängt. Kants Prinzip der Freiheit des Willens besteht in der Möglichkeit, diesen vom Begehrungsvermögen unabhängig bilden zu können.
- Citation du texte
- Jens Rymes (Auteur), 2005, "Pflicht, du erhabener großer Name!" - Die Begriffe der Pflicht und der Glückseligkeit in Kants Tugendlehre der Metaphysik der Sitten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45801