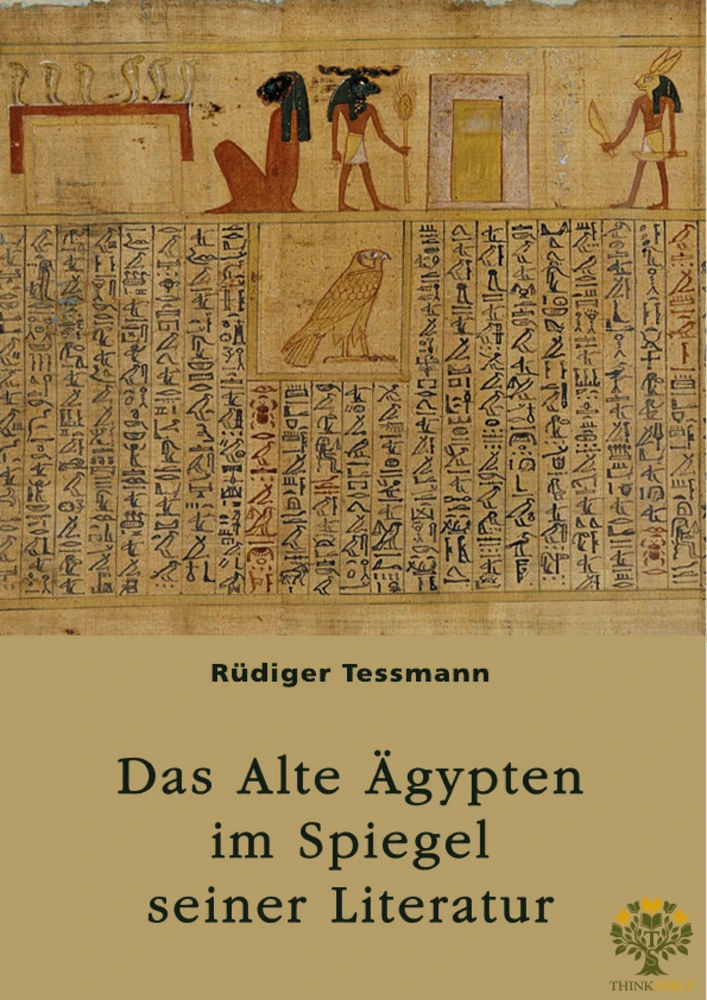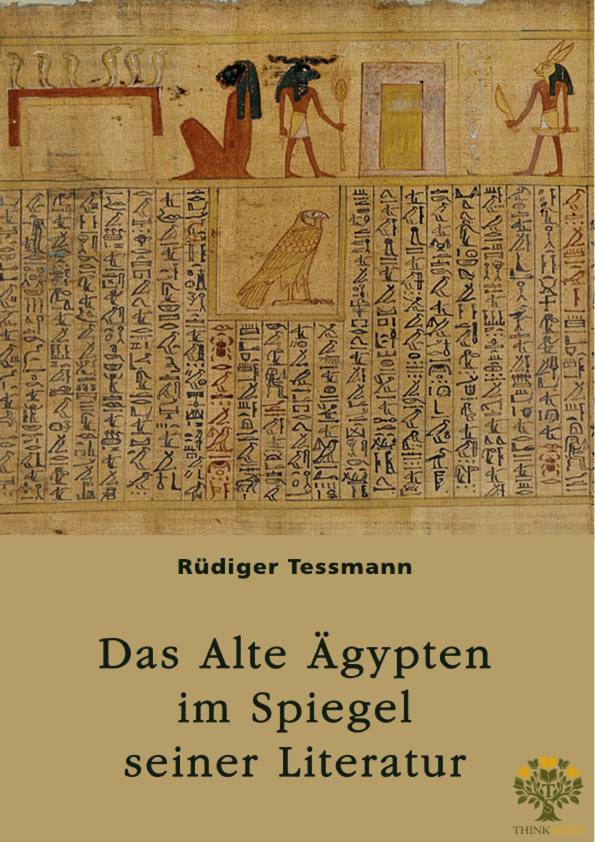Jedes Jahr zieht es Millionen von Menschen aus aller Welt nach Ägypten, um die Schätze der Grabbeigaben der Pharaonen im Museum zu betrachten und um die Bilder an den Wänden der Tempel und Gräber zu bewundern. Die Inschriften in Hieroglyphen waren bis zu ihrer Entzifferung tausendachthundert Jahre lang unlesbar, und sie bleiben auch für den Touristen ein Geheimnis.
In den üblichen Informationsschriften wird eine altägyptische Literatur zwar erwähnt, sie wird dadurch aber nicht greifbar. So sieht der Tourist im Land am Nil überwiegend eine Welt der Toten. Die teils bunten, sich scheinbar oft wiederholenden Bilder bleiben trotz einführender Worte bemühter Führer weitgehend unverständlich, wie auch die Schriftzeichen unverständlich bleiben. Man geht als Tourist an ihnen vorüber wie an bunten Comic-Zeichnungen, deren Sprechblasen in chinesischer Schrift abgefasst sind. Die Welt der alten Ägypter bleibt so tot, wie es die Mumien im Museum zu Kairo sind.
Es war für mich eine Überraschung festzustellen, dass ich über den Zugang zur Literatur der alten Ägypter – über die ich bis dahin nichts wusste – einen Eintritt in die Welt der lebenden Ägypter fand. Plötzlich wurden für mich aus den Ägyptern der Pharaonenzeit Menschen, deren Gedanken und deren Emotionen ich nachvollziehen konnte, sodass ich von ihnen innerlich erfasst und ergriffen wurde. Ich möchte deshalb hier in Form einer Sammlung von übersetzten Hieroglyphentexten berichten über meine Einblicke in diese für mich ganz neue Welt.
Unsere Schulweisheit machte uns glauben, dass unsere Religionsgeschichte in Israel und unsere Kulturgeschichte in Griechenland begonnen hat. Die Zeugnisse altägyptischer Literatur und Poesie, Theologie und Staatsphilosophie zeigen uns, dass die Wurzeln unseres kollektiven Kulturgedächtnisses weit tiefer zurückreichen. Da ich mich als begeisterter Amateur auf dem Gebiet der Ägyptologie wissenschaftlicher Präzision nicht verpflichtet fühle, habe ich lange oder schwer verständliche Textpassagen willkürlich gekürzt – jedoch nie verfälscht. Es ging mir in erster Linie darum, bei dem Leser die Lust zu wecken, sich weiter in die Materie zu vertiefen. Dazu wäre die Fachliteratur unverzichtbar.
Dieses Buch mit seinem Kurzüberblick der altägyptischen Literatur eignet sich besonders für Ägyptentouristen, die sich für den Alltag dieser faszinierenden Zeit begeistern.
- Citar trabajo
- Rüdiger Tessmann (Autor), 2025, Das Alte Ägypten im Spiegel seiner Literatur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458022