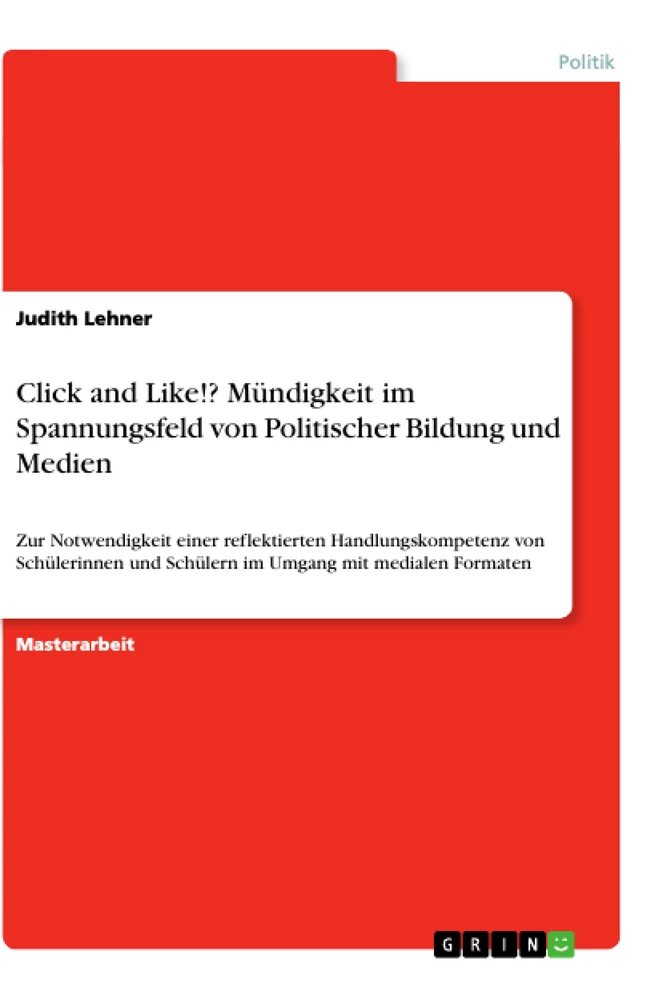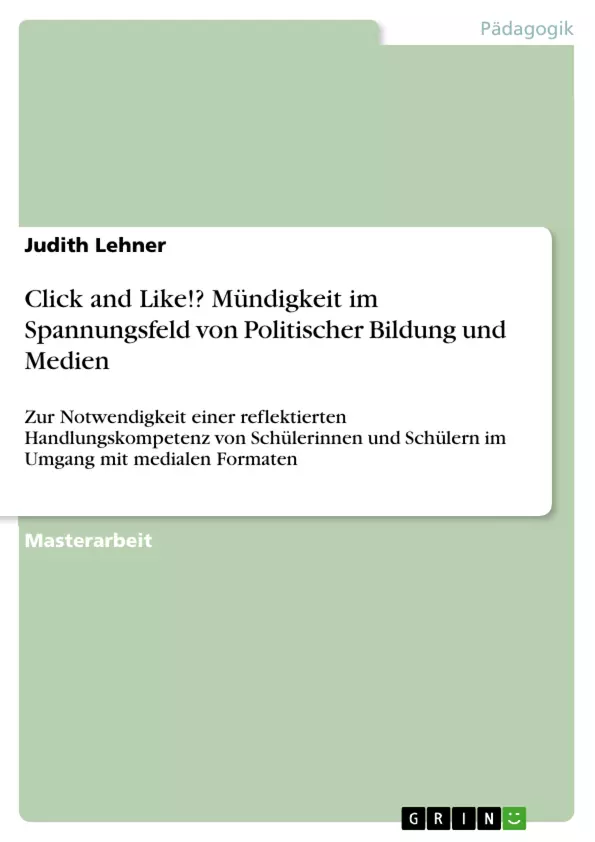Diese Arbeit beabsichtigt nicht, den Medienkonsum von Schüler*innen mit erhobenem Zeigefinger zu maßregeln, sondern soll zeigen, wie der Medienkonsum stattfindet und inwiefern Schüler*innen eine Handlungskompetenz vermittelt werden kann, um kritisch und reflektiert mit medialen Formaten umzugehen.
Schüler*innen sollen, wie in anderen Bereichen des Lebens auch, mündig handeln und aktiv am demokratischen Leben teilhaben. Sie begegnen allerdings ungefiltert medialen Inhalten auf jeglichen Kanälen und lernen nicht diese zu reflektieren. Es ist daher die Aufgabe des Politikunterrichts, Schüler*innen nicht nur zu mündigen Bürger*innen zu erziehen, sondern die Medienmündigkeit miteinzubeziehen. Die Arbeit bezieht daher nicht nur den Forschungsstand zum medialen Umfeld von Schüler*innen in Deutschland ein und welche Auswirkungen die Inhalte der ausgewählten medialen Inhalte auf die Identitätsentwicklung und -bildung der Schüler*innen haben, sondern gibt auch einen praktischen Einblick durch eine Analyse einiger medialer Formate.
Der empirische Teil der Arbeit, der Interviews mit Gymnasialschüler*innen beinhaltet, will folgende Fragen klären: Welche medialen Formate nutzen die Befragten und mit welchen Inhalten beschäftigen sie sich? Wie wirken die Inhalte auf die Schüler*innen und welche Rückschlüsse ziehen sie daraus für ihr eigenes Leben? Ziel dessen ist es, Implikationen für die politische Bildung herauszubilden, um so das Konzept einer Medienmündigkeit im Schulfach Politik/ Politik-Wirtschaft zu etablieren. Die Interviews wurden mit Hilfe der Methode des Problemzentrierten Interviews nach Witzel erhoben und mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse in Form einer typisierenden Strukturierung ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strukturelle Rahmenbedingungen
- Ziele Politischer Bildung
- Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK)
- Kerncurriculum Politik-Wirtschaft
- Mediales Umfeld von Schüler*innen in Deutschland
- Mediensozialisation
- Mediennutzung
- Mediale Formate und die Vermittlung ihrer Lebensentwürfe
- Identitätsbildung und Identitätsentwicklung
- Schüler*innen- Interviews
- Forschungsinteresse und methodisches Vorgehen
- Auswertung
- Konsequenzen, Herausforderungen und Chancen für die politische Bildung
- Förderung von Handlungskompetenzen im Umgang mit medialen Formaten - Lernziele
- Förderung von Medienmündigkeit im Politikunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Politischer Bildung und Medien, insbesondere im Kontext der Mündigkeit von Schülerinnen und Schülern im Umgang mit medialen Formaten. Die Arbeit untersucht, wie junge Menschen mediale Inhalte konsumieren und welche Auswirkungen diese auf ihre Identitätsbildung und -entwicklung haben. Ziel ist es, die Notwendigkeit einer reflektierten Handlungskompetenz im Umgang mit medialen Formaten zu verdeutlichen und entsprechende Forderungen an die Politische Bildung zu formulieren.
- Mediensozialisation und -nutzung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland
- Einfluss medialer Inhalte auf die Identitätsbildung und -entwicklung von Jugendlichen
- Mündigkeit und Handlungskompetenz im Umgang mit medialen Formaten
- Herausforderungen und Chancen für die Politische Bildung im Kontext des digitalen Wandels
- Die Bedeutung einer kritischen Medienkompetenz im Politikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik dar und beleuchtet die Bedeutung des Medienkonsums im Kontext der Identitätsbildung von Jugendlichen. Sie argumentiert, dass Politische Bildung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer reflektierten Handlungskompetenz im Umgang mit medialen Formaten spielt.
- Das Kapitel "Strukturelle Rahmenbedingungen" analysiert die Ziele Politischer Bildung, die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) und das Kerncurriculum Politik-Wirtschaft. Es beleuchtet die Bedeutung von politischer Bildung als Schulfach und als fachübergreifende Kompetenz.
- Das Kapitel "Mediales Umfeld von Schüler*innen in Deutschland" untersucht die Mediensozialisation und Mediennutzung von Jugendlichen in Deutschland. Es beleuchtet die Relevanz von Videoplattformen wie YouTube als Informationsquelle für junge Menschen und die Herausforderungen, die sich durch die vielfältigen und ungefilterten Inhalte des Internets ergeben.
- Das Kapitel "Schüler*innen- Interviews" präsentiert die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum Medienkonsum von Jugendlichen. Die Interviews beleuchten die Relevanz von medialen Inhalten für die Identitätsbildung und -entwicklung der interviewten Schülerinnen und Schüler.
- Das Kapitel "Forschungsinteresse und methodisches Vorgehen" beschreibt die Forschungsmethodik und -fragestellung der Arbeit. Es erläutert die Auswertungsmethode der Interviews und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
- Das Kapitel "Konsequenzen, Herausforderungen und Chancen für die politische Bildung" diskutiert die Herausforderungen und Chancen für die Politische Bildung im Kontext des digitalen Wandels. Es beleuchtet die Bedeutung einer kritischen Medienkompetenz im Politikunterricht und die Förderung von Handlungskompetenzen im Umgang mit medialen Formaten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Politische Bildung, Medienmündigkeit, Handlungskompetenz, Identitätsbildung, Mediensozialisation, YouTube, digitale Medien, und dem Einfluss medialer Inhalte auf die Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von politischer Bildung im Kontext des digitalen Wandels und untersucht die Rolle des Politikunterrichts bei der Vermittlung einer reflektierten Handlungskompetenz im Umgang mit medialen Formaten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit im Kontext der politischen Bildung?
Das Ziel ist es, das Konzept der Medienmündigkeit im Schulfach Politik zu etablieren, damit Schüler kritisch und reflektiert mit medialen Inhalten umgehen können.
Welche Rolle spielen Plattformen wie YouTube für Jugendliche?
YouTube dient vielen Jugendlichen als zentrale Informationsquelle und beeinflusst maßgeblich ihre Identitätsbildung und die Entwicklung ihrer Lebensentwürfe.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Es wurden problemzentrierte Interviews nach Witzel mit Gymnasialschülern geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse (typisierende Strukturierung) ausgewertet.
Was versteht man unter Medienmündigkeit?
Medienmündigkeit bedeutet die Fähigkeit, mediale Formate nicht nur zu konsumieren, sondern deren Inhalte zu reflektieren und aktiv-demokratisch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Welche strukturellen Rahmenbedingungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie das Kerncurriculum für das Fach Politik-Wirtschaft.
- Quote paper
- Judith Lehner (Author), 2017, Click and Like!? Mündigkeit im Spannungsfeld von Politischer Bildung und Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458065