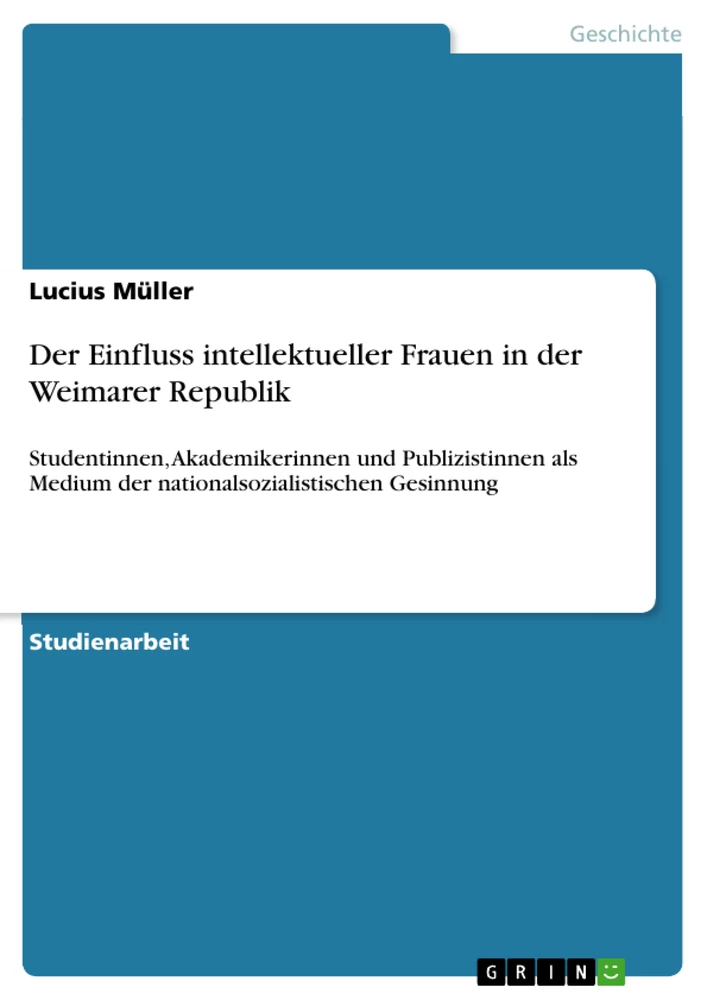Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu beleuchten, welche Voraussetzungen grundlegend dafür waren, dass Frauen in der Weimarer Republik, wie nie zuvor in der Deutschen Geschichte, an der politischen Meinungsbildung und ideologischen Ausrichtung der Gesellschaft mitwirken konnten. Zudem richtet sich der Fokus unserer Betrachtung auf die Gruppe von intellektuellen und politisch aktiven Frauen in der Weimarer Republik, die sich bewusst für die politischen Grundsätze des Nationalsozialismus engagieren.
Die Leitfragen hierbei sind: Welche gesetzlichen Beschlüsse und gesellschaftlichen Prozesse begünstigten die Einflussnahme deutscher Frauen? Welche Mittel der politischen Agitation standen Frauen in der Weimarer Republik zur Verfügung? Durch welche Medien und Organisationen unterstützen intellektuelle Frauen aktiv die Ideologie des Nationalsozialismus?
Die Zeit der Weimarer Republik war eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung, in der alte und neue Werte radikal aufeinander prallten, insbesondere auch was die Stellung Frau anging. Zum einen wurde dies durch die rasche wirtschaftliche Entwicklung der Zeit bedingte, sowie den erheblichen Wandel in der gesamtpolitischen Situation. Zum anderen wurzelte das Phänomen des neuen Frauenbilds in der Vorstellung von der Gleichheit, Mündigkeit und Selbständigkeit aller Menschen, die in immer breiten Kreisen des Bürgertums zur Debatte stand.
Die neuen Rechte und Ambitionen der deutschen Frau kollidierten in der Weimarer Republik immer wieder mit traditionsverhafteten Denkmuster und geschlechtshierarchischen Vorurteilen. So gewährten die Revolution und die neue Verfassung zwar die ersehnte politische Mündigkeit und den akademischen Aufstieg für Frauen, doch bestand die Vorstellung einer „klassischen Rollenverteilung“ nach wie vor, und der Gedanke an eine weibliche Intervention in die bis dato Männern vorbehaltenes Terrain, wurde vielerseits als Unschicklichkeit, Ärgernis oder gar Abnormität erachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Quellen- und Literaturbericht
- Methode und Aufbau der Arbeit
- Voraussetzungen für die ideologische Einflussnahme durch Frauen
- Frauenwahlrecht und Möglichkeit zur politischen Partizipation
- Legalisierte Frauenvereine als Rahmen politischer Interessenvertretung
- Zugangsberechtigung für Frauen zur universitären Bildung und Karriere
- Zusammenschlüsse rechter Studentinnen und Akademikerinnen
- Publizistinnen als Medium nationalsozialistischen Gedankenguts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, welche Voraussetzungen die politische Mitwirkung von Frauen in der Weimarer Republik ermöglichten. Der Fokus liegt dabei auf intellektuellen und politisch aktiven Frauen, die sich für den Nationalsozialismus engagierten.
- Das Frauenwahlrecht und die daraus resultierende politische Partizipation
- Die Rolle legalisierter Frauenvereine als politische Interessengruppen
- Der Zugang von Frauen zu universitärer Bildung und die Herausforderungen des Akademikerinnendaseins
- Die Unterstützung des Nationalsozialismus durch rechte Studentinnen und Akademikerinnen
- Der Einfluss von Publizistinnen auf die Verbreitung nationalsozialistischer Ideologien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung, den Quellen- und Literaturbericht sowie die Methode und den Aufbau der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die Voraussetzungen für die ideologische Einflussnahme von Frauen in der Weimarer Republik, einschließlich des Frauenwahlrechts, legalisierter Frauenvereine und der Zugangsberechtigung zu universitärer Bildung. Weitere Kapitel behandeln die Zusammenschlüsse rechter Studentinnen und Akademikerinnen sowie die Rolle von Publizistinnen als Medium nationalsozialistischen Gedankenguts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Frauenwahlrecht, Frauenvereine, universitäre Bildung, politische Partizipation, rechte Studentinnen und Akademikerinnen, Publizistik, Nationalsozialismus, Ideologie und Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich die Rolle der Frau in der Weimarer Republik?
Durch das Frauenwahlrecht (1918) und den Zugang zu Bildung erhielten Frauen erstmals die Möglichkeit, aktiv an der politischen Meinungsbildung teilzunehmen.
Warum engagierten sich intellektuelle Frauen für den Nationalsozialismus?
Die Arbeit untersucht, wie gerade gebildete Frauen rechte Ideologien unterstützten, oft aus einer Ablehnung der modernen Umbrüche oder aus völkischer Überzeugung.
Welche Rolle spielten Frauenvereine in dieser Zeit?
Legalisierte Frauenvereine dienten als Rahmen für politische Interessenvertretung und als Plattform für die Agitation verschiedener ideologischer Richtungen.
Gab es Widerstände gegen den akademischen Aufstieg von Frauen?
Ja, trotz formaler Gleichstellung kollidierten neue Ambitionen oft mit traditionsverhafteten Denkmustern und geschlechtshierarchischen Vorurteilen im Bildungssektor.
Wie verbreiteten Publizistinnen nationalsozialistisches Gedankengut?
Intellektuelle Frauen nutzten Medien und Organisationen, um die NS-Ideologie aktiv zu unterstützen und weibliche Zielgruppen für die Bewegung zu mobilisieren.
- Citation du texte
- Lucius Müller (Auteur), 2013, Der Einfluss intellektueller Frauen in der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458092