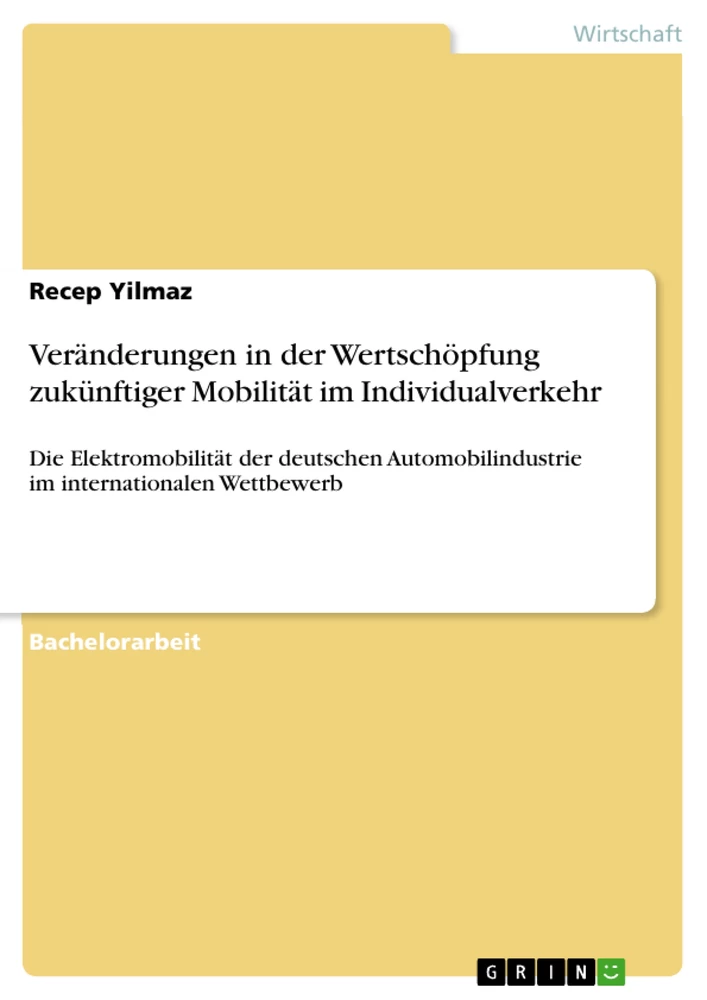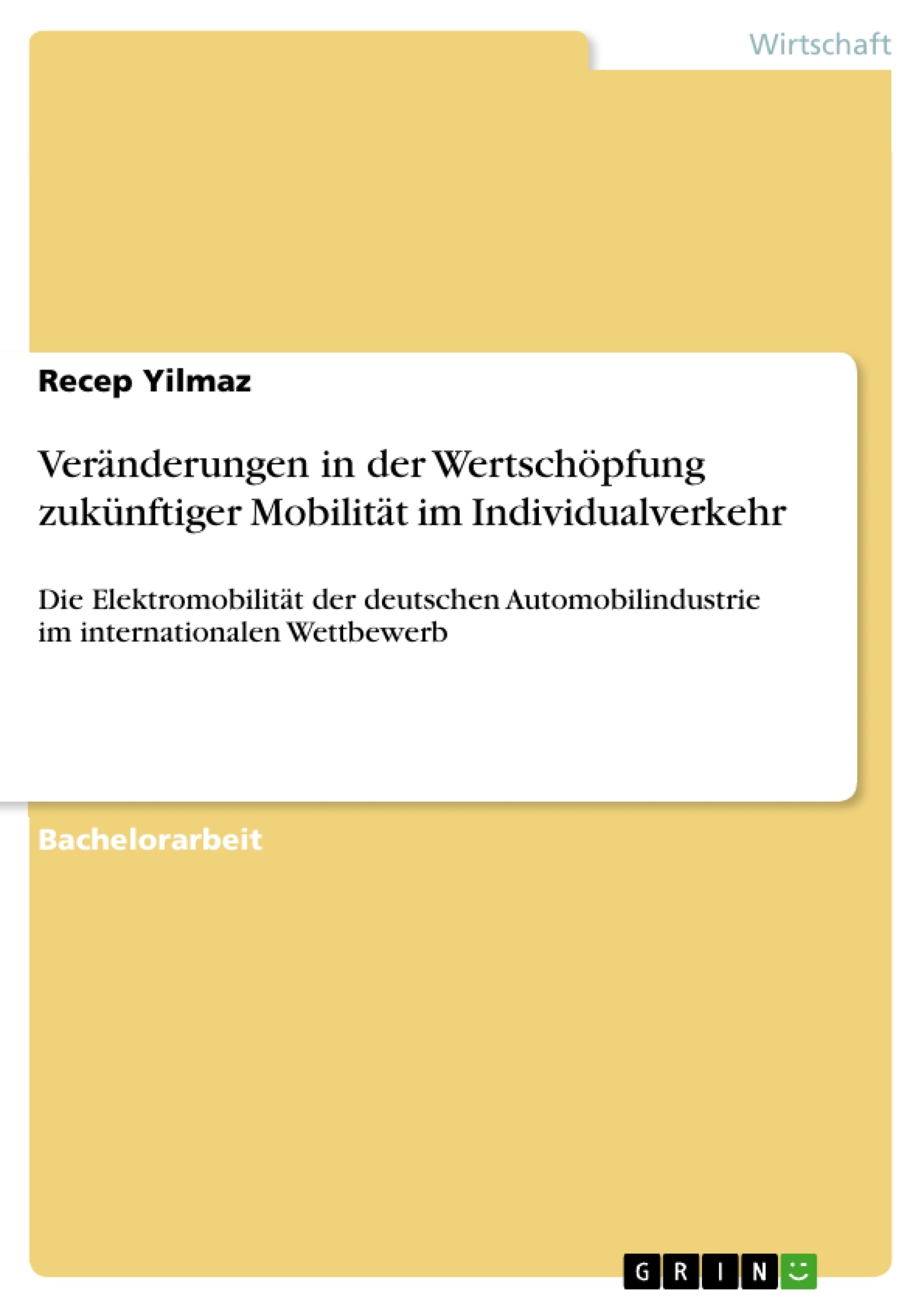Diese Arbeit untersucht die Veränderungen in der Wertschöpfung zukünftiger Mobilität im Individualverkehr. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Elektromobilität der deutschen Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb.
Individualverkehr ist weltweit ein hohes Gut: Mobilität ist eine große Herausforderung, insbesondere für die Industrieländer, in denen die Mehrheit der Bevölkerung Autos besitzt. Die durch Ölkraftfahrzeuge verursachte Verschmutzung hat dazu geführt, dass weltweit nach besseren Wegen gesucht wird, Autos anzutreiben. Eine der Lösungen für den Individualverkehr ist der Einsatz von Elektrofahrzeugen. Von Asien über Europa bis nach Nordamerika wagen sich die meisten Automobilhersteller an dieses Konzept heran, das die Zukunft der individuellen Mobilität zu werden verspricht. Das deutsche Auto scheint jedoch nicht nur in puncto Fahrzeugbau im Hintertreffen zu sein, sondern auch im Hinblick auf die Anpassung an Elektrofahrzeuge. Jüngste Studien über den beobachtbaren Megatrend in der Automobilindustrie deuten darauf hin, dass die meisten deutschen Autohersteller sich noch nicht vollständig auf Elektrofahrzeuge einlassen. Dies wiederum bedeutet, dass das Land den Anschluss verlieren könnte, da die meisten Länder Elektrofahrzeuge weiterhin vollständig übernehmen. Das langsame Tempo, mit dem sich die deutsche Automobilindustrie an die moderne Technologie anpasst, lässt vermuten, dass sich die Branche in Bezug auf die Elektromobilität im internationalen Wettbewerb mit einer unsicheren Zukunft konfrontiert sieht.
Es macht den Eindruck, dass Länder wie China oder die USA die Pionierrolle einnehmen werden. Es scheint, dass der Erfolg des Elektroautos unter anderem davon abhängt, ob leistungsstarke Batterien entwickelt werden können. Diesem Problem sehen sich alle Industrienationen gleichermaßen gegenüber. Weltweit wird in der Branche auf Hochtouren geforscht. Deutschland bleibt weiterhin zurück, da die meisten großen Länder Elektrofahrzeuge bereits einführen. Das langsame Tempo, mit dem sich die deutsche Automobilindustrie an die moderne Technologie anpasst, lässt vermuten, dass sich die Branche in Bezug auf Elektromobilität im internationalen Wettbewerb mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert sieht.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Hintergrund der Studie
- Forschungsfragen
- Methodik
- Datenquellen
- Vorgehensweise
- Experteninterviews
- Die Automobilindustrie im Wandel der Zeit
- Entwicklungen in der Automobilindustrie
- Die politische Entwicklung
- Die gesellschaftliche Entwicklung
- Der Wettbewerbsmarkt
- Die drei Phasen des Wandels
- Die deutsche Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb
- Elektromobilität in Deutschland
- Elektromobilität in den USA
- Elektromobilität in China
- Die Veränderungen in der Wertschöpfungskette
- Aktuelle Wertschöpfungskette
- Die veränderte Wertschöpfungskette durch Elektromobilität
- Wegfall von Komponenten im Upstreambereich
- Neue Komponenten im Upstreambereich
- Veränderungen im Downstreambereich
- Ziele und Strategien der Automobilhersteller
- Deutschland bleibt Autonation
- Interpretation der Ergebnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie im Kontext der Elektromobilität. Der Fokus liegt auf der Analyse des Potenzials der deutschen Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb im Bereich der Elektromobilität.
- Entwicklungen der Automobilindustrie im Wandel der Zeit
- Analyse der deutschen Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb
- Veränderungen in der Wertschöpfungskette durch Elektromobilität
- Ziele und Strategien der Automobilhersteller im Bereich der Elektromobilität
- Bewertung des Potenzials der deutschen Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Elektromobilität und ihrer Auswirkungen auf die Automobilindustrie ein. Sie definiert die Problemstellung, skizziert den Hintergrund der Studie und formuliert die Forschungsfragen. Die Methodik beschreibt die verwendeten Datenquellen, die Vorgehensweise und die Durchführung von Experteninterviews.
Kapitel 2 analysiert die Entwicklungen der Automobilindustrie im Wandel der Zeit. Es beleuchtet die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren, die die Transformation der Branche prägen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung des Wettbewerbsmarktes und der Identifizierung von Trends in der Automobilindustrie.
Kapitel 3 untersucht die deutsche Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb. Es betrachtet die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland, den USA und China und analysiert die Wettbewerbsvorteile und -nachteile der deutschen Automobilindustrie in diesem Bereich.
Kapitel 4 analysiert die Veränderungen in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie durch die Elektromobilität. Es untersucht den Wegfall und die Hinzunahme von Komponenten im Upstreambereich, sowie die Veränderungen im Downstreambereich. Darüber hinaus werden die Ziele und Strategien der Automobilhersteller im Bereich der Elektromobilität beleuchtet.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und interpretiert deren Bedeutung für die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Es bewertet das Potential der deutschen Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb im Bereich der Elektromobilität und gibt Empfehlungen für die weitere Entwicklung.
Schlüsselwörter
Elektromobilität, Automobilindustrie, Wertschöpfungskette, Internationaler Wettbewerb, Deutschland, USA, China, Upstream, Downstream, Potenzialanalyse, Strategien, Innovation.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert Elektromobilität die Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie?
Die Wertschöpfungskette verschiebt sich massiv: Klassische Komponenten wie Verbrennungsmotoren und Getriebe fallen weg, während neue Komponenten wie Batteriezellen, Elektromotoren und Leistungselektronik an Bedeutung gewinnen.
Wo steht Deutschland im internationalen Wettbewerb der Elektromobilität?
Deutschland droht den Anschluss zu verlieren, da Länder wie China und die USA bei der Einführung und Produktion von Elektrofahrzeugen sowie der Batterietechnologie derzeit eine Pionierrolle einnehmen.
Welche Rolle spielt die Batterietechnologie für den Erfolg von E-Autos?
Die Batterie ist das Herzstück des Elektroautos. Ihr Erfolg hängt von der Leistungsfähigkeit, der Reichweite und den Produktionskosten ab. Wer die Batterietechnik beherrscht, sichert sich einen zentralen Teil der zukünftigen Wertschöpfung.
Was sind die größten Herausforderungen für deutsche Automobilhersteller?
Die größte Herausforderung ist das langsame Tempo bei der Anpassung an moderne Technologien sowie der hohe Investitionsbedarf für die Umstellung der Produktion und die Entwicklung neuer Software-Kompetenzen.
Wie verändern sich die Strategien der Hersteller im Downstreambereich?
Im Downstreambereich (Vertrieb und Service) verringert sich der Wartungsaufwand, da E-Autos weniger Verschleißteile haben. Hersteller müssen daher neue Geschäftsmodelle, wie digitale Dienste oder Ladeinfrastrukturen, erschließen.
- Quote paper
- Recep Yilmaz (Author), 2018, Veränderungen in der Wertschöpfung zukünftiger Mobilität im Individualverkehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458098