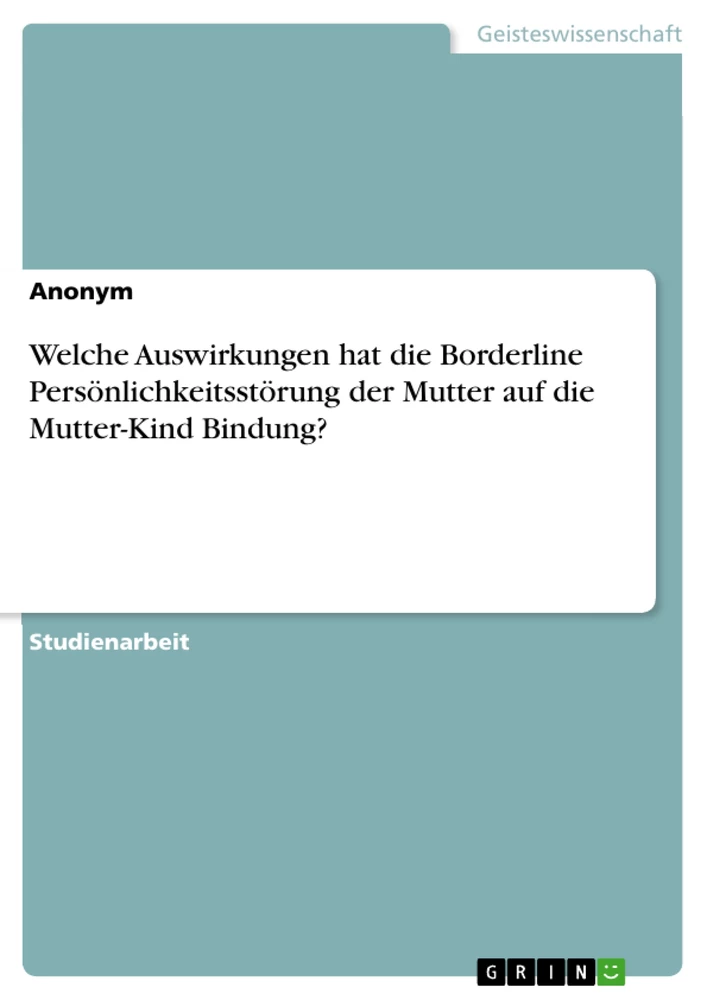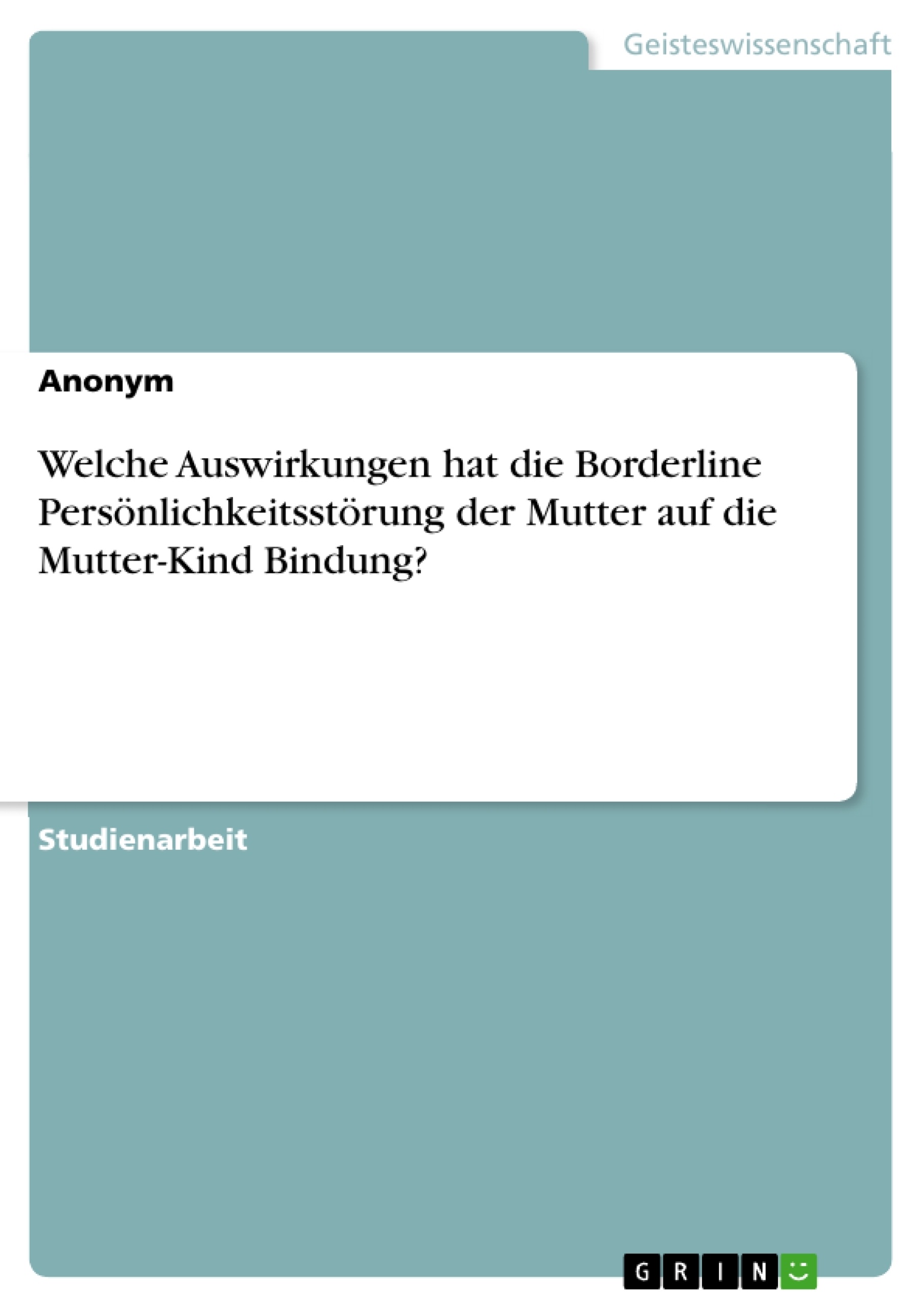In der vorliegenden Hausarbeit befasse ich mich mit der Borderline Persönlichkeitsstörung der Mutter und die Auswirkung der Erkrankung auf die Eltern-Kind Bindung.
Einleitend wird ein Überblick über das Krankheitsbild der Borderline Persönlichkeitsstörung gegeben. Dazu gehörten typische Verhaltensweisen und Erklärungsansätze der Erkrankung. Das anschließende Kapitel befasst sich mit der Mutter-Kind Bindung, wobei hier auf die Bindungstheorie nach John Bowlby eingegangen wird und die Relevanz der kindlichen Bedürfnisse nach Klaus Grawe erläutert werden.
Im letzten Kapitel werden die Auswirkungen der Borderline Persönlichkeitserkrankung auf die Mutter-Kind-Beziehung verdeutlicht, wobei mir eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise wichtig war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung der Borderline Persönlichkeitsstörung
- Erscheinungsformen
- Mutter-Kind Bindung
- Bindungstheorie
- Kindliche Bedürfnisse
- Auswirkungen auf die Mutter-Kind Bindung im Borderline-Kontext
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der Borderline Persönlichkeitsstörung der Mutter auf die Mutter-Kind-Bindung. Die Arbeit befasst sich mit der Begriffsbestimmung der Borderline Persönlichkeitsstörung, der Bindungstheorie nach John Bowlby sowie den kindlichen Bedürfnissen nach Klaus Grawe. Die Arbeit soll die Auswirkungen der Erkrankung auf die Mutter-Kind-Beziehung aus einer ressourcenorientierten Perspektive beleuchten.
- Begriffsbestimmung der Borderline Persönlichkeitsstörung
- Bindungstheorie nach John Bowlby
- Kindliche Bedürfnisse nach Klaus Grawe
- Auswirkungen der Borderline Persönlichkeitsstörung auf die Mutter-Kind-Bindung
- Ressourcenorientierte Betrachtungsweise der Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Auswirkungen der Borderline Persönlichkeitsstörung der Mutter auf die Mutter-Kind-Bindung ein und erläutert den persönlichen Bezug des Autors zur Thematik.
- Begriffsbestimmung der Borderline Persönlichkeitsstörung: Dieses Kapitel definiert die Borderline Persönlichkeitsstörung anhand der ICD-10 Klassifikation und des DSM 5. Es beschreibt typische Verhaltensweisen und Erklärungsansätze der Erkrankung.
- Mutter-Kind Bindung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bindungstheorie nach John Bowlby und erklärt die Relevanz der kindlichen Bedürfnisse nach Klaus Grawe.
- Auswirkungen auf die Mutter-Kind Bindung im Borderline-Kontext: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Borderline Persönlichkeitsstörung auf die Mutter-Kind-Beziehung. Es betont eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise.
Schlüsselwörter
Borderline Persönlichkeitsstörung, Mutter-Kind Bindung, Bindungstheorie, John Bowlby, kindliche Bedürfnisse, Klaus Grawe, Auswirkungen, Ressourcenorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich eine Borderline-Störung der Mutter auf das Kind aus?
Die Erkrankung kann die Bindungsqualität beeinflussen, da typische Symptome wie emotionale Instabilität und Impulsivität die Feinfühligkeit gegenüber den kindlichen Bedürfnissen erschweren können.
Was besagt die Bindungstheorie nach John Bowlby in diesem Kontext?
Sie betont die Notwendigkeit einer sicheren Basis für die gesunde Entwicklung des Kindes. Eine Borderline-Erkrankung kann dazu führen, dass diese Sicherheit durch wechselhaftes Verhalten der Mutter beeinträchtigt wird.
Welche kindlichen Bedürfnisse sind nach Klaus Grawe besonders relevant?
Grawe nennt Grundbedürfnisse wie Bindung, Orientierung/Kontrolle, Selbstwertschutz und Lustgewinn, deren Erfüllung bei einer psychischen Erkrankung der Bezugsperson gefährdet sein kann.
Was bedeutet eine "ressourcenorientierte Betrachtungsweise"?
Trotz der Belastungen durch die Erkrankung werden auch die Stärken der Mutter-Kind-Beziehung und externe Unterstützungsmöglichkeiten in den Blick genommen, um positive Entwicklungen zu fördern.
Was sind typische Erscheinungsformen der Borderline-Störung?
Dazu gehören intensive, aber instabile Beziehungen, Identitätsstörungen, Selbstgefährdung und starke Stimmungsschwankungen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Welche Auswirkungen hat die Borderline Persönlichkeitsstörung der Mutter auf die Mutter-Kind Bindung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458230