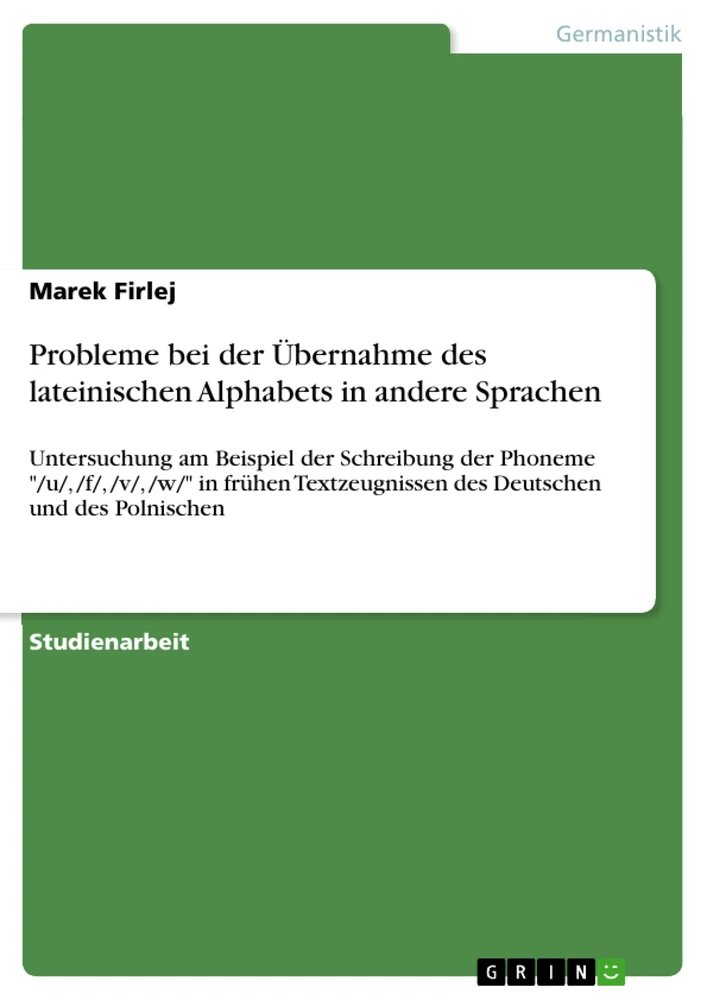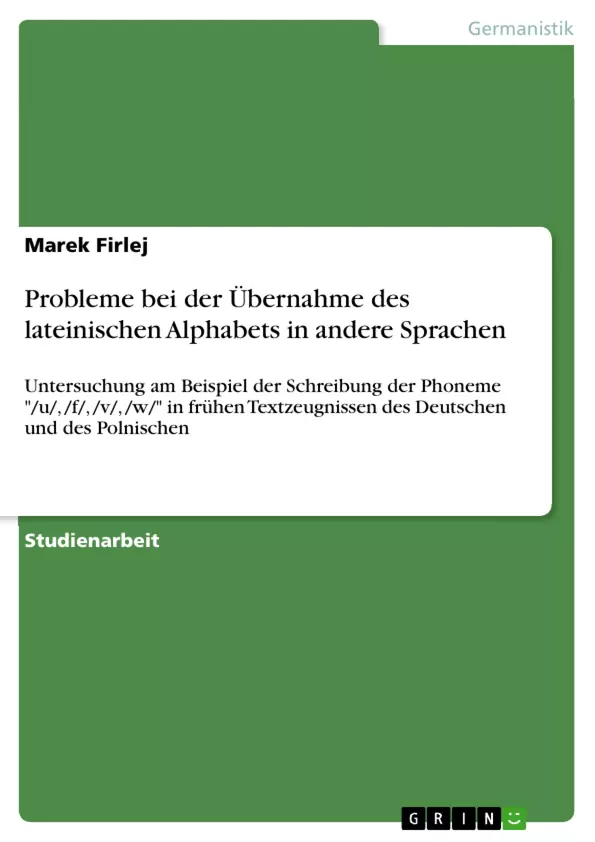Wer sich neben der deutschen auch mit fremden Sprachen und ihren Orthographien, Transkriptionen und Transliterationen beschäftigt, stößt immer wieder auf interessante Zweifelsfälle und kreative Lösungen, etwa wenn man entdeckt, dass im Ungarischen, der Buchstabe <s> nicht – wie man es aus den allermeisten anderen Sprachen kennt – für den Laut [s] steht, sondern für [∫].
Diese Unterschiede in der Buchstaben-Laut-Zuordnung haben alle eine gemeinsame Ursache: Übernimmt ein Benutzer einer Sprache die Schrift einer anderen Sprache, wird er höchstwahrscheinlich vor dem Problem stehen, dass das Phoneminventar seiner Sprache ein anderes ist als das, für das die Schrift konzipiert wurde (das gilt auch für Sprachen im diachronen Wandel), ergo muss er sich was einfallen lassen, seine Texte gleichzeitig so eindeutig wie lesbar zu gestalten. Die Ergebnisse, zu denen die über Schrift verfügenden Sprachen gekommen sind, sind erstaunlich vielfältig und Zeugnisse jahrhundertelanger kreativer und normativer Spracharbeit.
Um diese Vielfalt herauszustellen, wird diese Arbeit früheste Texte nicht nur der deutschen, sondern auch der polnischen Sprache untersuchen. Die Frage ist, welche Lösungen die Schreiber für das Problem gefunden haben, die dem Lateinischen fremden Laute [v] bzw. [w] (je nachdem ob man von klassischem oder Mittellatein spricht) mit Hilfe des lateinischen Alphabets schriftlich zu fixieren. Da schon in lateinischen Texten <u> und <v> austauschbar waren und beide für /u/ wie auch für /v/ stehen konnten, muss auch /u/ in die Untersuchung miteinbezogen werden. Da das heutige deutsche <v> für /f/ wie auch für /v/ stehen kann, ergibt sich ebenfalls ein Interesse an der frühen Verschriftlichungsform des Phonems /f/. Darüber hinaus wird an den deutschen Quellen noch kurz auf weitere aufschlussreiche oder auch rätselhafte Besonderheiten eingegangen.
Als Quellen dienen in beiden Sprachen jeweils zwei zu den ältesten zählenden erhaltenen zusammenhängenden Texte: Das Hildebrandslied und das Wessobrunner Gebet für das Althochdeutsche (beide erste Hälfte des 9. Jh.) sowie die Predigten vom Heiligen Kreuz (Kazania Świętokrzyskie) für das Altpolnische (um 1300).
Der dreisprachige Florianer Psalter (lateinisch, polnisch, deutsch) zeigt zudem, ob einzelsprachlicher Graphie-Usus beim mittelalterlichen Schreiben eine Rolle spielten oder der Usus des Schreibers über die Schreibung entschied.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die graphische Ebene
- Historisch-phonetische Grundlagen
- Deutsch
- Althochdeutsch
- Mittelhochdeutsch
- Altpolnisch
- Deutsch
- Quellenanalyse
- Das Wessobrunner Gebet
- Quellenbeschreibung
- Graphemanalyse ,
, , - Sonstige Beobachtungen
- Das Hildebrandslied
- Quellenbeschreibung
- Graphemanalyse ,
, , - Sonstige Beobachtungen
- Die IV. Predigt vom Heiligen Kreuz
- Quellenbeschreibung
- Graphemanalyse ,
, ,
- Der erste Psalm des Florianer Psalters
- Quellenbeschreibung
- Graphemanalyse ,
, ,
- Das Wessobrunner Gebet
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Herausforderungen der Übernahme des lateinischen Alphabets in andere Sprachen, insbesondere in Bezug auf die Darstellung von Lauten, die im Lateinischen nicht vorhanden sind. Die Arbeit untersucht, wie frühe Textzeugnisse des Deutschen und des Polnischen die Phoneme /u/, /f/, /v/ und /w/ schriftlich wiedergegeben haben.
- Untersuchung der graphischen Darstellung von /u/, /f/, /v/ und /w/ in frühen Textzeugnissen des Deutschen und des Polnischen
- Analyse der Unterschiede in der Phonem-Graphem-Zuordnung zwischen Latein und den untersuchten Sprachen
- Erforschung der Entwicklung von Schreibkonventionen im Frühmittelalter
- Vergleich der Schreibpraktiken in deutschen und polnischen Texten
- Bedeutung der historischen phonetischen Entwicklung für die Graphematik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Problematik der Übernahme des lateinischen Alphabets in andere Sprachen, insbesondere in Bezug auf die Darstellung von Lauten, die im Lateinischen nicht vorhanden sind. Die Arbeit konzentriert sich auf die Schreibung der Phoneme /u/, /f/, /v/ und /w/ in frühen Textzeugnissen des Deutschen und des Polnischen.
- Die graphische Ebene: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der graphischen Ebene von Texten und das Verhältnis zwischen graphischer und phonetischer Ebene. Es wird die Definition von Graphem erläutert und die Komplexität der Beziehung zwischen Phonemen und Graphemen beleuchtet. Weiterhin wird die Wichtigkeit einer konstanten Orthographie im Sinne der Lesbarkeit hervorgehoben.
- Historisch-phonetische Grundlagen: Dieses Kapitel betrachtet die historische phonetische Entwicklung des Deutschen und des Polnischen, um die Schreibung der Phoneme /u/, /f/, /v/ und /w/ im Kontext der jeweiligen Sprachgeschichte zu verstehen. Es werden die relevanten phonetischen Veränderungen in Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Altpolnisch dargestellt.
- Quellenanalyse: Dieser Teil der Arbeit analysiert ausgewählte frühmittelalterliche Texte aus dem Deutschen und dem Polnischen, um die Schreibung der Phoneme /u/, /f/, /v/ und /w/ in den jeweiligen Sprachen zu untersuchen. Die Analyse umfasst das Wessobrunner Gebet, das Hildebrandslied, die Predigten vom Heiligen Kreuz und den Florianer Psalter.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Übernahme des lateinischen Alphabets, die Darstellung von Lauten, die im Lateinischen nicht vorhanden sind, die Schreibung der Phoneme /u/, /f/, /v/ und /w/, die Entwicklung von Schreibkonventionen im Frühmittelalter, die historische phonetische Entwicklung, Graphematik, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Altpolnisch, Wessobrunner Gebet, Hildebrandslied, Predigten vom Heiligen Kreuz, Florianer Psalter.
Häufig gestellte Fragen
Welche Probleme entstehen bei der Übernahme des lateinischen Alphabets?
Hauptproblem ist die Darstellung von Lauten, für die das lateinische Alphabet keine eigenen Buchstaben vorsieht, was zu kreativen Neukombinationen (Graphemen) führt.
Wie wurde der Laut [w] im Althochdeutschen geschrieben?
In frühen Texten wie dem Hildebrandslied wurden oft Kombinationen wie
Was ist das Besondere an der frühen polnischen Orthographie?
Frühe polnische Texte wie die "Predigten vom Heiligen Kreuz" zeigen ähnliche Probleme wie das Deutsche bei der Verschriftlichung slawischer Laute mit lateinischen Zeichen.
Was ist ein Graphem?
Ein Graphem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der geschriebenen Sprache, die einem oder mehreren Phonemen (Lauten) zugeordnet ist.
Welche historischen Texte werden in der Studie analysiert?
Analysiert werden das Hildebrandslied, das Wessobrunner Gebet, die Predigten vom Heiligen Kreuz und der Florianer Psalter.
- Citation du texte
- Marek Firlej (Auteur), 2014, Probleme bei der Übernahme des lateinischen Alphabets in andere Sprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458661