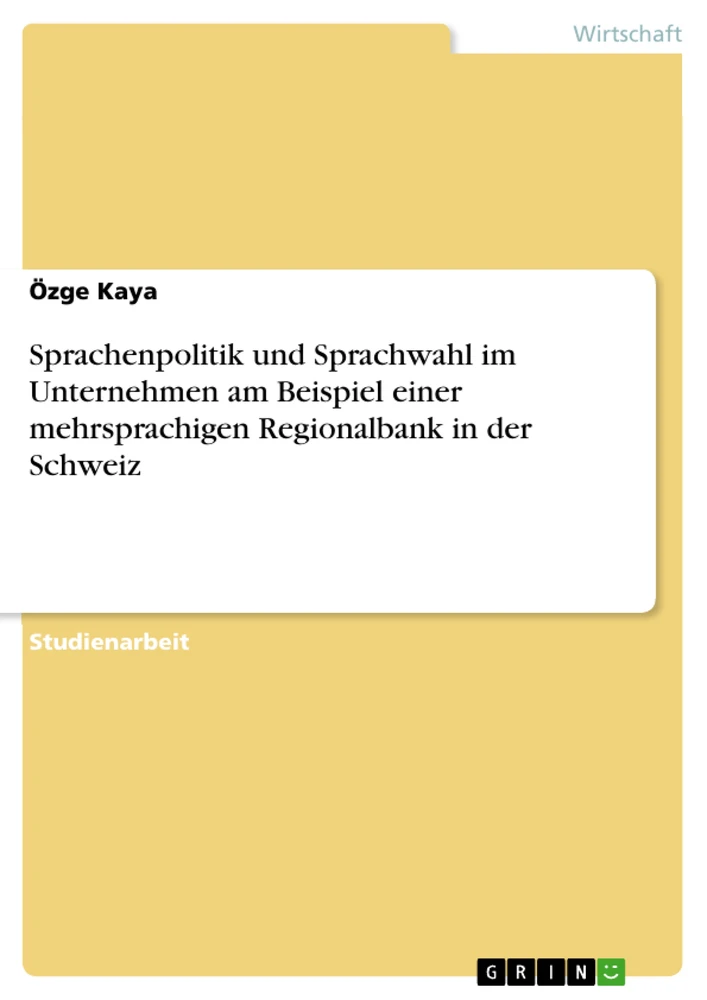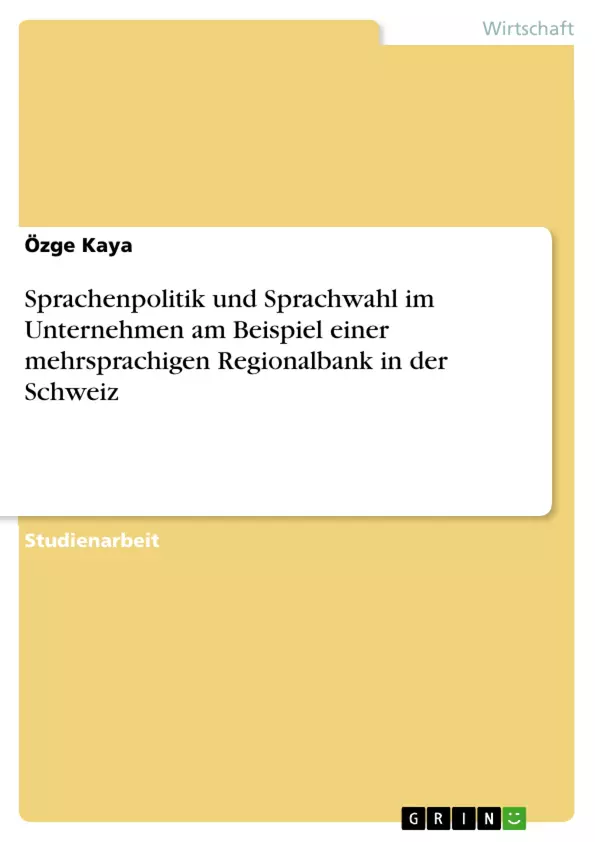Die Kommunikation im Unternehmen, sei es mit Kunden, Partnern oder Mitarbeitern ist ein wichtiges Instrument moderner Unternehmensführung. Ohne eine effiziente Kommunikation können strategisch wichtige Handlungen und Entscheidungen falsch oder gar nicht ausgeführt werden. Dieser Umstand stellt vor allem internationalisierte Unternehmen vor neue Herausforderungen. Bei der Zusammenarbeit von Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Sprachkenntnissen ist neben der bloßen Nicht-Kenntnis der Sprache des Gegenübers auch die Gefahr gegeben, dass Aussagen aufgrund von routiniertem Kommunikationsverhalten missverstanden werden.
Dabei läuft nicht nur ein Projekt oder Vorhaben Gefahr zu misslingen. Auch das Geschäftsklima wird wesentlich von einer möglichst verständigen Kommunikation bestimmt. Deshalb sind vor allem Unternehmen, die im internationalen Bereich tätig sind, auf eine wohl durchdachte Sprachenpolitik angewiesen. Außerdem kann auch eine Entwicklung vorwiegend gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit durch aktive Sprachenpolitik gewährleistet werden. Hierbei existieren die verschiedensten Möglichkeiten zur Gestaltung der Sprachenpolitik, insbesondere in mehrsprachigen Ländern und internationalen Organisationen, in welchen die sprachliche Vielfalt in der Kommunikation mit Klienten stets zunimmt.
Wie Unternehmen für die notwendigen Kompetenzen sorgen und inwieweit die wirkliche Sprachverwendung mit einer offiziellen Sprachpolitik übereinstimmt wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Ausgangssituation: Die ELAN-Studie
- Begriffsdefinition
- Sprach- vs. Sprachenpolitik
- Sprachenpolitik im Unternehmen
- Sprachwahl
- Motivationale Sprachwahl für Individuen
- Sprachwahl im Unternehmen
- Branchenspezifischer Fremdsprachenbedarf
- Dylan-Projekt
- Ziele und Ergebnisse
- Analyserahmen
- Mehrsprachige Regionalbank in der Schweiz
- Kontext
- Sprachliche Ressourcen
- Ein- oder Mehrsprachigkeit: ein Vergleich ökonomischer Kriterien aus der Sicht der Unternehmung und der Betroffenen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachpolitik und Sprachwahl im Unternehmen am Beispiel einer mehrsprachigen Regionalbank in der Schweiz. Sie analysiert die sprachlichen Herausforderungen, die sich in einem mehrsprachigen Kontext für Unternehmen ergeben, und untersucht die verschiedenen Strategien, die Unternehmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen entwickeln.
- Die Bedeutung der Kommunikation im Unternehmen
- Sprach- und Sprachenpolitik im Kontext der Unternehmenskommunikation
- Sprachwahlstrategien von Unternehmen
- Der Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die ökonomische Situation von Unternehmen
- Die sprachlichen Herausforderungen in einem mehrsprachigen Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema Sprachpolitik und Sprachwahl im Unternehmen ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der globalisierten Wirtschaft dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Kommunikation in einem mehrsprachigen Umfeld ergeben, und stellt die Forschungsfragen der Arbeit vor.
- Kapitel 2: Ausgangssituation: Die ELAN-Studie: Dieses Kapitel beschreibt die ELAN-Studie, die als Ausgangspunkt für die Analyse der Sprachpolitik und Sprachwahl im Unternehmen dient. Es präsentiert die zentralen Ergebnisse der Studie und skizziert die Relevanz dieser Ergebnisse für die weitere Forschung.
- Kapitel 3: Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Sprachpolitik und Sprachenpolitik und unterscheidet zwischen diesen Begriffen. Es erläutert die verschiedenen Dimensionen der Sprachpolitik im Unternehmen und analysiert die Bedeutung der Sprachpolitik für die erfolgreiche Unternehmensführung.
- Kapitel 4: Sprachwahl: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Sprachwahl im Unternehmen. Es analysiert die motivationalen Faktoren, die die Sprachwahl von Individuen beeinflussen, und untersucht die Strategien, die Unternehmen zur Sprachwahl im Unternehmensumfeld entwickeln.
- Kapitel 5: Branchenspezifischer Fremdsprachenbedarf: Dieses Kapitel befasst sich mit dem branchenspezifischen Fremdsprachenbedarf. Es analysiert die verschiedenen Anforderungen an Sprachkenntnisse in unterschiedlichen Branchen und untersucht den Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und beruflichem Erfolg.
- Kapitel 6: Dylan-Projekt: Dieses Kapitel stellt das Dylan-Projekt vor und erläutert die Ziele und Ergebnisse des Projekts. Es analysiert die Methodik des Projekts und präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse, die im Rahmen des Projekts gewonnen wurden.
- Kapitel 7: Mehrsprachige Regionalbank in der Schweiz: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie einer mehrsprachigen Regionalbank in der Schweiz. Es beschreibt die sprachlichen Herausforderungen, die die Bank in ihrem täglichen Betrieb bewältigen muss, und analysiert die Sprachwahlstrategien, die die Bank entwickelt hat.
- Kapitel 8: Ein- oder Mehrsprachigkeit: ein Vergleich ökonomischer Kriterien aus der Sicht der Unternehmung und der Betroffenen: Dieses Kapitel vergleicht die ökonomischen Kriterien der Ein- und Mehrsprachigkeit aus der Sicht der Unternehmung und der Betroffenen. Es analysiert die Vor- und Nachteile der jeweiligen Sprachstrategie und untersucht die Auswirkungen der Sprachwahl auf die wirtschaftliche Performance von Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Sprachpolitik, Sprachenpolitik, Sprachwahl, Unternehmenskommunikation, Mehrsprachigkeit, Einsprachigkeit, ökonomische Kriterien, Sprachkompetenz, Sprachbedarf, Unternehmenskultur, internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Sprachenpolitik für internationale Unternehmen wichtig?
Eine klare Sprachenpolitik verhindert Missverständnisse, fördert ein gutes Geschäftsklima und ermöglicht effiziente strategische Handlungen.
Was ist der Unterschied zwischen Sprach- und Sprachenpolitik?
Die Arbeit definiert und unterscheidet diese Begriffe im Kontext der internen und externen Unternehmenskommunikation.
Welche Rolle spielt Mehrsprachigkeit in der Schweizer Bankenbranche?
Am Beispiel einer Regionalbank wird gezeigt, wie sprachliche Ressourcen genutzt werden, um Kundenbedürfnisse in einem mehrsprachigen Land zu erfüllen.
Was wurde im Dylan-Projekt untersucht?
Das Projekt analysierte die sprachliche Vielfalt und deren Management in europäischen Institutionen und Unternehmen.
Ist Mehrsprachigkeit ökonomisch vorteilhaft für Unternehmen?
Die Arbeit vergleicht Ein- und Mehrsprachigkeit anhand ökonomischer Kriterien und beleuchtet Vor- und Nachteile für die wirtschaftliche Performance.
- Arbeit zitieren
- Özge Kaya (Autor:in), 2016, Sprachenpolitik und Sprachwahl im Unternehmen am Beispiel einer mehrsprachigen Regionalbank in der Schweiz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458745