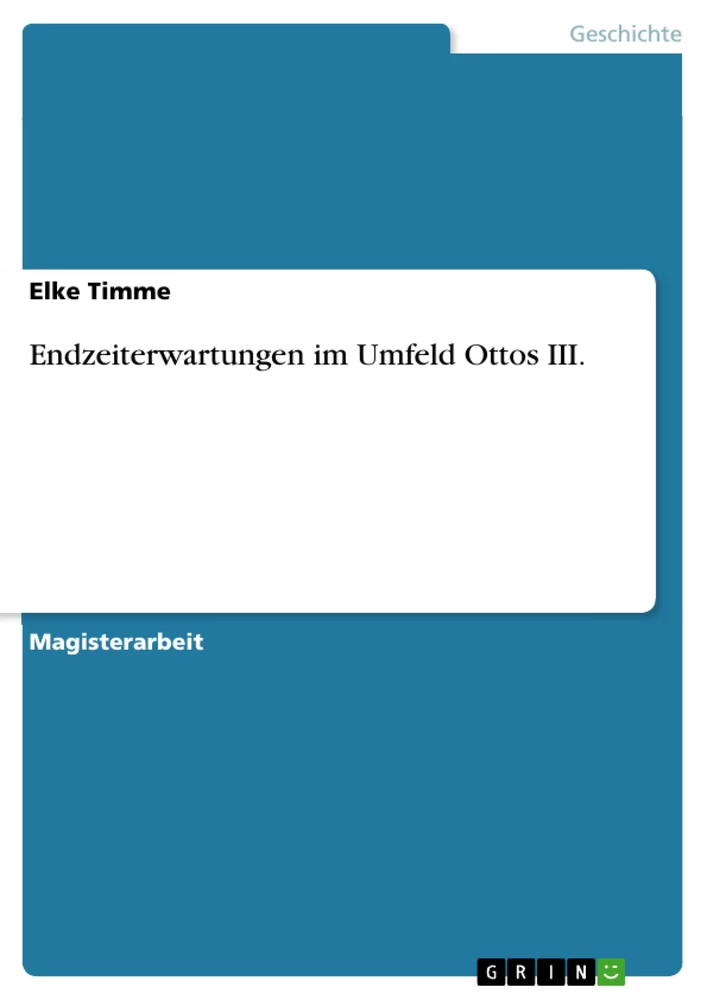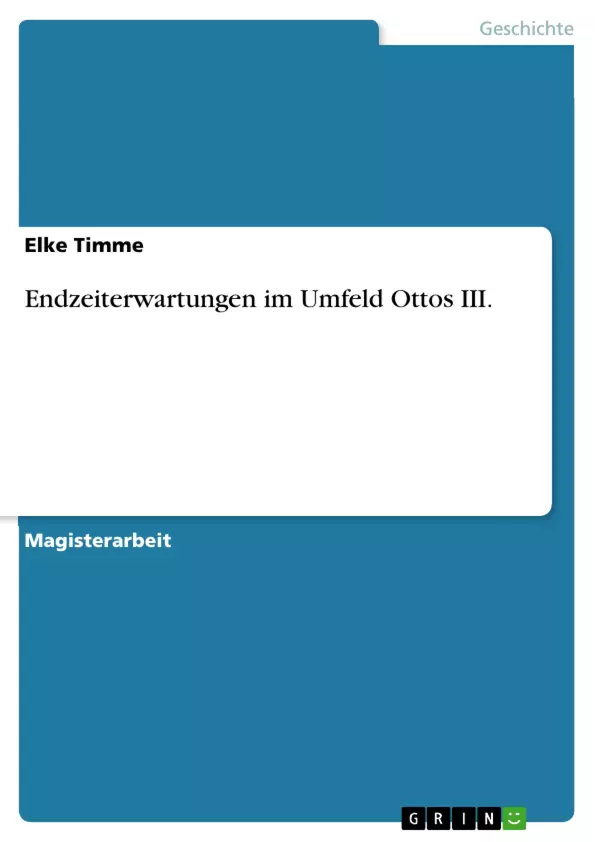Seitdem Schriftsteller der Romantik die erste nachchristliche Jahrtausendwende als eine Zeit des Schreckens beschrieben, wird das Thema der Endzeiterwartung in der ottonischen Epoche kontrovers diskutiert. Für die positivistischen Historiker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts galt jene, auch in Fachpublikationen verbreitete, Auffassung einer von den Zeitgenossen mit Angst erwarteten Zeitenwende als „längst entlarvte[r] Mythos“: Das Jahr 1000 sei ein Jahr wie jedes andere gewesen; Beweise für eine lähmende Furcht seien in den Quellen nicht zu finden.
Obwohl auch die neuesten Forschungen zum Themenbereich Apokalyptik und Jahrtausendwende mehrheitlich die Schreckensthese bestreiten, werden ihre Studien dennoch größtenteils als „neoromantischer Ersatzmythos“ abgelehnt: Desgleichen werden Vermutungen über Zusammenhänge zwischen millenaristischer Endzeiterwartung und diversen religiösen Bewegungen der Epoche, etwa aufflammenden Häresien, dem Aufschwung von Mönchtum, Reliquienverehrung und Wallfahrtswesen sowie der Gottesfriedenbewegung zurückgewiesen. Dabei wird die Debatte bis heute ausgesprochen heftig geführt.
Ähnlich kontrovers verläuft die Beurteilung Ottos III. in der Historiographie. Erst in jüngerer Zeit setzt eine Neubewertung seiner Politik und seiner Person ein. Brun von Querfurt charakterisierte ihn als einen, „der vor den Augen der Menschen Kaiser und Herrscher, in seinem Herzen und vor den Augen des Schöpfers jedoch Mönch war“. Gerade die in der älteren Forschung oftmals ausnehmend negativ bewertete Frömmigkeit des Kaisers gilt häufig als bedeutsamstes Element seiner Persönlichkeit, doch wurde sie, abgesehen von wenigen Ausnahmen, bislang keiner eigenständigen Untersuchung unterzogen. Monographien zu Otto III. klammern eschatologische Aspekte weitgehend aus; Historiker gehen in Studien zum Jahr 1000 kaum auf den Kaiser ein.
Die vorliegende Arbeit wird demgegenüber nach einem kurzen Abriß des eschatologischen Denkens um die Jahrtausendwende belegen, daß Endzeitvorstellungen im engsten Umfeld des Kaisers verbreitet waren. Anschließend wird das Handeln Ottos im Hinblick auf apokalyptische Perspektiven untersucht und abschließend die Frage erörtert, ob Otto III. durch seine Renovatio-Politik das Römische Reich als „Bollwerk“ gegen den Antichrist stärken wollte, um somit nach zeitgenössischem Verständnis das Ende der Zeiten herauszuzögern, oder ob er sich selbst als der Friedenskaiser einer bereits eingetretenen Endzeit sah.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ESCHATOLOGISCHES DENKEN UM DIE JAHRTAUSENDWENDE
- ANTICHRIST UND APOKALYPSE
- Friedenskaiser der Endzeit
- De ortu et tempore Antichristi
- DAS JAHR 1000 - INTENSIVIERUNG DER ENDZEITERWARTUNG?
- DAS UMFELD OTTOS III.
- BYZANTINISCHE EINFLÜSSE
- ERZIEHER UND RATGEBER
- Gerbert von Aurillac
- Leo von Vercelli
- HEILIGE UND EINSIEDLER
- Adalbert von Prag
- Romuald von Camaldoli
- Nilus von Rossano
- FREUNDE UND VERWANDTE
- Gregor V.
- Brun von Querfurt
- ENDZEITBEZOGENE HANDLUNGEN OTTOS III.
- SORGE UM DAS SEELENHEIL
- Bußübungen und Pilgerfahrten
- Das Versprechen des Amtsverzichtes
- Adalbertkult und der „Akt von Gnesen“
- Die Öffnung des Karlsgrabes
- RENOVATIO IMPERII ROMANORUM
- Herrschertitel Ottos III.
- Heidenmission
- Die,,Familie der Könige"
- Endzeiterwartungen in Urkunden
- SORGE UM DAS SEELENHEIL
- SCHLUBBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit dem Einfluss der Endzeitvorstellungen auf die Regierungszeit Ottos III. Die Arbeit untersucht, inwiefern das eschatologische Denken der Zeit das Handeln Ottos beeinflusste und ob er sich selbst als Friedenskaiser einer bereits eingetretenen Endzeit sah.
- Das eschatologische Denken um die Jahrtausendwende
- Die Rolle des Antichrist in den Endzeitvorstellungen
- Die Bedeutung des Jahres 1000 für die Endzeiterwartung
- Die eschatologische Dimension der Politik Ottos III.
- Die Renovatio Imperii Romanorum als Schutz gegen den Antichrist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsstand zum Thema der Endzeiterwartung um das Jahr 1000 beleuchtet. Kapitel 2 befasst sich mit dem eschatologischen Denken der Zeit und analysiert den Einfluss des Antichrist und der Apokalypse auf die damalige Gesellschaft. Kapitel 3 untersucht das Umfeld Ottos III. und dessen enge Beziehungen zu Persönlichkeiten wie Gerbert von Aurillac, Leo von Vercelli, Adalbert von Prag und Romuald von Camaldoli, die durch ihre eigenen eschatologischen Ideen geprägt waren. In Kapitel 4 wird Ottos eigenes Handeln im Hinblick auf die Endzeiterwartung analysiert. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Aktionen des Kaisers, wie z.B. seine Pilgerfahrten, seinen Adalbertkult und seine Renovatio-Politik, um zu verstehen, inwiefern er sich mit den Endzeitvorstellungen auseinandersetzte.
Schlüsselwörter
Endzeiterwartung, Jahrtausendwende, Apokalypse, Antichrist, Otto III., Renovatio Imperii Romanorum, Friedenskaiser, Eschatologie, Heiliges Römisches Reich, Religiöse Bewegungen, Byzantinische Einflüsse
Häufig gestellte Fragen
Gab es um das Jahr 1000 wirklich eine "Endzeit-Panik"?
Die "Schreckensthese" der Romantik ist umstritten; die Arbeit zeigt jedoch, dass eschatologische Vorstellungen im Umfeld Ottos III. durchaus verbreitet waren.
Wer war Otto III.?
Ein Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, bekannt für seine tiefe Frömmigkeit und sein politisches Programm der "Renovatio Imperii Romanorum".
Was bedeutet "Renovatio Imperii Romanorum"?
Die Erneuerung des Römischen Reiches. Otto III. wollte Rom wieder zum Zentrum des Reiches machen, möglicherweise auch als Bollwerk gegen den Antichrist.
Welche Rolle spielte der Antichrist in der Epoche?
Der Antichrist galt als Vorbote des Weltendes; viele religiöse Handlungen dienten dazu, sein Erscheinen hinauszuzögern oder sich darauf vorzubereiten.
Wer waren die wichtigsten Berater Ottos III.?
Dazu gehörten Gelehrte wie Gerbert von Aurillac (später Papst Silvester II.) und Heilige wie Adalbert von Prag.
Warum öffnete Otto III. das Grab Karls des Großen?
Die Öffnung im Jahr 1000 wird oft als symbolische Handlung im Kontext seiner Renovatio-Politik und seiner eschatologischen Erwartungen gedeutet.
- Quote paper
- Elke Timme (Author), 2004, Endzeiterwartungen im Umfeld Ottos III., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45880