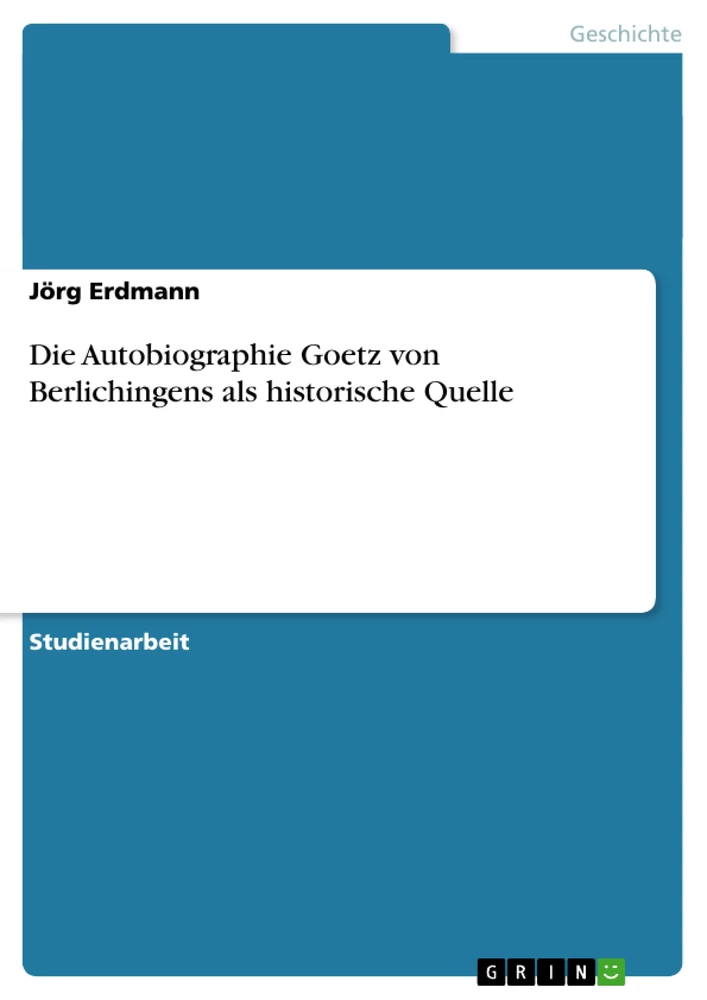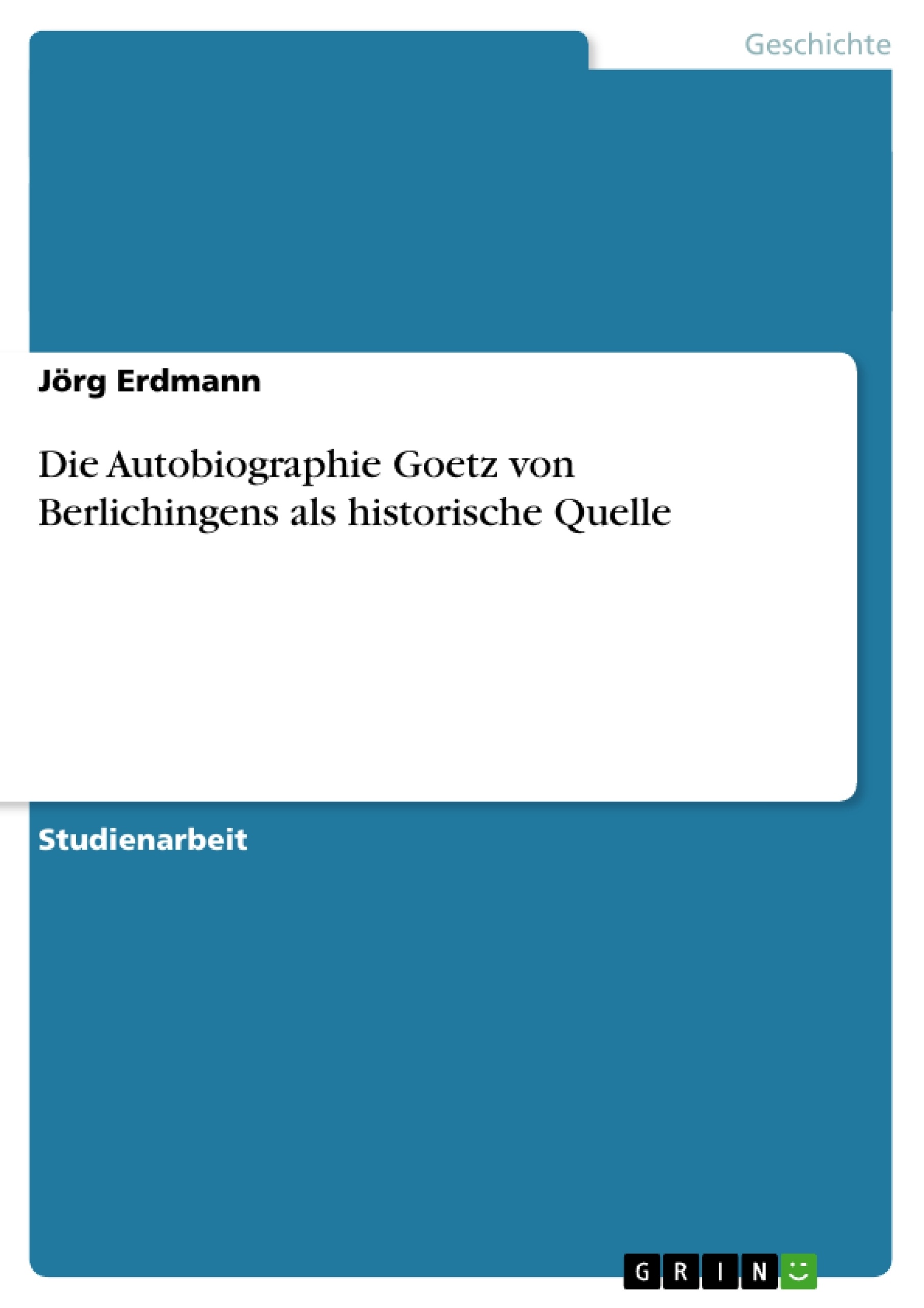Bei der Lebensbeschreibung des Ritters Götz von Berlichingen (1480 - 1562) handelt es sich um "eines der ausführlichsten autobiographischen Zeugnisse eines deutschen Ritters, welches uns bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben ist." Vom 80jährigen Ritter dem Heilbronner Stadtschreiber Stefan Feyerabend diktiert, bietet sie eine unmittelbare Darstellung der das Leben Götz von Berlichingens bestimmenden Ereignisse. Gerade durch die vom subjektiven Welt- und Lebensbild des Ritters gefärbte Art dieser Darstellung und durch die hinter der Erzählung stehende Motivation jedoch beschränkt sich dieser Einblick nicht allein auf die historische Wirklichkeit, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die psychologische Rezeption dieser historischen Wirklichkeit durch den Autor, sein Weltbild und damit das seiner zeitgenössischen Umwelt, von der ein Individuum niemals isoliert betrachtet werden kann.
Die vorliegende Arbeit versucht am Beispiel des sich in der Autobiographie niederschlagenden Selbstbildes Götz von Berlichingens die von seiner Lebensbeschreibung ausgehenden mentalitätsgeschichtlichen Schlaglichter 'einzufangen' und auszuwerten sowie am Beispiel seiner Beschreibung der Erziehungs- und Ausbildungsjahre die historische Wirklichkeit näher zu beleuchten. Sie betrachtet dabei den Quellentext im Zusammenhang mit der vorhandenen einschlägigen Forschungsliteratur.
Inhaltsverzeichnis
- Zielbestimmung
- Die Ambivalenz zwischen Mittelalter und Neuzeit in der Autobiographie Götz von Berlichingens
- Zu den Begriffen 'Mittelalter' und 'Neuzeit'
- Die der Autobiographie Götz von Berlichingens zugrundeliegende Vorstellung von Individuum und Individualität
- Die Identitätskrise Götz von Berlichingens als Vertreter des deutschen Adels im 16. Jahrhundert
- Die Lehr- und Ausbildungsjahre Götz von Berlichingens
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Autobiographie Götz von Berlichingens als historische Quelle und analysiert ihr Selbstbild im Kontext der Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit. Sie beleuchtet die mentalitätsgeschichtlichen Aspekte der Autobiographie und untersucht die Darstellung der Erziehungs- und Ausbildungsjahre des Ritters.
- Die Ambivalenz zwischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Denkstrukturen in der Autobiographie
- Das Verständnis von Individuum und Individualität im 16. Jahrhundert
- Die Darstellung der Erziehung und Ausbildung Götz von Berlichingens
- Die Autobiographie als Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts
- Die Rolle des Adels im Wandel der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Zielbestimmung: Diese Einleitung beschreibt die Autobiographie Götz von Berlichingens als eines der ausführlichsten autobiographischen Zeugnisse eines deutschen Ritters. Sie betont die subjektive Perspektive des Autors und die daraus resultierende Mischung aus historischer Wirklichkeit und psychologischer Rezeption. Die Arbeit zielt darauf ab, die mentalitätsgeschichtlichen Aspekte der Autobiographie zu analysieren und die historische Wirklichkeit anhand der Darstellung der Erziehungs- und Ausbildungsjahre zu beleuchten.
Die Ambivalenz zwischen Mittelalter und Neuzeit in der Autobiographie Götz von Berlichingens: Dieses Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten, eine scharfe Trennlinie zwischen Mittelalter und Neuzeit zu ziehen. Es argumentiert, dass der Wandel ein kontinuierlicher Prozess war, der um das 16. Jahrhundert anzusiedeln ist. Die Arbeit vergleicht mittelalterliche ständische Lebensideale mit neuzeitlichen, individualistisch geprägten Lebensvorstellungen und analysiert, wie sich diese in der Autobiographie Götz von Berlichingens widerspiegeln. Es wird untersucht, inwiefern sich in der Autobiographie Elemente des Mittelalters und der Neuzeit finden lassen, um ein umfassenderes Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts zu erlangen.
Die Lehr- und Ausbildungsjahre Götz von Berlichingens: Dieses Kapitel befasst sich mit der detaillierten Darstellung der Ausbildung des Ritters, beleuchtet die Erziehung und die prägenden Erfahrungen, die ihn zu dem Mann formten, der er wurde. Die Analyse der beschriebenen Ereignisse konzentriert sich auf die Darstellung der historischen Wirklichkeit im Kontext der damaligen Zeit. Die Ausbildung des Ritters wird hier nicht nur als individuelle Geschichte betrachtet, sondern als repräsentativ für die Ausbildung eines Adligen im späten Mittelalter und der beginnenden Neuzeit. Es wird der Versuch unternommen, die historischen Fakten mit den Erzählungen zu vergleichen und ein detailliertes Bild des Lebens eines Ritters in dieser Zeit zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Götz von Berlichingen, Autobiographie, Mittelalter, Neuzeit, Ritter, Adel, Individuum, Individualität, Mentalitätsgeschichte, Erziehung, Ausbildung, historische Quelle, Selbstbild, ständische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Autobiographie Götz von Berlichingens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Autobiographie Götz von Berlichingens als historische Quelle und untersucht ihr Selbstbild im Kontext des Übergangs zwischen Mittelalter und Neuzeit. Der Fokus liegt auf mentalitätsgeschichtlichen Aspekten und der Darstellung der Erziehungs- und Ausbildungsjahre des Ritters.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ambivalenz zwischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Denkstrukturen in der Autobiographie, das Verständnis von Individuum und Individualität im 16. Jahrhundert, die Darstellung der Erziehung und Ausbildung Götz von Berlichingens, die Autobiographie als Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts und die Rolle des Adels im Wandel der Zeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Zielsetzung, die Auseinandersetzung mit der Ambivalenz zwischen Mittelalter und Neuzeit in der Autobiographie, die Betrachtung der Lehr- und Ausbildungsjahre Götz von Berlichingens und eine Schlussbemerkung. Sie enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Was wird in der Einleitung (Zielbestimmung) erläutert?
Die Einleitung beschreibt die Autobiographie Götz von Berlichingens als eines der ausführlichsten autobiographischen Zeugnisse eines deutschen Ritters. Sie betont die subjektive Perspektive des Autors und das Ziel, die mentalitätsgeschichtlichen Aspekte der Autobiographie zu analysieren und die historische Wirklichkeit anhand der Darstellung der Erziehungs- und Ausbildungsjahre zu beleuchten.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zur Ambivalenz zwischen Mittelalter und Neuzeit?
Dieses Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten, eine scharfe Trennlinie zwischen Mittelalter und Neuzeit zu ziehen. Es analysiert, wie sich mittelalterliche und neuzeitliche Denkstrukturen in der Autobiographie widerspiegeln und vergleicht mittelalterliche ständische Lebensideale mit neuzeitlichen, individualistisch geprägten Lebensvorstellungen.
Was ist der Inhalt des Kapitels über die Lehr- und Ausbildungsjahre Götz von Berlichingens?
Dieses Kapitel analysiert detailliert die Ausbildung des Ritters, beleuchtet seine Erziehung und prägenden Erfahrungen. Die Analyse betrachtet die Ausbildung nicht nur als individuelle Geschichte, sondern als repräsentativ für die Ausbildung eines Adligen im späten Mittelalter und der beginnenden Neuzeit. Es wird versucht, historische Fakten mit den Erzählungen zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Götz von Berlichingen, Autobiographie, Mittelalter, Neuzeit, Ritter, Adel, Individuum, Individualität, Mentalitätsgeschichte, Erziehung, Ausbildung, historische Quelle, Selbstbild, ständische Gesellschaft.
- Citation du texte
- Jörg Erdmann (Auteur), 1995, Die Autobiographie Goetz von Berlichingens als historische Quelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45882