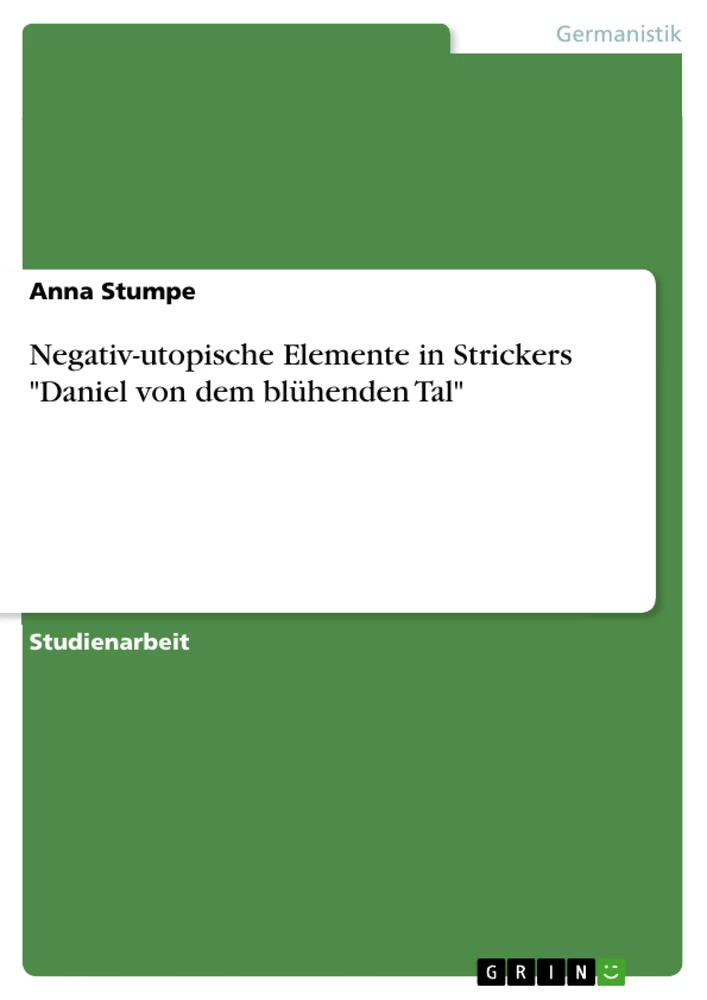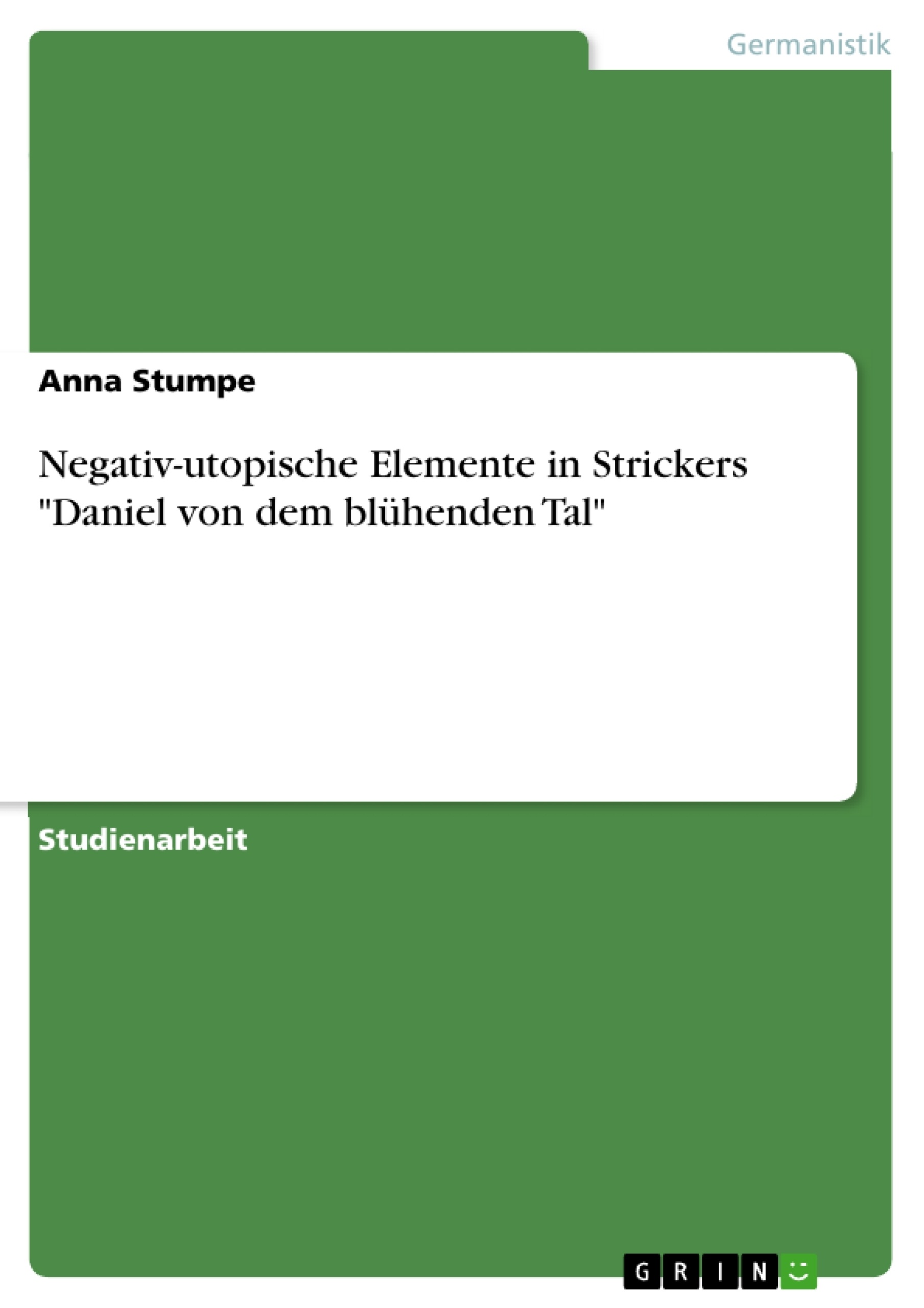Die Konstruktion der Gesellschaftsordnung in Cluse sowie der Herrscherpersönlichkeit König Maturs erscheint als diametral entgegengesetzter Entwurf zur idealtypisch beschriebenen Gesellschaftsordnung am Artushof. Betrachtet man Cluse also als negativ-utopischen Entwurf einer Lebenswelt, deutet die extreme Kontradiktion zum Artushof darauf hin, dass es sich bei dieser demgegenüber um eine positiv-utopische Darstellung handeln muss. Folglich erscheinen beide Herrschaftsformen und – gebiete gleichermaßen als mittelalterliche Utopien.
Um diese Vermutungen zu stützen, beleuchtet diese Arbeit relevante Textpassagen des Stricker-Romans, um die Eigenschaften König Maturs sowie seines Herrschaftsgebiets Cluses, notwendigerweise auch immer im unmittelbaren Vergleich mit Artus und dem Artushof, herauszuarbeiten.
Dabei geht es auch um Herkunft, Geschichte und Definition des Utopiebegriffs sowie darum zu ergründen, wie sich utopisches Denken im Mittelalter gestaltete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gibt es utopisches Denken im Mittelalter? Zu Herkunft, Geschichte und Definitionen des Utopiebegriffs
- Herkunft und Geschichte
- Definitionen
- König Matur und das Reich Cluse als negativ-utopische Elemente in Strickers Daniel von dem blühenden Tal
- Topographie
- Gesellschaftsordnung
- Herrscherpersönlichkeit König Maturs
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, inwieweit der Utopiebegriff auf die mittelalterliche Literatur anwendbar ist, und analysiert den vom Stricker verfassten Roman "Daniel von dem blühenden Tal" unter dem Aspekt der negativen Utopie. Dabei wird besonders auf die Konstruktionen der Herrschergestalt König Maturs und dessen Königreichs Cluse eingegangen.
- Anwendbarkeit des Utopiebegriffs auf mittelalterliche Literatur
- Negative Utopie in "Daniel von dem blühenden Tal"
- Analyse von König Matur und dem Reich Cluse
- Vergleich mit dem Artushof als potentiell positiv-utopischer Gegenentwurf
- Kritik an der zeitgenössischen Gesellschaftsordnung und der literarischen Verarbeitung des Artus-Mythos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der utopischen Literatur ein und beleuchtet die Kontroverse um den Utopiebegriff im Mittelalter. Sie stellt die Forschungsfrage auf, ob "Daniel von dem blühenden Tal" als negative Utopie interpretiert werden kann, wobei insbesondere die Gesellschaftsordnung in Cluse und die Herrscherpersönlichkeit König Maturs im Vergleich zum Artushof analysiert werden sollen.
Kapitel 2 befasst sich mit der Begriffsgeschichte des Utopiebegriffs. Es werden die Entstehung des klassischen Utopiebegriffs in der Frühen Neuzeit und dessen Verbindung zum Roman "Utopia" von Thomas Morus erläutert. Darüber hinaus wird diskutiert, ob bereits antike und mittelalterliche Texte als Vorläufer des Utopiebegriffs gelten können.
Kapitel 3 analysiert die topografischen, gesellschaftspolitischen und herrschaftlichen Aspekte von König Maturs und dem Reich Cluse in "Daniel von dem blühenden Tal". Es wird untersucht, inwiefern diese Elemente als negativ-utopische Elemente im Vergleich zum Artushof gelten können.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Utopiebegriff, mittelalterliche Literatur, negative Utopie, "Daniel von dem blühenden Tal", König Matur, Reich Cluse, Artus-Mythos, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von Strickers "Daniel von dem blühenden Tal"?
Die Arbeit analysiert den mittelalterlichen Roman unter dem Aspekt negativ-utopischer Elemente, insbesondere im Hinblick auf das Reich Cluse und König Matur.
Warum wird das Reich Cluse als negative Utopie betrachtet?
Cluse wird als diametral entgegengesetzter Entwurf zum idealtypischen Artushof dargestellt, was auf eine Kritik an bestimmten Herrschaftsformen und Gesellschaftsordnungen hindeutet.
Gab es im Mittelalter bereits utopisches Denken?
Obwohl der Begriff "Utopie" erst in der Frühen Neuzeit durch Thomas Morus geprägt wurde, untersucht die Arbeit, wie sich ähnliche Denkstrukturen bereits in mittelalterlichen Texten gestalteten.
Wie wird König Matur im Vergleich zu Artus charakterisiert?
Die Arbeit beleuchtet die Herrscherpersönlichkeit Maturs als Kontrastbild zum positiven Vorbild des Königs Artus, um die negativ-utopische Dimension zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt die Topographie in der Erzählung?
Die räumliche Gestaltung und Beschreibung des Reiches Cluse dient als wichtiges Element, um die Andersartigkeit und die utopischen (bzw. dystopischen) Züge der Lebenswelt hervorzuheben.
- Citation du texte
- Anna Stumpe (Auteur), 2015, Negativ-utopische Elemente in Strickers "Daniel von dem blühenden Tal", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458890