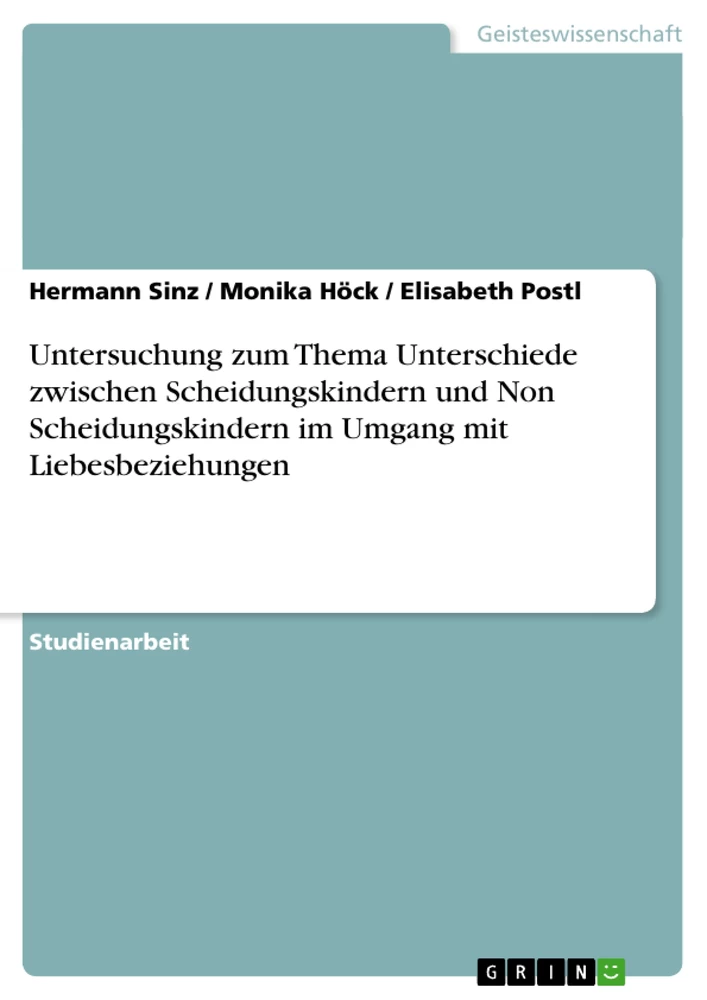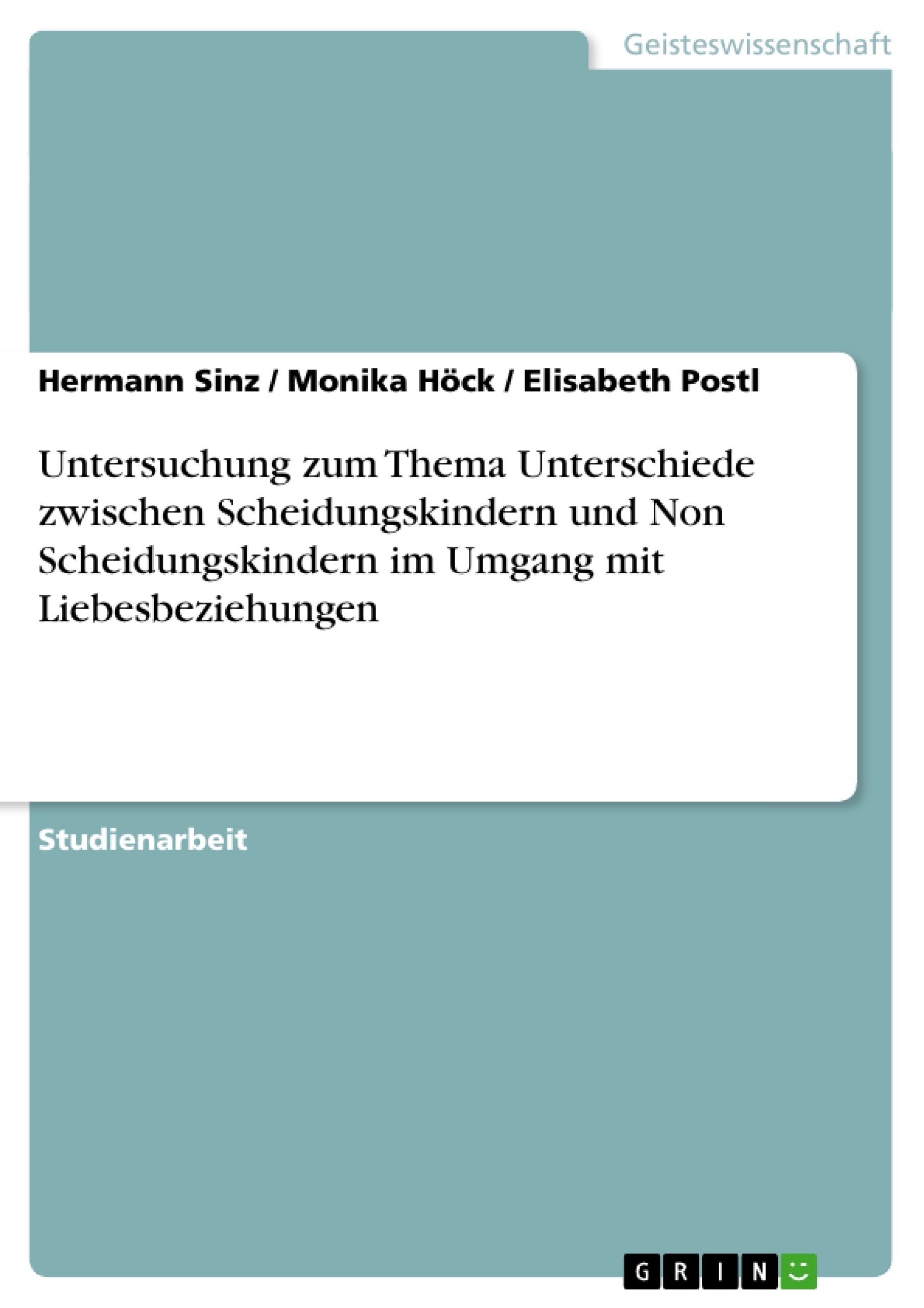Immer mehr Menschen lassen sich in den westlichen Industrienationen scheiden. Dieser Trend scheint unaufhaltsam. In deutschsprachigen Ländern wird etwa jede dritte Ehe geschieden, in den Großstädten der USA schon jede zweite. Aus diesem Grund kommt fast jeder mit dem Thema Scheidung in Berührung: als Kind geschiedener Eltern; als guter Freund von jemandem aus einer gescheiterten Ehe; als Mann oder Ehefrau von jemandem, dessen Eltern geschieden wurden oder sich mit dem Gedanken tragen etc.
Die Scheidung ist nicht nur als simples, normales Ereignis zu sehen, sondern als Prozess, der schon lange vor der Trennung beginnt und mit der Trennung noch lange nicht beendet ist. Somit haben die Folgen der Scheidung Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kinder.
Entgegen heutiger Erkenntnisse war in den späten Sechzigern und in den Siebzigern der Glaube verbreitet, dass die ersten zwei Jahre nach einer Trennung für die Familienmitglieder von Bedeutung sind, diese Zeit voller Anpassungen und Veränderungen, Wut und Trauer. Damals waren einige Therapeuten zuversichtlich, dass die Kinder nach der ersten Phase damit zurechtkämen, dass sie in der Lage sein würden, die Scheidung hinter sich zu lassen und ihr Leben produktiv zu gestalten.
Jedoch wiesen darauffolgende Untersuchungen auf Langzeitfolgen einer Scheidung hin. Eine der bedeutendsten Studien wurde von Dr. Judith WALLERSTEIN in Kalifornien
durchgeführt. Diese ergab, dass eine Scheidung nicht nur voraussagbare Auswirkungen auf die Kinder hat, sondern auch einen Schatten ins Erwachsenenleben hineinwirft und Einfluss auf die Fähigkeit hat, das Leben selbständig zu gestalten. Scheidungskinder gehen als Erwachsene Liebesbeziehungen mit dem Gefühl ein, schlechte Karten zu haben.
Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse ist die Hypothese naheliegend, dass es Unterschiede zwischen Scheidungskinder und Non-Scheidungskinder im Umgang mit Liebesbeziehungen gibt.
Diese Unterschiede wollen wir anhand der Bindungsstile nach BARTOHOLOMEW & HOROWITZ und anhand von allgemeinen Fragen zum Thema „Liebesbeziehungen“ feststellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ehescheidung
- Die Entwicklung in der Scheidungsforschung
- Scheidungsfolgen für die Kinder
- Kurz- und mittelfristige Folgen
- Langzeitfolgen
- Die Bindungstheorie
- Konzeption der Bindungstheorie
- Entwicklung des Bindungsverhaltens beim Menschen
- Inneres Arbeitsmodell und Bindungsstil
- Klinische Bedeutung der Bindungstheorie
- Perspektiven und Hypothesen von Paul R. Amato
- Die „Eltern-Verlust-Perspektive“
- Die „Eltern-Anpassungs-Perspektive“
- Die „Eltern-Konflikt-Perspektive“
- Die „Ökonomische-Härte-Perspektive“
- Die „Lebens-Stress-Perspektive“
- Die „Eltern-Beziehungs-Perspektive“
- Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Unterschiede mithilfe der Bindungstheorie nach Bartholomew & Horowitz und anhand allgemeiner Fragen zu Liebesbeziehungen zu identifizieren und die zugrundeliegenden Ursachen zu analysieren. Die Perspektiven und Hypothesen von Amato bilden die Grundlage für die Ursachenforschung.
- Auswirkungen von Scheidung auf Kinder
- Bindungstheorie und deren Relevanz für Liebesbeziehungen
- Vergleich von Bindungsstilen bei Kindern aus geschiedenen und intakten Familien
- Analyse der Ursachen für Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen
- Anwendung der Perspektiven von Amato auf die Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie den steigenden Trend der Scheidungsraten in westlichen Industrienationen beleuchtet und auf die weitreichenden Folgen für Kinder hinweist. Sie führt in die Thematik ein und verweist auf die Bedeutung von Langzeitfolgen von Scheidung, die weit über die anfängliche Anpassungsphase hinausreichen. Die Arbeit formuliert die Hypothese, dass signifikante Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien bestehen und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die auf der Bindungstheorie und den Perspektiven Amato basiert.
Die Ehescheidung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Scheidungsforschung. Es beschreibt den Wandel von der Ursachenforschung hin zu einer Fokussierung auf die Folgen der Scheidung, insbesondere für Kinder. Der Kapitelteil „Die Entwicklung in der Scheidungsforschung“ untersucht den historischen Kontext und die soziologischen Faktoren, die zum Anstieg der Scheidungsraten beigetragen haben. „Scheidungsfolgen für die Kinder“ beleuchtet sowohl kurz- als auch langfristige Auswirkungen auf Kinder, wobei die Grenzen und ideologischen Einflüsse in der Scheidungsforschung kritisch reflektiert werden. Die Diskussion reicht von den unmittelbaren Reaktionen der Kinder (Trauer, Angst, Verunsicherung) bis hin zu komplexeren Langzeitfolgen, die deren zukünftige Beziehungen beeinflussen können.
Die Bindungstheorie: Dieses Kapitel präsentiert die Bindungstheorie als theoretisches Fundament der Arbeit. Es erläutert die Konzeption der Bindungstheorie, ihren historischen Hintergrund und die evolutionäre Funktion von Bindungsverhalten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Bindungsverhaltens vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter, inklusive der Konzepte der mütterlichen Feinfühligkeit und des inneren Arbeitsmodells. Der klinische Bezug der Bindungstheorie wird ebenfalls behandelt, insbesondere im Hinblick auf abweichende Entwicklungsverläufe. Das Kapitel liefert das nötige Wissen, um die Ergebnisse der Studie im Kontext der Bindungsstile zu verstehen.
Perspektiven und Hypothesen von Paul R. Amato: Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Perspektiven Amato's zur Erklärung der Auswirkungen von Scheidung auf Kinder vor. Es beschreibt detailliert die „Eltern-Verlust-Perspektive“, die „Eltern-Anpassungs-Perspektive“, die „Eltern-Konflikt-Perspektive“, die „Ökonomische-Härte-Perspektive“, die „Lebens-Stress-Perspektive“ und die „Eltern-Beziehungs-Perspektive“. Jede Perspektive wird im Detail erläutert, wobei ihre Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Erklärung von Langzeitfolgen der Scheidung auf Kinder herausgestellt werden. Dieses Kapitel liefert ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Faktoren, die die Auswirkungen von Scheidung beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Scheidung, Scheidungskinder, Non-Scheidungskinder, Liebesbeziehungen, Bindungstheorie, Bindungsstile, Bartholomew & Horowitz, Paul R. Amato, Langzeitfolgen, Familienkonflikte, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Auswirkungen von Scheidung auf Liebesbeziehungen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien. Sie analysiert diese Unterschiede mithilfe der Bindungstheorie nach Bartholomew & Horowitz und anhand allgemeiner Fragen zu Liebesbeziehungen. Die Perspektiven und Hypothesen von Amato bilden die Grundlage für die Ursachenforschung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen von Scheidung auf Kinder, die Bindungstheorie und deren Relevanz für Liebesbeziehungen, einen Vergleich von Bindungsstilen bei Kindern aus geschiedenen und intakten Familien, die Analyse der Ursachen für Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen und die Anwendung der Perspektiven von Amato auf die Thematik.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Haupttheorie, auf der die Arbeit basiert, ist die Bindungstheorie nach Bartholomew & Horowitz. Zusätzlich werden die Perspektiven und Hypothesen von Paul R. Amato zur Erklärung der Auswirkungen von Scheidung auf Kinder herangezogen. Diese Perspektiven umfassen die „Eltern-Verlust-Perspektive“, die „Eltern-Anpassungs-Perspektive“, die „Eltern-Konflikt-Perspektive“, die „Ökonomische-Härte-Perspektive“, die „Lebens-Stress-Perspektive“ und die „Eltern-Beziehungs-Perspektive“.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Die Ehescheidung (inkl. Entwicklung der Scheidungsforschung und Scheidungsfolgen für Kinder), Die Bindungstheorie (inkl. Konzeption, Entwicklung des Bindungsverhaltens, Inneres Arbeitsmodell und Bindungsstil, Klinische Bedeutung), Perspektiven und Hypothesen von Paul R. Amato und Fragestellung. Jedes Kapitel liefert wichtige Hintergrundinformationen und Erkenntnisse zum Thema.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Kapitelzusammenfassung?
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und formuliert die Hypothese, dass signifikante Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien bestehen. Das Kapitel „Die Ehescheidung“ analysiert die Entwicklung der Scheidungsforschung und deren Folgen für Kinder. Das Kapitel „Die Bindungstheorie“ erläutert die Theorie als theoretisches Fundament. Das Kapitel „Perspektiven und Hypothesen von Paul R. Amato“ beschreibt verschiedene Perspektiven zur Erklärung der Auswirkungen von Scheidung auf Kinder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Scheidung, Scheidungskinder, Non-Scheidungskinder, Liebesbeziehungen, Bindungstheorie, Bindungsstile, Bartholomew & Horowitz, Paul R. Amato, Langzeitfolgen, Familienkonflikte, Entwicklungspsychologie.
Welche Hypothese wird in der Arbeit aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass signifikante Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien bestehen.
Welche Methode wird zur Untersuchung der Hypothese verwendet?
Die Arbeit verwendet die Bindungstheorie und die Perspektiven von Amato als methodische Grundlage zur Analyse der Unterschiede im Umgang mit Liebesbeziehungen zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien.
- Citar trabajo
- Hermann Sinz (Autor), Monika Höck (Autor), Elisabeth Postl (Autor), 2002, Untersuchung zum Thema Unterschiede zwischen Scheidungskindern und Non Scheidungskindern im Umgang mit Liebesbeziehungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45891