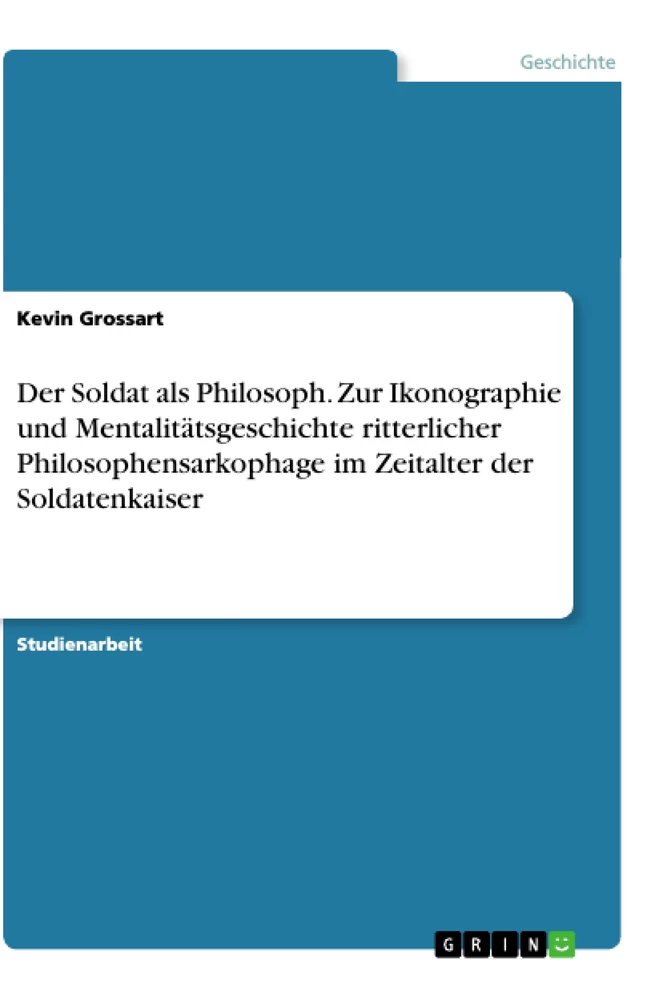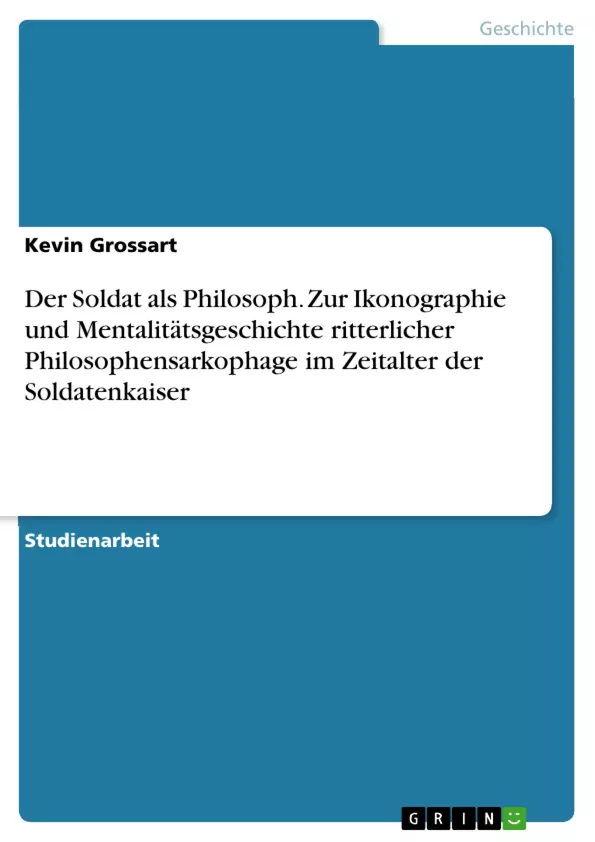Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Ikonographie und der Mentalitätsgeschichte von römischen, ritterlichen Philosophensarkophagen im Zeitalter der Soldatenkaiser.
Die Zeit der sogenannten "Reichskrise des 3. Jahrhunderts" stellte das Imperium Romanum vor enorme Krisen in der Außen- und Innenpolitik. Während sich die Kämpfe mit den germanischen Stämmen im Norden intensivierten, und sich im Osten des Reiches nach den Parthern eine neue Gefahr durch den Aufstieg des Sassanidenreiches manifestierte, gelang es den römischen Rittern, den Equites, in immer machtvollere politische Positionen durch ihren Dienst im Heer aufzusteigen.
In dieser turbulenten Zeit entstanden jedoch auch zahlreiche handwerklich aufwendige Sarkophage mit Darstellungen römischer Ritter im philosophischen Habitus. In dieser Arbeit soll daher der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich der höhergestellte römische Soldat des 3. Jahrhunderts. mit der Philosophie identifizieren konnte, aus welchen Gründen er sich das Motiv des Philosophen zur Selbstrepräsentation für die Ewigkeit erwählte und wie sich antike Philosophie und Soldatentum verbinden lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Quellenlage
- 1.3 Forschungsstand
- 2.1 Die ikonographischen Besonderheiten der ritterlichen Philosophensarkophage
- 2.2 Der sog. Plotinsarkophag
- 2.3 Der sog. Musen-Philosophen-Sarkophag Torlonia
- 2.4 Die Riefelsarkophage
- 2.5 Die Inschriften
- 3. Der Soldat als Philosoph? Überlegungen zur Mentalitätsgeschichte der ritterlichen Philosophensarkophage des 3. Jhs.
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ikonographischen Besonderheiten und die Mentalitätsgeschichte der ritterlichen Philosophensarkophage des 3. Jahrhunderts n. Chr. im römischen Reich. Dabei soll die Frage geklärt werden, inwieweit sich der höhergestellte römische Soldat mit der Philosophie identifizieren konnte und aus welchen Gründen er sich das Motiv des Philosophen zur Selbstrepräsentation für die Ewigkeit erwählte.
- Die ikonographischen Merkmale der ritterlichen Philosophensarkophage
- Die Rolle des römischen Militärs und der Soldatenkaiser im 3. Jahrhundert
- Die Verbindung zwischen Philosophie und Soldatentum im römischen Reich
- Die Mentalitätsgeschichte der ritterlichen Philosophensarkophage
- Die Bedeutung der Inschriften für die Interpretation der Sarkophage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Zeit der „Reichskrise“ im 3. Jahrhundert, die den Aufstieg des Militärs und die Soldatenkaiser hervorbrachte. Die Quellenlage und der Forschungsstand werden in den Kapiteln 1.2 und 1.3 beleuchtet. Kapitel 2 befasst sich mit der ikonographischen Analyse ausgewählter Philosophensarkophage, wobei die Darstellung des Philosophen, die Inschriften und die Rolle des Schuhwerks im Kontext des Ritterstandes beleuchtet werden. Kapitel 3 geht der Frage nach der Verbindung zwischen Philosophie und Heer im 3. Jahrhundert nach und analysiert die Mentalitätsgeschichte der Philosophensarkophage.
Schlüsselwörter
Philosophensarkophage, Ritter, Soldatenkaiser, 3. Jahrhundert, römisches Reich, Ikonographie, Mentalitätsgeschichte, Philosophie, Militär, Inschriften, Calceus Equester, Topos des „Intellektuellen“.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "ritterliche Philosophensarkophage"?
Es handelt sich um römische Steinsärge des 3. Jahrhunderts, auf denen hochgestellte Soldaten (Equites) in der Kleidung und Pose von Philosophen dargestellt wurden.
Warum ließen sich Soldaten als Philosophen darstellen?
In der krisenhaften Zeit der Soldatenkaiser diente das Motiv zur Selbstrepräsentation von Bildung, Weisheit und moralischer Integrität (Topos des Intellektuellen).
Was ist der "Plotinsarkophag"?
Ein berühmtes Beispiel eines Philosophensarkophags, das in der Arbeit ikonographisch analysiert wird und die Verbindung von geistigem Leben und sozialem Stand illustriert.
Welche Bedeutung hat das Schuhwerk (Calceus Equester) auf den Darstellungen?
Das spezifische Schuhwerk dient als Standesabzeichen der römischen Ritter (Equites) und identifiziert den Dargestellten trotz Philosophenmantel eindeutig als Mitglied der Elite.
Wie war die politische Lage im 3. Jahrhundert n. Chr.?
Das Imperium Romanum befand sich in der "Reichskrise", geprägt von Kämpfen gegen Germanen und Sassaniden sowie dem machtpolitischen Aufstieg des Heeres.
Lassen sich antikes Soldatentum und Philosophie vereinbaren?
Die Arbeit untersucht genau diesen Widerspruch und zeigt auf, dass Philosophie für die Offiziersschicht ein Mittel zur Distinktion und inneren Festigung war.
- Citation du texte
- Kevin Grossart (Auteur), 2015, Der Soldat als Philosoph. Zur Ikonographie und Mentalitätsgeschichte ritterlicher Philosophensarkophage im Zeitalter der Soldatenkaiser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458987