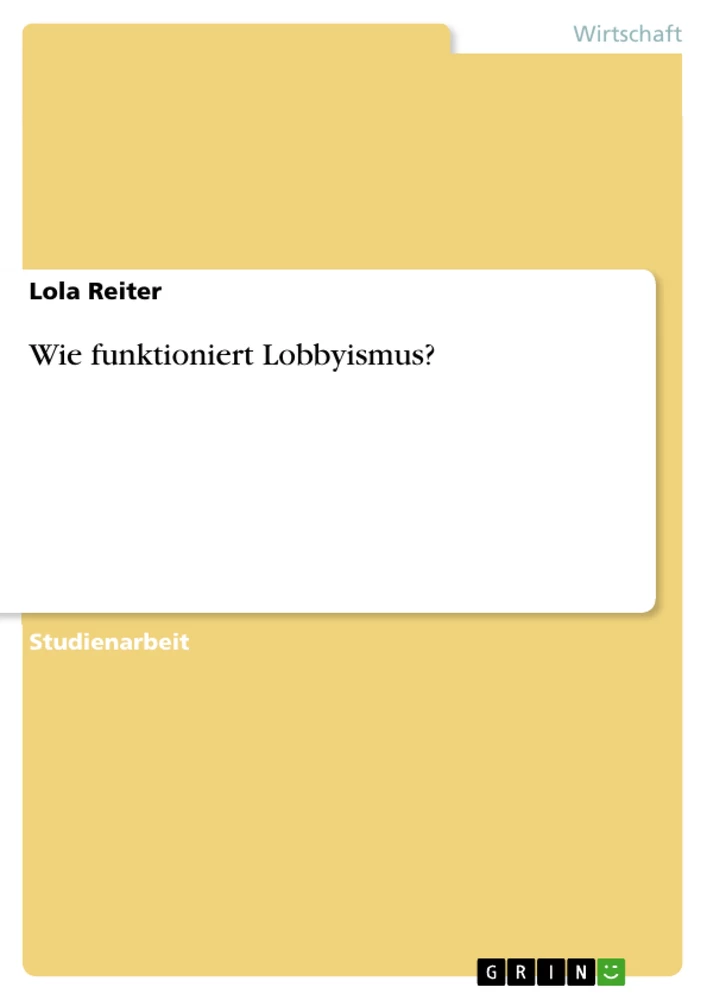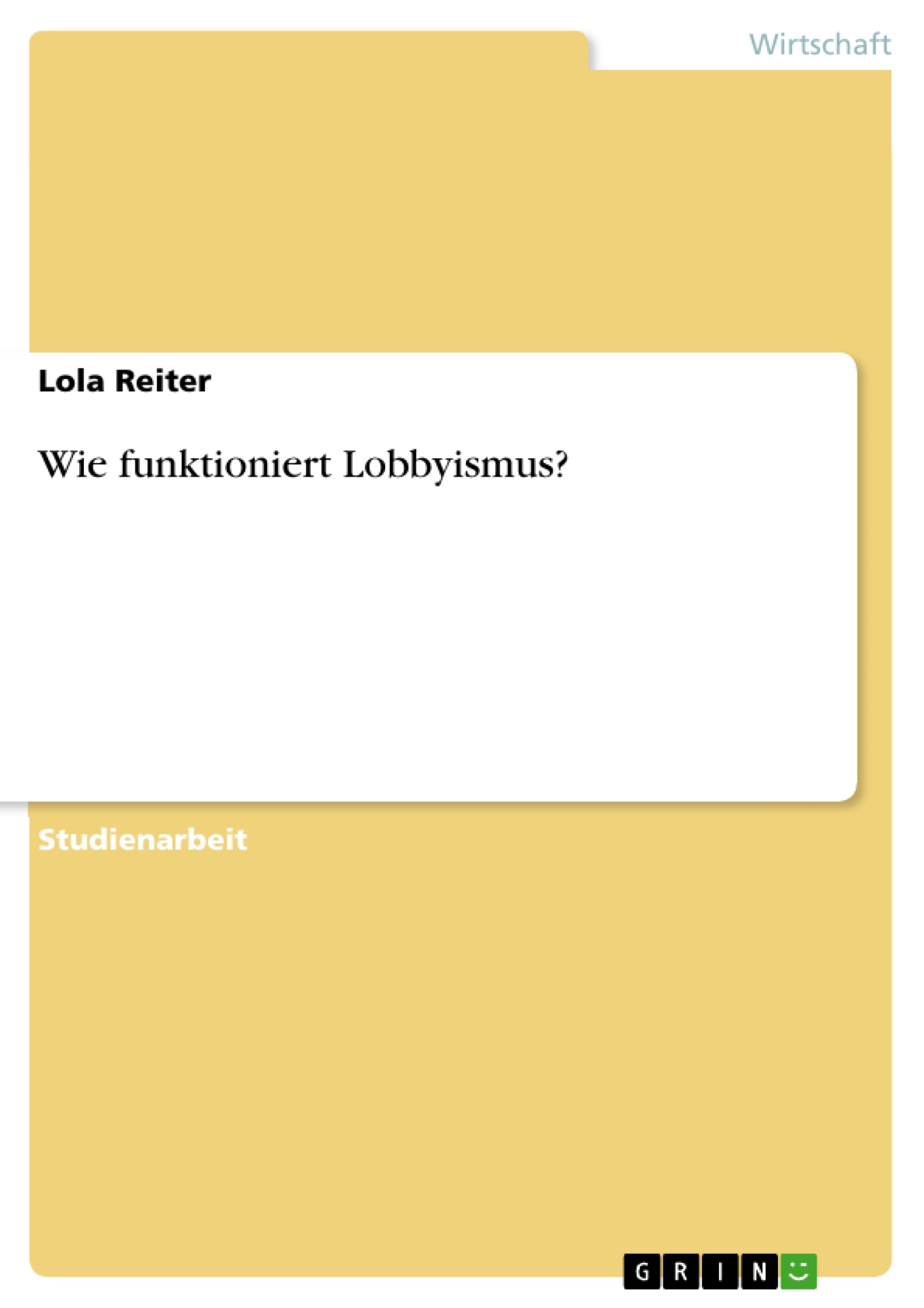Lobbyismus wird heutzutage als die stille fünfte Gewalt bezeichnet. Lange Zeit wurde es als Betrug angesehen, doch mittlerweile haben sich Arbeitsstruktur und Arbeitsstil im Lobbyismus so sehr gewandelt und weiterentwickelt, dass Lobbyismus mittlerweile als professionell gelten kann. Doch welchen Zweck erfüllt diese Maßnahme zur Vermittlung der Interessen in der Politik?
Zur Beantwortung dieser Frage wird der Begriff Lobbying ausführlich definiert und es wird diskutiert, wie Lobbying zu Stande kommt. Zudem wird die Frage beantwortet, welche Rollen Lobbying in der Gesellschaft einnimmt. Schließlich wird einen Überblick über die Arten und Akteure sowie die Instrumente von Lobbying gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Lobbying
- 2.1 Definition
- 2.2 Lobbying und Interessenvertretung
- 2.3 Lobbying als Tauschprozess
- 3. Arten - Akteure - Instrumente von Lobbying
- 3.1 Arten
- 3.2 Akteure
- 3.3 Instrumente
- 4. Fallbeispiel: Hebammen in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen des Lobbyismus in Deutschland. Sie definiert den Begriff, beleuchtet verschiedene Arten und Akteure sowie die eingesetzten Instrumente. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die Praxis des Lobbyings. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des Lobbyismus zu vermitteln.
- Definition und Abgrenzung von Lobbying
- Arten und Akteure im Lobbying-Prozess
- Instrumente und Methoden des Lobbyismus
- Die Rolle von Interessenvertretung im Lobbying
- Analyse eines konkreten Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt Lobbyismus als die „stille fünfte Gewalt“ und beleuchtet dessen Professionalisierung. Sie hebt die Zunahme von Lobbyisten in Berlin seit dem Umzug des Bundestages und der Bundesregierung hervor, mit einer Schätzung von etwa 4.500 Lobbyisten, die eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, wobei Kapitel 2 den Begriff Lobbying definiert, Kapitel 3 einen Überblick über Arten, Akteure und Instrumente gibt, und die Arbeit im Anschluss die Erkenntnisse zusammenfasst.
2. Was ist Lobbying: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Definition von Lobbying, beginnend mit der etymologischen Herleitung des Begriffs „Lobby“ aus dem Lateinischen. Es wird die Schwierigkeit einer präzisen Definition aufgrund der verschiedenen Interpretationen herausgestellt, wobei die Arbeit auf verschiedene Definitionen, einschließlich der von Milibrath als Kommunikationsprozess zur Beeinflussung politischer Entscheidungen, eingeht. Der mehrdeutige Ruf von Lobbying in Deutschland und die Spannung zwischen legitimer Interessenvertretung und illegitimer Einflussnahme werden ebenfalls diskutiert. Die Notwendigkeit von Interessen und Interessengruppen als Grundlage für Lobbying wird betont, mit dem Hinweis auf die Rolle von Interessen als Impulsgeber für politische Vorgänge.
3. Arten - Akteure - Instrumente von Lobbying: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die verschiedenen Arten von Lobbying, die beteiligten Akteure und die eingesetzten Instrumente. Es bietet eine detaillierte Analyse der unterschiedlichen Strategien und Methoden, die Lobbyisten zur Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse verwenden. Die Vielfalt der Akteure, von Verbänden über Unternehmen bis hin zu spezialisierten Agenturen, wird ebenso beleuchtet wie die Bandbreite der eingesetzten Instrumente, die von direktem Kontakt bis hin zu indirekten Einflussnahmemethoden reichen. Die Kapitelstruktur und die gegebenen Beispiele verdeutlichen die Komplexität des Lobbying-Prozesses und seine Bedeutung im politischen System.
4. Fallbeispiel: Hebammen in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert ein detailliertes Fallbeispiel, das die praktischen Aspekte und Herausforderungen von Lobbying im Kontext der Situation von Hebammen in Deutschland veranschaulicht. Es analysiert die konkreten Strategien und Aktionen, die vom Deutschen Hebammenverband und anderen Interessengruppen eingesetzt werden, um ihre Anliegen im politischen System durchzusetzen. Die Analyse soll die in den vorherigen Kapiteln diskutierten theoretischen Konzepte veranschaulichen und ein tiefergehendes Verständnis für die praktische Anwendung von Lobbying-Techniken ermöglichen.
Schlüsselwörter
Lobbying, Interessenvertretung, Lobbyismus, politische Einflussnahme, Akteure, Instrumente, Fallbeispiel, Hebammen, Deutschland, Interessen, Politik, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Lobbying in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Phänomen des Lobbyismus in Deutschland. Sie umfasst eine Definition des Begriffs Lobbying, eine Analyse verschiedener Arten und Akteure sowie der eingesetzten Instrumente. Ein Fallbeispiel zu Hebammen in Deutschland veranschaulicht die praktische Anwendung von Lobbying-Techniken. Die Arbeit zielt auf ein umfassendes Verständnis des Lobbyismus ab.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Lobbying, Arten und Akteure im Lobbying-Prozess, Instrumente und Methoden des Lobbyismus, die Rolle der Interessenvertretung im Lobbying und die Analyse eines konkreten Fallbeispiels (Hebammen in Deutschland).
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den Begriff Lobbyismus einführt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Es folgen Kapitel zu Definition und Abgrenzung von Lobbying, Arten, Akteure und Instrumente von Lobbying, und ein Kapitel mit einem Fallbeispiel zu Hebammen in Deutschland. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was ist die Definition von Lobbying laut dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit diskutiert verschiedene Definitionen von Lobbying, einschließlich der Schwierigkeit, eine präzise Definition zu finden aufgrund unterschiedlicher Interpretationen. Sie beleuchtet die ethischen und rechtlichen Aspekte, den Unterschied zwischen legitimer Interessenvertretung und illegitimer Einflussnahme, und betont die Rolle von Interessen und Interessengruppen als Grundlage für Lobbying.
Welche Akteure und Instrumente des Lobbyings werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Akteure im Lobbying-Prozess, von Verbänden und Unternehmen bis hin zu spezialisierten Agenturen. Es werden verschiedene Instrumente und Strategien beschrieben, die Lobbyisten zur Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse einsetzen, von direktem Kontakt bis hin zu indirekten Einflussnahmemethoden.
Welches Fallbeispiel wird in der Seminararbeit behandelt?
Das Fallbeispiel konzentriert sich auf die Situation von Hebammen in Deutschland und analysiert die Strategien und Aktionen des Deutschen Hebammenverbandes und anderer Interessengruppen, um ihre Anliegen im politischen System durchzusetzen. Es dient dazu, die theoretischen Konzepte der vorherigen Kapitel zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lobbying, Interessenvertretung, Lobbyismus, politische Einflussnahme, Akteure, Instrumente, Fallbeispiel, Hebammen, Deutschland, Interessen, Politik, Gesellschaft.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Anfang der Seminararbeit und listet die einzelnen Kapitel und Unterkapitel auf (Einleitung, Was ist Lobbying?, Arten - Akteure - Instrumente von Lobbying, Fallbeispiel: Hebammen in Deutschland, Fazit).
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des Lobbyismus in Deutschland zu vermitteln, indem sie den Begriff definiert, verschiedene Arten und Akteure beleuchtet und die eingesetzten Instrumente analysiert. Ein Fallbeispiel soll die Praxis des Lobbyings veranschaulichen.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, die Seminararbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen.
- Quote paper
- Lola Reiter (Author), 2017, Wie funktioniert Lobbyismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459446