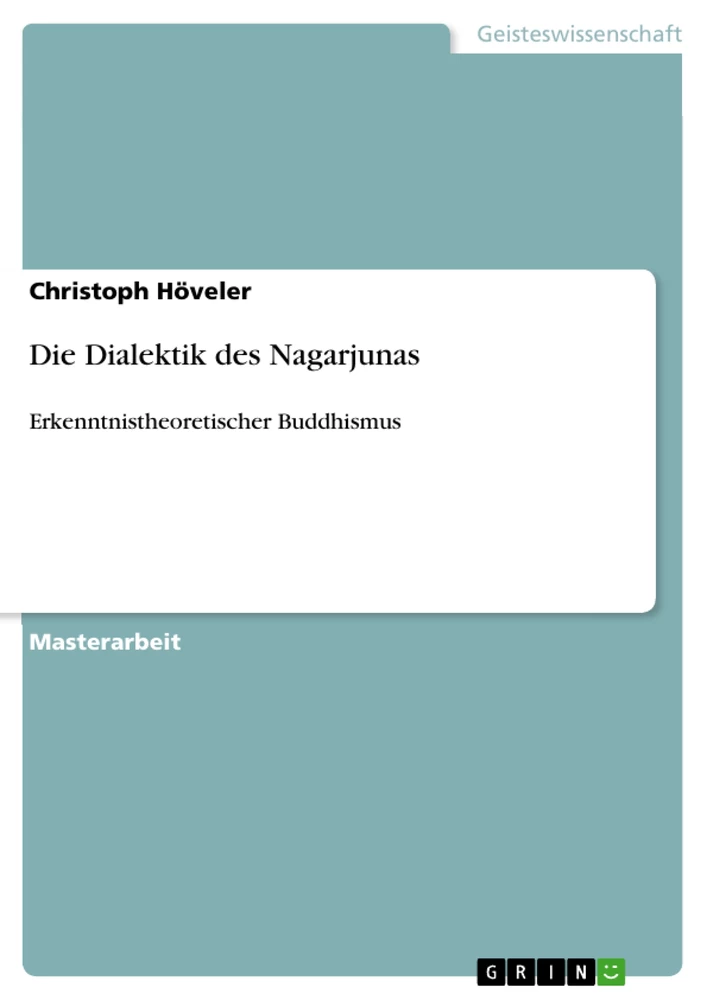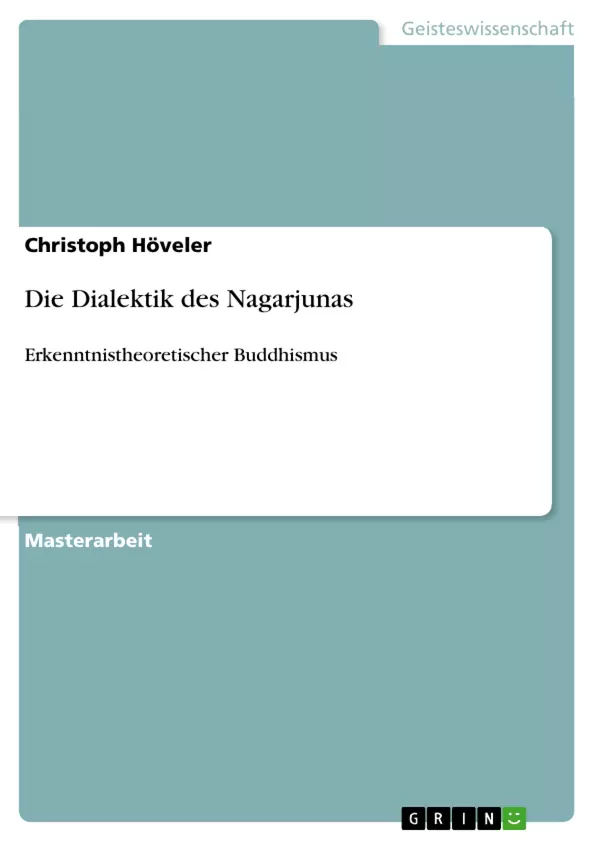Der Buddhismus wurde und wird als Glaube zwar gelebt, doch seine überaus durchdachte Theorie übertritt an vielen Stellen die Schwelle von Religion zur Philosophie. Die philosophische Grundsteinlegung fängt lange vor der westlichen Zeitrechnung an und mündet in den heute so zahlreichen Lehrschulen des Buddhismus auf der ganzen Welt. Nicht alle Erkenntnisse der indischen Spiritualität können auch philosophisch eingelöst werden, da manches davon außerhalb jeglicher Form der Sprache liegt. Doch der Weg dorthin wird dezidiert philosophisch erarbeitet. Den Spuren dieser Entwicklung geht diese Arbeit nach.
Ganz im Sinne einer beliebten europäischen Denkfigur, dass in der geschichtlich ursprünglichsten Gestalt der reine und wahre Kern zu erblicken ist, beginnt diese Arbeit mit dem Aufbau des Buddhismus aus seinen vedischen Wurzeln. Erst das System der Buddha-Lehre ermöglicht einen adäquaten Zugang zum dialektischen Denken des Nagarjuna, welches in seiner Art und Weise einzigartig ist. Das Denken des Nagarjuna steht konträr zu allen europäischen Positionen zum Thema Zeit und Sein. Dabei will er die Existenz der Zeit weder falsifizieren, noch verifizieren, sondern darlegen, dass Sein und Nicht-Sein prinzipiell das Gleiche sind. Wieso das Sein und die Zeit miteinander verknüpft sind und wieso das Ergebnis vom Madhyamaka-Sastra zu Ende gedacht gar kein „Ergebnis“ mehr ist, wird in dieser Arbeit argumentativ entfaltet.
Der Buddhismus genießt in der westlichen Welt seit geraumer Zeit den medialen Status einer „Trendreligion“. Dabei spricht vielfach der tibetische Buddhismus mit seinen farbenreichen Zeremonien, seinen Klängen und Düften die Menschen an, welche auf der Suche nach religiöser Erfahrung sind. Doch der gemeinhin als Meditationsreligion verrufene Buddhismus basiert auf einer unglaublich durchdachten Theorie. Auch geschichtlich betrachtet hat nur eine Minderheit der Mönche und Nonnen die Mediation so ausgiebig praktiziert, wie es die heutige westliche Vorstellung suggerieren mag. Die Meditationstechniken stoßen seit dem 20. Jahrhundert auf großes Interesse und werden mittlerweile als Methode zum Stressabbau in der Wissenschaft und Forschung untersucht. Doch obwohl das gesamte Angebot so vielfältige und neuartige Zugänge zu meist uralten Traditionen eröffnet, wird oft missachtet, dass hinter dem Buddhismus mehr steckt, als nur eine meditative Geistesschulung. Denn diese Arbeit widmet sich unter anderem einer der zentralsten Fragen der Menschheit: Was ist Zeit?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textgrundlage
- Geschichtlicher Hintergrund
- Siddharta Gautama
- Buddhismus und die buddhistischen Schulen
- Mahayana und Nagarjuna
- Upanischaden
- Ein wechselseitiges Sich-Voraussetzen
- Grenzen des Denkens
- Buddha
- Predigt von Benares
- Die Wahrheit vom Leiden
- Die An-atman Lehre
- Befreiung vom Leiden
- Vollkommenheit
- Scheitern als Möglichkeit
- Buddhismus als Reformbewegung
- Entstehen in Abhängigkeit
- Aufbau des Selbst
- Nagarjuna
- Leerheit
- Selbstaufhebung der Lehre
- Fragen nach dem Anfang
- Eine erste Betrachtung der Zeit
- Analyse der Zeit
- Analyse des Seienden
- Determinismus
- Offenheit und Befreiung
- Dialektik
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das dialektische Denken des Nagarjuna, welches die Zeit und das Sein in Frage stellt. Ziel ist es, die philosophischen Grundlagen des Buddhismus, insbesondere der Madhyamika-Schule, zu beleuchten und die besondere Sichtweise auf Zeit und Existenz zu erforschen.
- Die philosophischen Wurzeln des Buddhismus
- Die Kritik des Nagarjuna an den traditionellen Konzepten von Zeit und Sein
- Die Lehre der Leerheit (Śūnyatā) und ihre Bedeutung für die buddhistische Philosophie
- Die Beziehung zwischen Zeit, Sein und Nicht-Sein in der Madhyamika-Schule
- Die Frage nach dem Beginn der Zeit und die buddhistische Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die besondere Bedeutung des Buddhismus in der westlichen Welt. Es wird erläutert, dass der Buddhismus mehr als nur eine meditative Geistesschulung darstellt und sich mit fundamentalen Fragen wie der Zeit auseinandersetzt.
Der Abschnitt „Textgrundlage“ stellt die wichtigsten Quellen des Buddhismus vor, darunter die Veden, die Upanischaden und der Pali-Kanon. Es wird zudem die Entwicklung der buddhistischen Schriften und die Besonderheiten der verschiedenen Textformen erläutert.
Der geschichtliche Hintergrund des Buddhismus wird im nächsten Abschnitt beleuchtet. Hier werden die Einflüsse der indischen Gesellschaft und die Bedeutung des Kastenwesens für den Aufstieg und den Niedergang des Buddhismus in Indien erörtert.
Die Lebensgeschichte des Buddhas Siddhartha Gautama wird in einem separaten Abschnitt zusammengefasst. Hier wird auch die Bedeutung der vier Ausfahrten, die Begegnung mit dem Mönch und die Erlangung der Erleuchtung dargestellt.
Der Abschnitt „Buddhismus und die buddhistischen Schulen“ beleuchtet die wichtigsten Neuerungen des Buddhismus im Vergleich zum Hinduismus und die Ausbreitung des Buddhismus außerhalb Indiens.
Schlüsselwörter
Buddhismus, Madhyamika, Nagarjuna, Zeit, Sein, Nicht-Sein, Leerheit (Śūnyatā), Dialektik, Upanischaden, Veden, Pali-Kanon, Siddharta Gautama, Kastenwesen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Nagarjuna und was ist seine Dialektik?
Nagarjuna war ein indischer Philosoph des Mahayana-Buddhismus, der die Dialektik der Leerheit (Sunyata) entwickelte, um die Relativität aller Konzepte aufzuzeigen.
Was bedeutet „Leerheit“ (Sunyata) im Buddhismus?
Leerheit bedeutet nicht „Nichts“, sondern dass alle Dinge abhängig voneinander entstehen und kein festes, unabhängiges Eigenwesen besitzen.
Wie betrachtet Nagarjuna das Konzept der Zeit?
In seiner Analyse zeigt Nagarjuna, dass Zeit weder an sich existiert noch unabhängig von den Dingen ist, was herkömmliche Vorstellungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft infrage stellt.
Ist der Buddhismus eher eine Religion oder eine Philosophie?
Die Arbeit argumentiert, dass der Buddhismus zwar als Glaube gelebt wird, aber eine tiefgehende philosophische Theorie besitzt, die über religiöse Dogmen hinausgeht.
Was unterscheidet Nagarjunas Denken von westlichen Positionen?
Sein Denken lehnt die strikte Trennung von Sein und Nicht-Sein ab und bietet eine radikale Kritik an der Metaphysik, die in der westlichen Philosophie erst viel später Parallelen fand.
- Quote paper
- Christoph Höveler (Author), 2018, Die Dialektik des Nagarjunas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459462