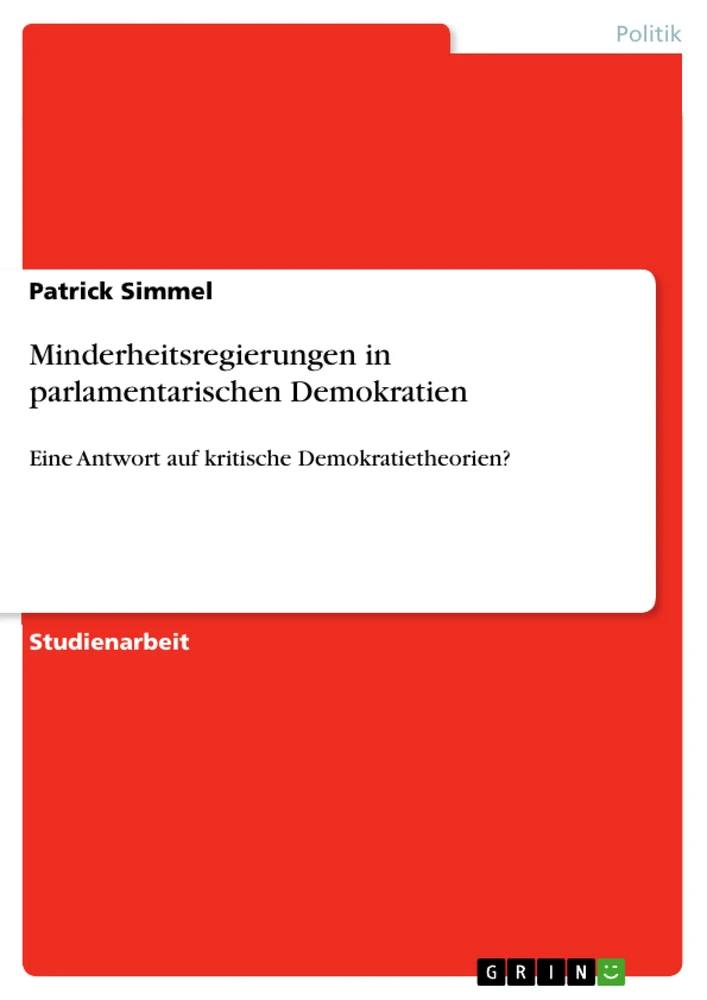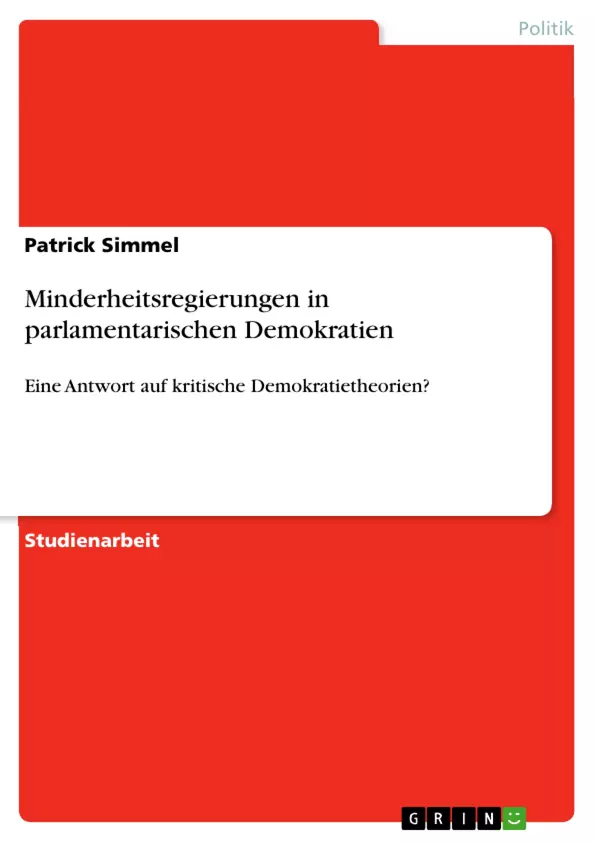Die Debatte um eine mögliche erste Minderheitsregierung auf bundesdeutscher Ebene soll als Anlass genutzt werden, Minderheitsregierungen aus demokratietheoretischer Perspektive neu zu betrachten und Auswirkungen auf mögliche Demokratiedefizite zu analysieren.
Die Wahlen zum Deutschen Bundestag am 24.09.2017 haben erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sechs im Parlament vertretene Fraktionen hervorgebracht. Die Stimmenverteilung zwischen den einzelnen Parteien verhinderte einerseits die Bildung kleiner, „natürlicher“ Koalitionen. Andererseits eröffnete das Wahlergebnis aber auch neue Regierungsmöglichkeiten. So war neben der Fortsetzung der großen Koalition aus Union und SPD auch ein Dreierbündnis aus Union, FDP und Bündnis90/Die Grünen eine Regierungsoption, welche aus politischen Gründen jedoch nicht zustande kam.
Abseits der bekannten Koalitionsbildungsversuche bestand darüber hinaus die Möglichkeit, auch ohne Mehrheitsregierungskoalition zu regieren.
Diese Möglichkeit wird grundsätzlich vom Grundgesetz eingeräumt, spielt aber in der tagespolitischen Debatte bis heute nahezu keine Rolle. Die CDU-Chefin und wiedergewählte Kanzlerin Angela Merkel hat mit ihrer Aussage am Wahlabend, wonach sie Absicht habe „zu einer stabilen Regierung in Deutschland“ zu kommen, diese Option praktisch von Beginn an ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen
- Aufarbeitung des Forschungsstandes
- Formulierung von Forschungsfrage und Hypothese
- Organisation der Arbeit und argumentative Vorgehensweise
- Überlegungen zur Bildung von Koalitionsregierungen
- Parteipositionen
- Wählerpositionen
- kritische Demokratietheorien
- Allgemeiner Überblick
- systembedingte Strukturdefizite von etablierten Demokratien
- Auswirkungen von Mehrheits- bzw. Minderheitsregierungen auf Strukturdefizite von Demokratien
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Minderheitsregierungen in parlamentarischen Demokratien und untersucht, ob diese eine Antwort auf kritische Demokratietheorien darstellen können. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Minderheitsregierungen auf mögliche Demokratiedefizite.
- Die Bildung von Mehrheits- und Minderheitsregierungen in parlamentarischen Demokratien
- Die kritischen Demokratietheorien und ihre Thesen zu den systembedingten Strukturdefiziten von Demokratien
- Die Auswirkungen von Minderheitsregierungen auf diese Strukturdefizite
- Die Rolle der Wählerpositionen und Parteipositionen bei der Regierungsbildung
- Die Chancen und Risiken von Minderheitsregierungen für das Funktionieren des parlamentarischen Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Minderheitsregierungen ein und definiert die wichtigsten Begriffe. Sie erläutert die Forschungsfrage und die Hypothese der Arbeit.
Das zweite Kapitel untersucht die Bildung von Koalitionsregierungen und die Rolle von Parteipositionen und Wählerpositionen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Regierungsbildung in einem komplexen Mehrparteiensystem.
Kapitel drei stellt die kritischen Demokratietheorien vor und ihre zentralen Argumente zu den Strukturdefiziten von Demokratien. Es untersucht die Kritik an der Funktionsweise von etablierten demokratischen Systemen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Minderheitsregierungen, parlamentarische Demokratie, kritische Demokratietheorien, Demokratiedefizite, Mehrheits- und Minderheitsregierungen, Parteipositionen, Wählerpositionen, Koalitionsbildung und Regierungsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Minderheitsregierung?
Eine Minderheitsregierung ist eine Regierung, die im Parlament über keine eigene absolute Mehrheit verfügt und daher für jedes Vorhaben wechselnde Mehrheiten suchen muss.
Sind Minderheitsregierungen in Deutschland rechtlich möglich?
Ja, das Grundgesetz räumt diese Möglichkeit grundsätzlich ein, wenngleich sie auf Bundesebene in der politischen Praxis bisher kaum eine Rolle spielten.
Können Minderheitsregierungen Demokratiedefizite beheben?
Aus demokratietheoretischer Sicht könnten sie das Parlament stärken, da Debatten offener geführt werden müssen und die Regierung stärker auf Kompromisse angewiesen ist.
Warum werden stabile Koalitionsregierungen oft bevorzugt?
Politische Akteure assoziieren Mehrheitskoalitionen oft mit höherer Stabilität und Planungssicherheit für die Regierungsarbeit.
Welche Rolle spielen Wählerpositionen bei der Regierungsbildung?
Das Wahlergebnis und die Verteilung der Stimmen auf mehrere Parteien (wie 2017) zwingen Parteien dazu, auch unkonventionelle Regierungsoptionen jenseits „natürlicher“ Bündnisse zu prüfen.
- Citation du texte
- Patrick Simmel (Auteur), 2018, Minderheitsregierungen in parlamentarischen Demokratien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459473