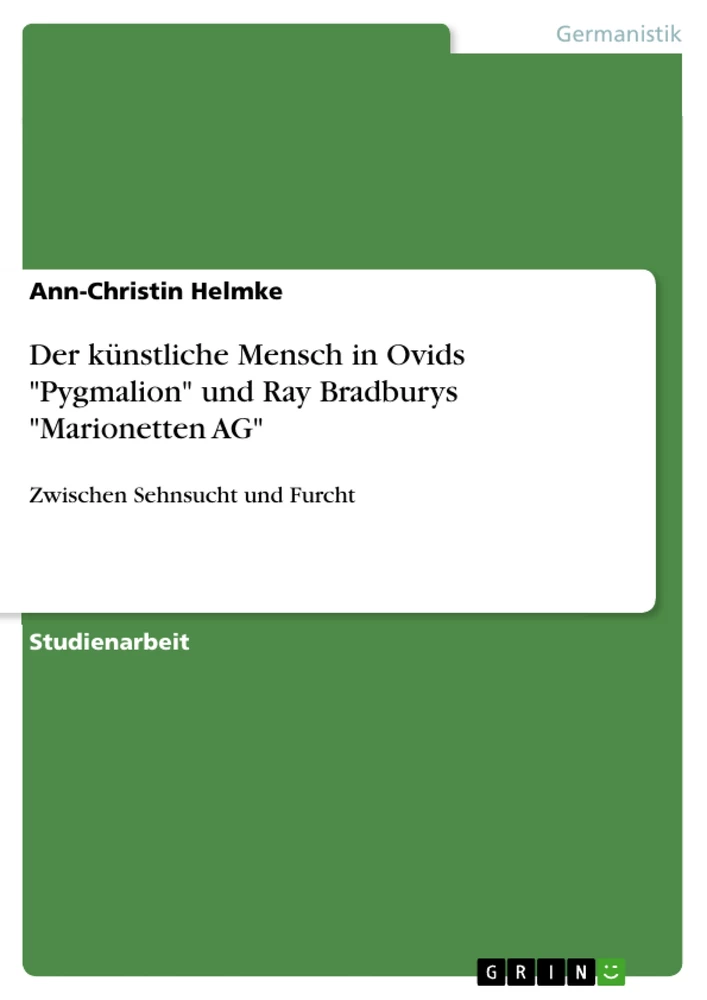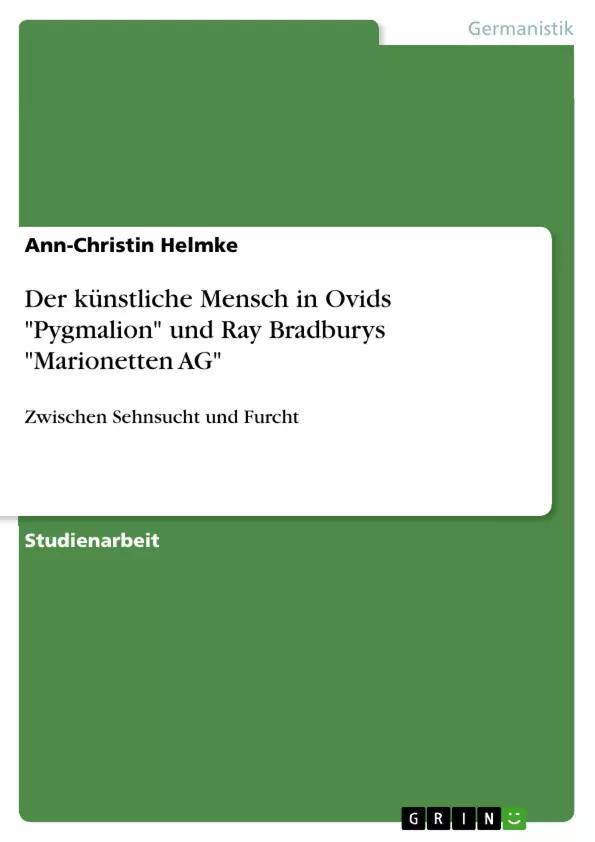Wenn Maschinen und Menschen einander immer ähnlicher werden und die Grenzen verschwimmen: Was bedeutet das für die Beziehung zwischen Mensch und Maschine?
Diese Seminararbeit untersucht, wie die Beziehung zwischen Menschen und künstlichen Menschen in der Literatur dargestellt wird, und inwiefern sich diese Beziehung vor dem Hintergrund neuer Technologien wandelt.
Um eine mögliche Veränderung in der literarischen Darstellung festzustellen, wurden zwei Texte ausgewählt, die zeitlich, kulturell als auch technologisch sehr weit auseinander liegen: Ovids „Pygmalion“ ist ein Werk der Antike, während Ray Bradburys Kurzgeschichte „Marionetten AG“ 1977 erschienen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Motiv des künstlichen Menschen und Einordnung der gewählten Texte
- 3. Analyse von Pygmalion
- 3.1 Kreation und Beschaffenheit der Statue
- 3.2 Beziehung zwischen Mensch und Statue
- 4. Analyse von Marionetten AG
- 4.1 Kreation und Beschaffenheit von Braling Zwei
- 4.2 Beziehung zwischen Braling und Braling Zwei
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Beziehung zwischen Menschen und künstlichen Menschen in der Literatur, anhand von Ovids "Pygmalion" und Ray Bradburys "Marionetten AG". Ziel ist es, die jeweilige Konzeption des künstlichen Menschen in beiden Texten zu analysieren und zu vergleichen, um mögliche Veränderungen in der literarischen Darstellung vor dem Hintergrund technologischer Entwicklungen zu beleuchten.
- Die Konzeption des künstlichen Menschen in der Antike und Moderne
- Der kreative Prozess und die Beschaffenheit der künstlichen Wesen
- Die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf
- Die Darstellung von Sehnsucht und Furcht im Umgang mit künstlichem Leben
- Der Vergleich der literarischen Motive im Kontext gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den aktuellen Diskurs um Mensch-Maschine-Beziehungen anhand eines Zeitungsartikels beleuchtet. Sie begründet die Auswahl von Ovids "Pygmalion" und Bradburys "Marionetten AG" als gegensätzliche Beispiele für die literarische Auseinandersetzung mit dem künstlichen Menschen und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf die Kreation und Beschaffenheit der künstlichen Wesen sowie deren Beziehung zu Menschen konzentriert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung möglicher Veränderungen in der literarischen Darstellung über die Jahrhunderte hinweg.
2. Das Motiv des künstlichen Menschen und Einordnung der gewählten Texte: Dieses Kapitel analysiert das Motiv des künstlichen Menschen in der Literatur, basierend auf dem Lexikon von Elisabeth Frenzel. Es werden die zentralen Handlungsschemata – der Wunschtraum vom Schöpfermenschen und die Angst vor der Übermacht des Geschöpfs – identifiziert und auf die beiden ausgewählten Texte angewendet. "Pygmalion" wird als Beispiel für den Wunschtraum interpretiert, während "Marionetten AG" die Angst vor dem unkontrollierbaren künstlichen Menschen thematisiert. Der Kapitel vergleicht die unterschiedlichen Konzepte des künstlichen Menschen in der Antike und der modernen Literatur. Die Einordnung der Texte erfolgt im Kontext ihrer jeweiligen Epoche und des technologischen Fortschritts.
Schlüsselwörter
Künstlicher Mensch, Pygmalion, Ovid, Marionetten AG, Ray Bradbury, Mensch-Maschine-Beziehung, Sehnsucht, Furcht, Technologie, Antike, Moderne, Dystopie, Schöpfer, Geschöpf.
Häufig gestellte Fragen zu "Analyse von Pygmalion und Marionetten AG"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Darstellung der Beziehung zwischen Menschen und künstlichen Menschen in der Literatur, anhand von Ovids "Pygmalion" und Ray Bradburys "Marionetten AG". Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Konzeption des künstlichen Menschen in beiden Texten und der Untersuchung möglicher Veränderungen in der literarischen Darstellung vor dem Hintergrund technologischer Entwicklungen.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Ovids "Pygmalion" und Ray Bradburys "Marionetten AG". Diese beiden Texte wurden ausgewählt, weil sie gegensätzliche Aspekte der Mensch-Maschine-Beziehung repräsentieren: "Pygmalion" als Beispiel für den Wunschtraum vom Schöpfermenschen und "Marionetten AG" als Darstellung der Angst vor der Übermacht des künstlichen Menschen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Themen, darunter die Konzeption des künstlichen Menschen in der Antike und Moderne, den kreativen Prozess und die Beschaffenheit der künstlichen Wesen, die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, die Darstellung von Sehnsucht und Furcht im Umgang mit künstlichem Leben und den Vergleich der literarischen Motive im Kontext gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Einordnung des Motivs des künstlichen Menschen und der ausgewählten Texte, Analyse von Pygmalion (mit Unterkapiteln zur Kreation der Statue und der Beziehung zwischen Mensch und Statue), Analyse von Marionetten AG (mit Unterkapiteln zur Kreation von Braling Zwei und der Beziehung zwischen Braling und Braling Zwei) und Fazit/Ausblick.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beleuchtet den aktuellen Diskurs um Mensch-Maschine-Beziehungen und begründet die Auswahl der beiden Texte. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit und betont den Fokus auf Veränderungen in der literarischen Darstellung über die Jahrhunderte.
Was wird im Kapitel zur Einordnung der Texte behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Motiv des künstlichen Menschen in der Literatur basierend auf dem Lexikon von Elisabeth Frenzel. Es identifiziert zentrale Handlungsschemata (Wunschtraum vom Schöpfermenschen und Angst vor der Übermacht des Geschöpfs) und wendet diese auf "Pygmalion" und "Marionetten AG" an. Es vergleicht die Konzepte des künstlichen Menschen in der Antike und Moderne im Kontext ihrer jeweiligen Epoche und des technologischen Fortschritts.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Künstlicher Mensch, Pygmalion, Ovid, Marionetten AG, Ray Bradbury, Mensch-Maschine-Beziehung, Sehnsucht, Furcht, Technologie, Antike, Moderne, Dystopie, Schöpfer, Geschöpf.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Kreation und Beschaffenheit der künstlichen Wesen in beiden Texten sowie auf die Untersuchung ihrer Beziehung zu den menschlichen Figuren. Der Vergleich der beiden Texte dient der Beleuchtung von Veränderungen in der literarischen Darstellung über die Jahrhunderte hinweg.
- Citar trabajo
- Ann-Christin Helmke (Autor), 2012, Der künstliche Mensch in Ovids "Pygmalion" und Ray Bradburys "Marionetten AG", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459648