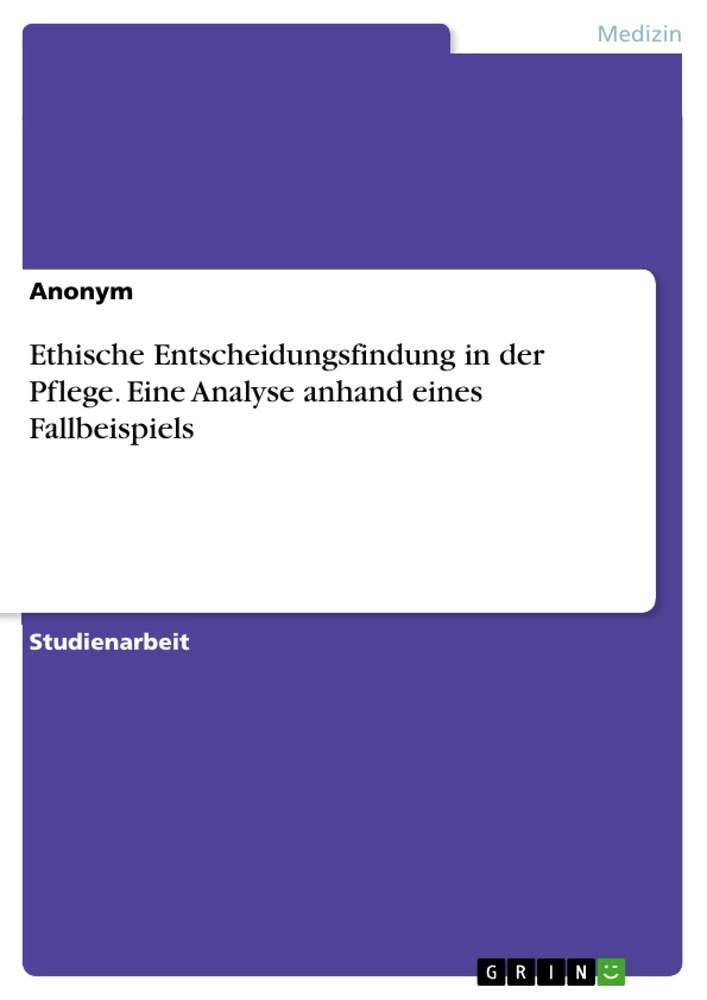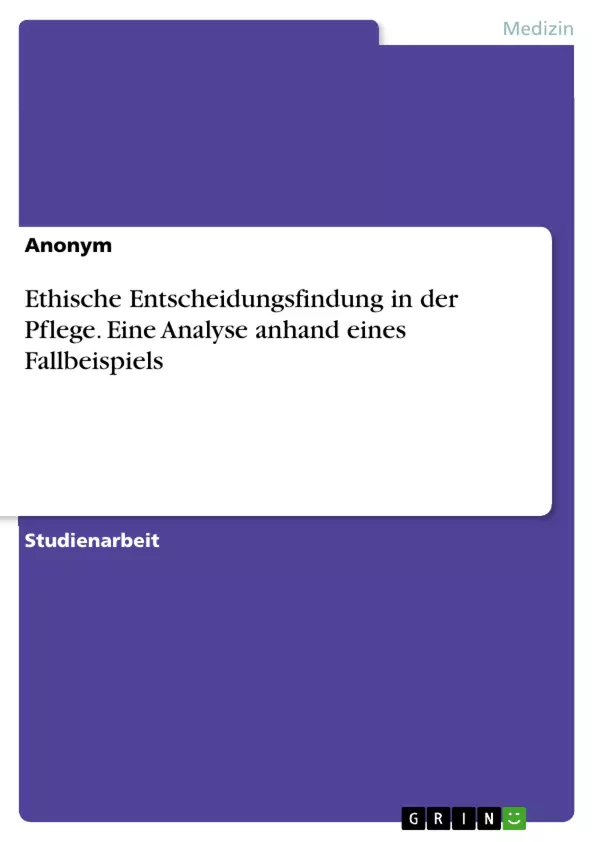Das Ziel der Seminararbeit ist es, ein Fallbeispiel zur Pflege anhand eines ethischen Entscheidungsfindungsmodells zu analysieren.
Schon in der Antike stand die Auseinandersetzung mit der Genesung Kranker im Blickpunkt, welche sich von anderen naturwissenschaftlichen Betrachtungen differenzierte. Fahr nennt den Utilitarismus, die Pflichtenethik Immanuel Kants und die Tugendethik des Aristoteles als derartige Positionen. Hierbei fällt auch der Ausdruck Ethik ins Gewicht, welcher das Reflektieren auf ethisch fragliche Gegebenheiten, auf Dilemmata, ermöglicht.
In den folgenden Abschnitten werden sowohl die Ausgangslage und das Ziel der Arbeit dargestellt als auch das Thema „Ethische Entscheidungsfindung in der Pflege“ erläutert. In der Ausgangslage werden die ethischen Grundprinzipien aus der Fachliteratur von Lay sowie aus Neitzke und Simon dargestellt, wobei sich Lay auf die Grundprinzipien von Rabe und Neitzke und Simon sich sowohl auf die Grundprinzipien von Rabe, als auch von Beauchamp und Childress beziehen.
Die sechs ethischen Grundprinzipien sind laut Rabe: Würde, Gerechtigkeit, Dialog, Verantwortung, Autonomie und Fürsorge. Beauchamp und Childress führen vier Grundprinzipien an, wie Autonomie, Benefizienz, Nonmalefizienz sowie Gleichheit und Gerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangslage
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 2 Ethische Analyse des Fallbeispiels
- 3 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein Fallbeispiel im Bereich der Pflege mit Hilfe eines ethischen Entscheidungsfindungsmodells zu analysieren.
- Ethische Grundprinzipien in der Pflege
- Analyse eines Fallbeispiels aus der Praxis
- Anwendung eines ethischen Entscheidungsfindungsmodells
- Herausforderungen und Dilemmata in der Pflege
- Bedeutung von Ethik und Gesundheit in der Pflegepraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die ethische Entscheidungsfindung in der Pflege. Es werden die ethischen Grundprinzipien aus verschiedenen Quellen dargestellt und erläutert, wie diese in der Pflegepraxis relevant sind.
1.1 Ausgangslage
Die Ausgangslage beschreibt die ethischen Grundprinzipien aus der Fachliteratur und zeigt auf, wie diese von verschiedenen Autoren definiert und angewendet werden. Die wichtigsten Prinzipien werden erläutert und Beispiele aus der Praxis gegeben.
1.2 Ziel der Arbeit
Das Ziel der Arbeit wird dargelegt: die Analyse eines Fallbeispiels im Bereich der Pflege mithilfe eines ethischen Entscheidungsfindungsmodells.
Schlüsselwörter
Ethische Entscheidungsfindung, Pflegeethik, Grundprinzipien, Fallbeispiel, Entscheidungsfindungsmodell, Patientenwohl, Autonomie, Fürsorge, Benefizienz, Nonmalefizienz, Gerechtigkeit, Würde, Dialog, Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die sechs ethischen Grundprinzipien in der Pflege nach Rabe?
Die sechs Prinzipien lauten: Würde, Gerechtigkeit, Dialog, Verantwortung, Autonomie und Fürsorge. Sie dienen als Orientierung für pflegerisches Handeln.
Was unterscheidet die Prinzipien von Beauchamp und Childress?
Sie führen vier zentrale Säulen an: Autonomie (Selbstbestimmung), Benefizienz (Gutes tun), Nonmalefizienz (Nicht-Schaden) sowie Gleichheit und Gerechtigkeit.
Warum ist ein ethisches Entscheidungsfindungsmodell in der Pflege wichtig?
Es ermöglicht Pflegekräften, komplexe Dilemmata systematisch zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen, die das Patientenwohl und ethische Standards berücksichtigen.
Welche Rolle spielt die Tugendethik nach Aristoteles?
Die Arbeit erwähnt die Tugendethik als eine der klassischen Positionen, die neben der Pflichtenethik Kants und dem Utilitarismus die Grundlage für ethische Überlegungen in der Pflege bildet.
Was ist das Ziel der ethischen Analyse eines Fallbeispiels?
Das Ziel ist es, die theoretischen Prinzipien auf eine reale Praxissituation anzuwenden, um die Herausforderungen und möglichen Lösungswege bei ethischen Konflikten aufzuzeigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Ethische Entscheidungsfindung in der Pflege. Eine Analyse anhand eines Fallbeispiels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459822