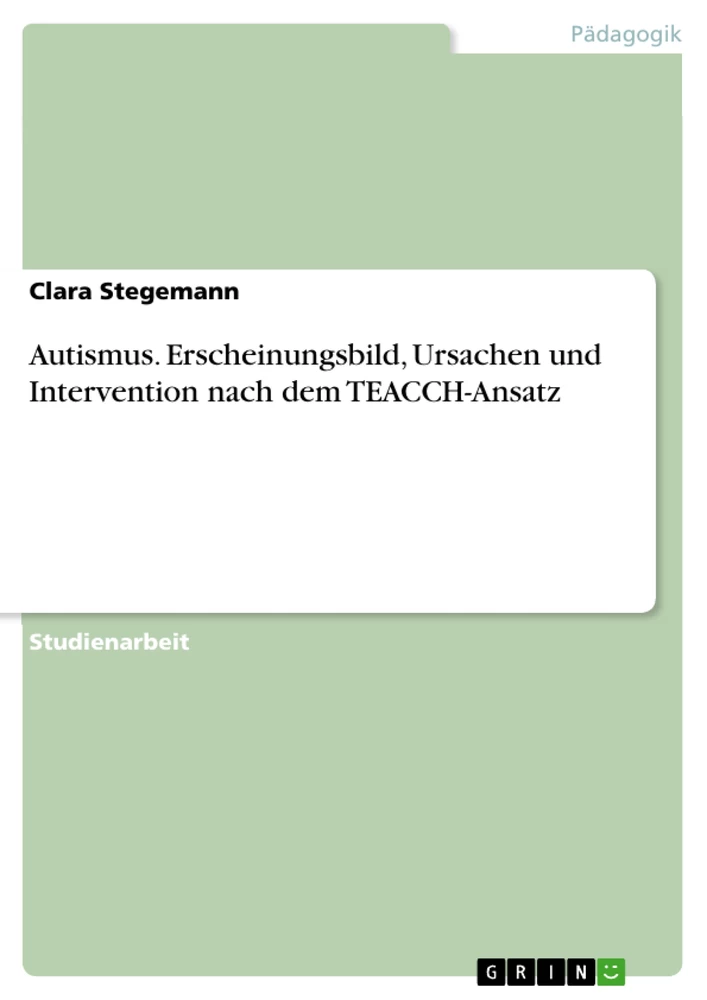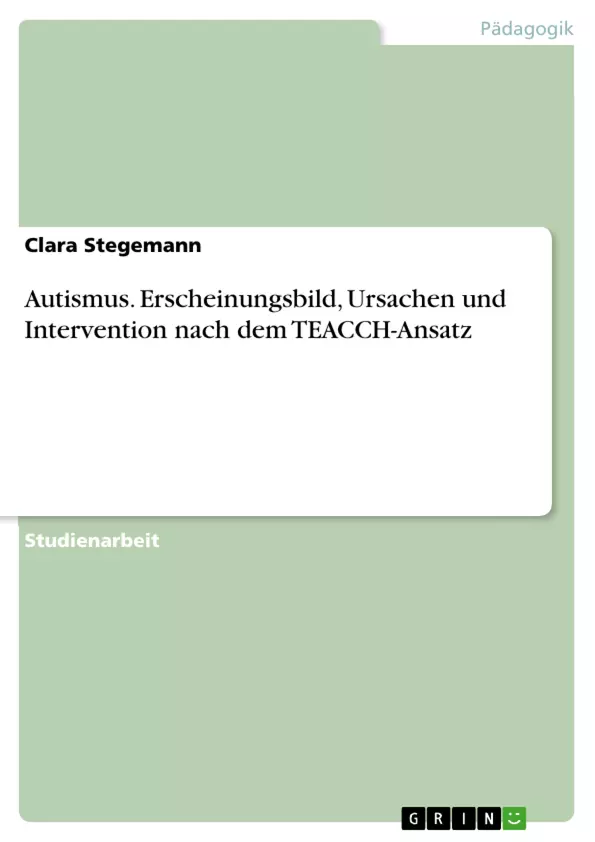Im medizinischen Kontext ist Autismus ein Phänomen, das trotz modernster Forschung auch heute noch nicht vollständig verstanden wird. Verschiedenste Disziplinen beschäftigen sich mit Autisten: so sind zum einen Psychologen und Psychiater im Sinne der Diagnose und Medikation beteiligt, wie auch Sozialarbeiter und Erzieher im Kontext der Lebensbegleitung und Therapie. In dieser Hausarbeit soll geklärt werden, welche Erscheinungsformen im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung bekannt sind, welche Ursachen dieser zugrunde liegen und welche Möglichkeiten die Soziale Arbeit bietet, um die Betroffenen zu unterstützen.
Dafür wird zuerst ein kurzer Überblick über die Historie gegeben, bevor auf die Epidemiologie eingegangen wird. Anschließend soll beschrieben werden, wie Autismus in den beiden gängigen Klassifikationssystemen (DSM-V und ICD-10) klassifiziert wird. Dabei wird auf den neuesten Forschungsstand im Sinne der Autismus-Spektrum-Störung eingegangen. Zur Verdeutlichung werden dort ebenfalls die einzelnen Erscheinungsbilder des Autismus ausführlich beschrieben.
Schließlich wird die Ätiopathogenese vorgestellt und diskutiert, welcher Einflussfaktor der bedeutendste in Bezug auf die Autismus-Spektrum-Störung ist. Des Weiteren werden die Inklusionsmöglichkeiten für Menschen mit Autismus beleuchtet. Hier wird insbesondere auf den TEACCH-Ansatz eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historie
- Epidemiologie
- Autismus
- Frühkindlicher Autismus
- Asperger Autismus
- Atypischer Autismus
- Ätiologie
- Intervention nach dem TEACCH-Ansatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Autismus-Spektrum-Störung, einem komplexen Phänomen, das trotz moderner Forschung noch nicht vollständig verstanden ist. Ziel ist es, die verschiedenen Erscheinungsformen, die zugrundeliegenden Ursachen und die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Unterstützung Betroffener zu beleuchten.
- Historische Entwicklung des Autismusbegriffs und die verschiedenen Formen
- Epidemiologie und Häufigkeit der Autismus-Spektrum-Störung
- Ätiologie des Autismus und die bedeutendsten Einflussfaktoren
- Intervention und Unterstützung für Menschen mit Autismus, insbesondere der TEACCH-Ansatz
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Forschungsaspekte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Relevanz des Themas Autismus und stellt die verschiedenen Disziplinen vor, die sich mit dieser Störung auseinandersetzen. Außerdem werden die unterschiedlichen Ausprägungen und die steigende Häufigkeit der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) erläutert. Die Historie des Autismusbegriffs wird im zweiten Kapitel behandelt, wobei die Arbeiten von Eugen Bleuler, Leo Kanner und Hans Asperger in den Fokus gerückt werden. Die Entwicklung des Begriffs und die Verbindung zur Schizophrenie werden erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Epidemiologie und beleuchtet die Häufigkeit des Autismus. Das vierte Kapitel erläutert die verschiedenen Erscheinungsformen des Autismus, wie Frühkindlicher Autismus, Asperger-Autismus und Atypischer Autismus, und beschreibt die charakteristischen Merkmale.
Schlüsselwörter
Autismus, Autismus-Spektrum-Störung, Frühkindlicher Autismus, Asperger-Autismus, Atypischer Autismus, TEACCH-Ansatz, Epidemiologie, Ätiologie, Soziale Arbeit, Intervention, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der TEACCH-Ansatz bei Autismus?
TEACCH steht für "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren" und setzt auf Strukturierung und Visualisierung, um Autisten im Alltag zu unterstützen.
Welche Formen des Autismus werden unterschieden?
Die Arbeit beschreibt den frühkindlichen Autismus (Kanner-Syndrom), das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus als Teil der Autismus-Spektrum-Störung (ASS).
Was sind die Ursachen (Ätiologie) von Autismus?
Die Forschung geht heute von einer primär genetischen und neurobiologischen Basis aus, wobei verschiedene Umweltfaktoren und Entwicklungsprozesse im Gehirn eine Rolle spielen.
Wie wird Autismus heute klassifiziert?
Die Diagnose erfolgt nach internationalen Klassifikationssystemen wie dem ICD-10 oder dem neueren DSM-5, wobei der Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" zunehmend als Oberbegriff dient.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Unterstützung von Autisten?
Sozialarbeiter und Erzieher begleiten Betroffene in der Lebensführung, fördern die Inklusion und wenden pädagogische Interventionen wie TEACCH an, um die Selbstständigkeit zu erhöhen.
- Quote paper
- Clara Stegemann (Author), 2018, Autismus. Erscheinungsbild, Ursachen und Intervention nach dem TEACCH-Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459846