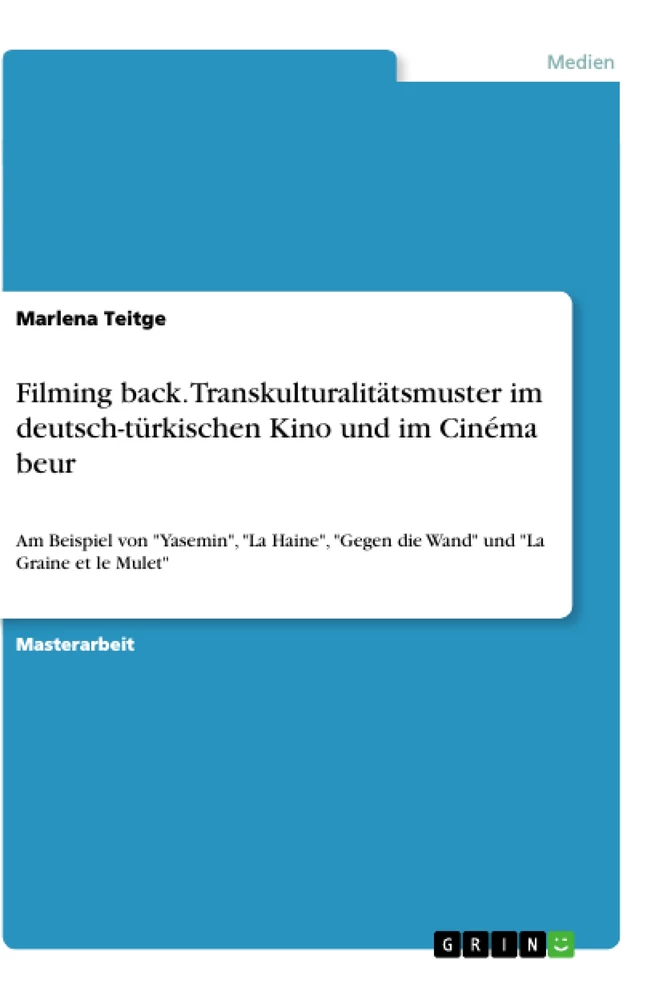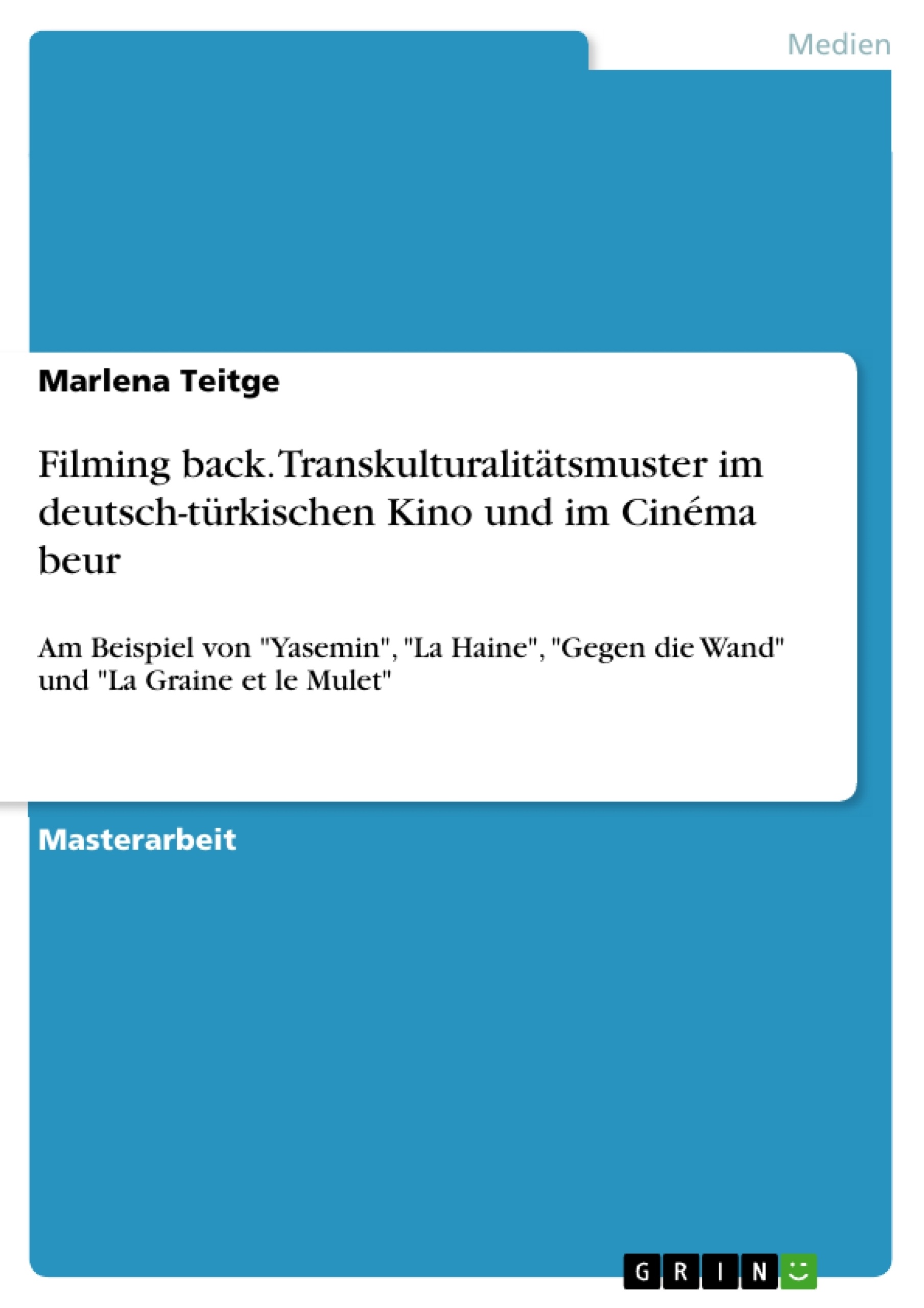Die Frage, der ich in dieser Arbeit nachgehen möchte, lautet : Welche Transkulturationsmuster liegen dem Cinéma beur, welche dem deutsch-türkischen Kino zugrunde und worin unterscheiden sich jeweils die Strategien des "filming back"?
Wie ordnet man einen Film ein, dessen Regisseur in Hamburg geboren ist, einen türkischen Migrationshintergrund hat und dessen Film in deutscher Sprache gedreht und dessen Handlung in Hamburg und Istanbul spielt? Ähnlich schwer fällt es uns bei den französischen Filmbeispielen. Eine eindeutige kulturelle oder nationale Zuordnung der Filme, die die heutige Verfasstheit von Kultur abbilden, ist scheinbar nicht mehr möglich. So, wie die Kulturen sich durch die Migration und kulturelle Verschmelzung transformiert haben, bringen sie auch neue Themen und Ästhetiken der Transkulturalität im Film hervor. Man spricht daher von einem transnationalen Kino oder einem Cinéma du métissage. In Frankreich und Deutschland haben sich das Cinéma beur und das deutsch-türkische Kino herausgebildet, die beide seit ihren Anfängen großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Migranten in den jeweiligen Ländern nehmen und das „nationale“ Kino nachhaltig prägen. Ihren Filmen gemeinsam ist, dass die Protagonisten Grenzen überschreiten und ihre Leben von der Durchdringung mindestens zweier Kulturen geprägt sind. Außerdem sind die Regisseure in den meisten Fällen selbst Produkte kultureller Vermischung, denn es handelt sich in beiden Fällen um Filmschaffende, die der 2. Generation der Immigration angehören. Dies führt zu der Frage, wie sich die Repräsentationsweise von Migration verändert, wenn man es, wie im Falle des Cinéma beur und des deutsch-türkischen Kinos, mit Regisseuren zu tun hat, die selbst keine Migrationserfahrungen haben beziehungsweise in frühester Kindheit umgesiedelt und daher transkulturell geprägt sind
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung
- Die Unterschiede zwischen der 1. und 2. Generation der Einwanderer in Deutschland und Frankreich
- Erläuterung der Grundbegriffe und Konzepte
- Das Cinéma du métissage
- Das Cinéma beur
- Das Accented Cinema
- Das "writing back"/"filming back"
- Vom Migrantenkino zu einem Cinéma du métissage
- Die Darstellung des Fremden in Hark Bohms YASEMIN (1988)
- "Othering" - Wie die türkische Kultur zum Fremden wird.
- ,,Es war einmal ein mutiger Ritter..." - Brautwerbung im 20. Jahrhundert.
- "filming back" in Fatih Akins GEGEN DIE WAND (2004)
- Cahit und Sibel - Transkulturelle Figuren.
- Das Motiv der Scheinehe
- Bewegungen im transkulturellen Raum.
- Zwischenfazit
- "filming back" im Cinéma beur
- Fremdheit in Matthieu Kassovitz' La Haine (1995)
- Das (koloniale) Fremde in LA HAINE
- ,,Wo Macht ist, ist auch Widerstand“ – Die Stimme des marginalisierten Subjekts in LA HAINE
- Transkulturalität in Abdellatif Kechiches LA GRAINE ET LE MULET (2007)
- Portrait einer franco-arabischen Familie
- Ein Restaurant-Schiff als Metapher für kulturelle Hybridität
- Reflexion über die Anwendung des "filming back"-Konzepts in den analysierten Filmen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Transkulturalitätsmuster im deutsch-türkischen Kino und im Cinéma beur, die in den Filmen YASEMIN, LA HAINE, GEGEN DIE WAND und LA GRAINE ET LE MULET deutlich werden. Dabei liegt der Fokus auf dem Konzept des "filming back" als Ausdruck kulturellen Widerstands und der kritischen Auseinandersetzung mit Stereotypisierungen. Die Arbeit will die unterschiedlichen Strategien des "filming back" in beiden Kinos herausarbeiten und die Gründe für diese Unterschiede beleuchten.
- Das "filming back" als Konzept des kulturellen Widerstands
- Transkulturalität in der Darstellung von Einwanderergruppen in Deutschland und Frankreich
- Die Rolle des Films als Medium der Repräsentation und Dekonstruktion von Stereotypen
- Vergleich der Transkulturalitätsmuster im deutsch-türkischen Kino und im Cinéma beur
- Die Bedeutung von Kultur und Identität im Kontext von Migration und Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach den Transkulturationsmustern und den Strategien des "filming back" im deutsch-türkischen Kino und im Cinéma beur.
Kapitel 1 untersucht die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation der Einwanderer in Deutschland und Frankreich und legt den Grundstein für die Analyse der spezifischen Herausforderungen und Erfahrungen, die in den Filmen zum Ausdruck kommen.
Kapitel 2 erläutert die grundlegenden Begriffe und Konzepte, die für die Arbeit relevant sind, wie z.B. das Cinéma du métissage, das Cinéma beur, das Accented Cinema und das "writing back"/"filming back".
Kapitel 3 befasst sich mit der Entwicklung vom Migrantenkino zum Cinéma du métissage und analysiert Hark Bohms Film YASEMIN (1988) als Beispiel für die Darstellung des Fremden in der deutschen Filmlandschaft.
Kapitel 4 konzentriert sich auf das "filming back" im Cinéma beur und analysiert Matthieu Kassovitz' LA HAINE (1995) als Beispiel für die Darstellung von Fremdheit und Widerstand in der Banlieue.
Kapitel 5 reflektiert über die Anwendung des "filming back"-Konzepts in den analysierten Filmen und zieht Schlussfolgerungen für die Untersuchung der Transkulturalitätsmuster in beiden Kinos.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen "filming back", Transkulturalität, Cinéma du métissage, Cinéma beur, deutsch-türkisches Kino, Migration, Integration, Stereotypisierung, Repräsentation, Kultur, Identität, Fremdheit, Widerstand und Postkolonialität.
- Citar trabajo
- Marlena Teitge (Autor), 2011, Filming back. Transkulturalitätsmuster im deutsch-türkischen Kino und im Cinéma beur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459851