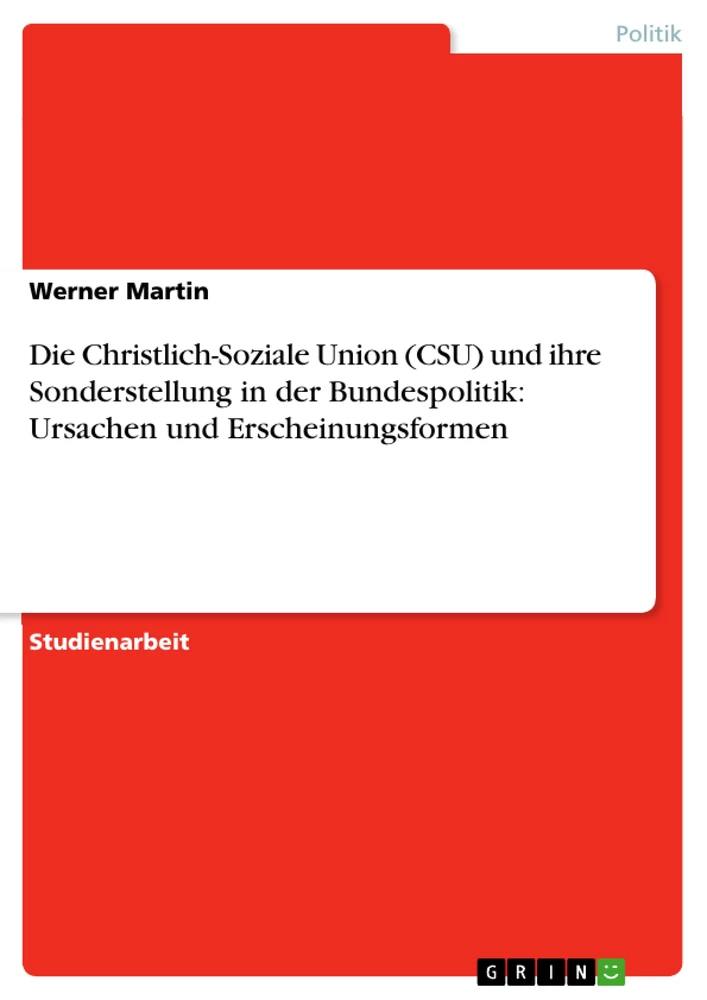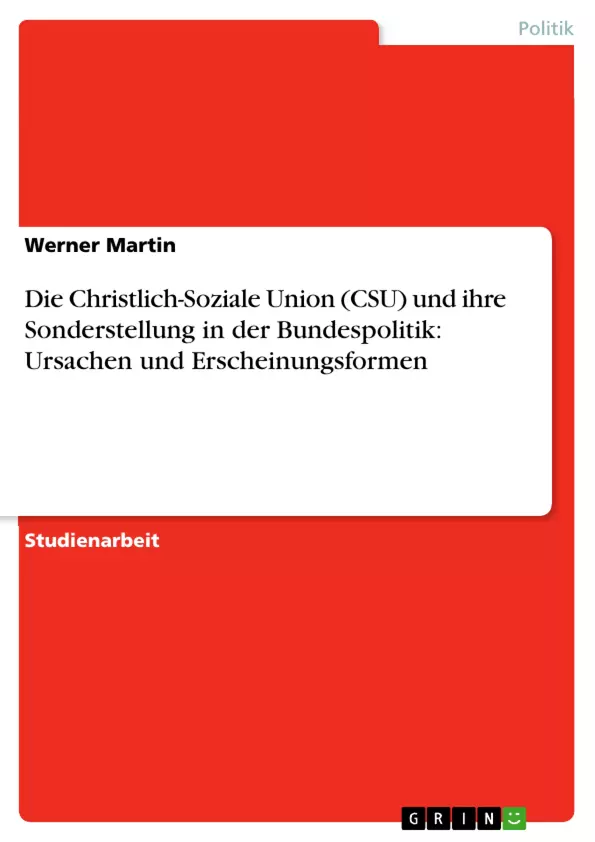Einer zwar nicht allzu ernst gemeinten, jedoch im Grunde wahren Definition zufolge ist der Bayer „(...) ein Mensch, der innere Befriedigung dabei empfindet, wenn er Fremden den falschen Weg zum Hofbräuhaus zeigt.“ (Richard McCormack)
Doch diese eigentümlich-witzige Gastfreundlichkeit vieler Bewohner Bayerns, die Fremde oft schlicht als „Zuagroaste“ betiteln, ist natürlich bei weitem nicht die einzige wesentliche Charaktereigenschaft des süddeutschen Volkes. Hinzu kommt ein ausgeprägtes National- bzw. Heimatgefühl, das nicht zuletzt aus der erwähnten bajuwarischen Xenophobie heraus resultiert. Dieses Volksempfinden, diese „Mir san mir-Mentalität“ führt oft dazu, dass der Bayer unverhohlen und deutlich seine ureigene Meinung äußert und dass es ihm „Wurscht“ ist, was der Rest der Nation dabei über ihn denkt oder sagt.
Da man dem bayerischen Volk also getrost einen starken Drang zur Unabhängigkeit und einen ausgeprägten Hang zum Eigensinn attestieren kann, ist es kaum verwunderlich, dass sich im Freistaat Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg eine Mitte-Rechts-Partei gebildet hat, die sich als bayerisches Pendant zu den christ-demokratischen Unionsparteien (CDU) versteht, die in den Ländern Restdeutschlands entstanden sind. Diese Partei, die Christlich-Soziale Union (CSU) hat sich seit ihrer Gründung 1946 in kürzester Zeit von einer autonomen, bayerischen Regionalpartei zu einer Partei entwickelt, deren zunehmender politischer Einfluss in ganz Deutschland und zuletzt auch immer mehr in Europa unverkennbar geworden war und ist.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zum einen, die CSU in ihrer Gesamtheit zu skizzieren. Hierbei wird auf die Entstehungsgeschichte, Programmatik und Organisationsstruktur der Partei eingegangen.
Zum anderen wird die besondere Rolle der CSU auf bundespolitischer Ebene im Allgemeinen und ihr - oft etwas gespaltenes - Verhältnis zur Schwesterpartei CDU im Besonderen behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Porträt der Christlich-Sozialen Union
- Die Entstehungsgeschichte
- Die programmatischen Grundsätze
- Die Organisationsstruktur
- Mitgliederstruktur und Mitgliederentwicklung
- Organisatorische Gliederung
- Die Organe des Landesverbandes
- Der Sonderstatus der CSU in der Bundespolitik
- Ideologische, traditionelle und verfassungspolitische Grundlagen
- Beharren auf einen streng föderalistischen Staatsaufbau
- Das „Ja“ zu Deutschland
- Das Verhältnis zur Schwesterpartei CDU – Eine konkurrierende Kooperation
- Ursachen und Auswirkungen der starken Position der CSU gegenüber der CDU und die bilaterale Abhängigkeit zwischen beiden Parteien
- Diskrepanzen und Krisen zwischen beiden Parteien
- Sonderrechte der CSU innerhalb der Bundestagsfraktion und die Funktion im Bund
- Ideologische, traditionelle und verfassungspolitische Grundlagen
- Ist ein Ende der CSU-Hegemonie in Bayern in Sicht?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Christlich-Soziale Union (CSU) und ihre besondere Stellung in der deutschen Bundespolitik. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte, die programmatischen Grundsätze und die Organisationsstruktur der CSU zu beleuchten, sowie ihre Rolle im bundespolitischen Kontext und ihr Verhältnis zur CDU zu analysieren. Die Arbeit fragt auch nach der zukünftigen Position der CSU in Bayern.
- Die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der CSU
- Die programmatischen Grundsätze und ideologische Ausrichtung der CSU
- Der Sonderstatus der CSU in der Bundespolitik und ihr Verhältnis zur CDU
- Die Organisationsstruktur und Mitgliederentwicklung der CSU
- Die Zukunft der CSU in Bayern
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort reflektiert die gängigen, oft klischeehaften Vorstellungen über Bayern und seine Bevölkerung, insbesondere im Kontext des Seminars „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“. Der Autor beschreibt diese Vorurteile als teilweise haltlos und begründet seine Hausarbeit mit dem Wunsch, dem Phänomen Bayern und seiner „Staatspartei“, der CSU, genauer nachzugehen. Die Wahl der männlichen Formulierung für Parteiämter wird als rein stilistisch begründet und nicht als diskriminierend dargestellt.
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einer humorvollen, aber treffenden Charakterisierung des Bayern und seiner Eigenheiten. Sie beschreibt das ausgeprägte National- und Heimatgefühl, die „Mir san mir“-Mentalität und den Hang zur Unabhängigkeit als wesentliche Charakteristika der bayerischen Bevölkerung. Diese Eigenschaften werden in Zusammenhang mit der Entstehung der CSU im Nachkriegsbayern gebracht, die sich als bayerisches Pendant zu den christdemokratischen Unionsparteien in anderen Bundesländern etablierte. Die Arbeit skizziert die Ziele der Untersuchung: eine umfassende Darstellung der CSU (Kapitel 1) und eine Analyse ihrer besonderen Rolle in der Bundespolitik, besonders im Verhältnis zur CDU (Kapitel 2).
1. Porträt der Christlich-Sozialen Union: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die CSU. Es beginnt mit der Darstellung der Bayerischen Volkspartei (BVP) als Vorläuferpartei, beschreibt die Gründung der CSU im Jahr 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg und die Rolle von Persönlichkeiten wie Adam Stegerwald und Josef Müller. Die Entstehung der CSU wird im Kontext des Wiederaufbaus Deutschlands und der Bemühungen um eine christlich-demokratische Partei in Bayern dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die programmatischen Grundsätze und die Organisationsstruktur der Partei, möglicherweise auch ihre Mitgliederentwicklung und interne Organisation.
2. Der Sonderstatus der CSU in der Bundespolitik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die einzigartige Stellung der CSU in der Bundespolitik. Es analysiert die ideologischen, traditionellen und verfassungspolitischen Grundlagen ihrer starken Position, insbesondere das Beharren auf einem föderalistischen Staatsaufbau und ihre besondere Beziehung zu Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis der CSU zu ihrer Schwesterpartei CDU, einer „konkurrierenden Kooperation“, die durch Ursachen, Auswirkungen, Diskrepanzen und Krisen gekennzeichnet ist. Die Sonderrechte der CSU innerhalb der Bundestagsfraktion und ihre Funktion im Bund werden detailliert untersucht. Das Kapitel beleuchtet die komplexe Dynamik der Zusammenarbeit und der Konkurrenz zwischen den beiden Parteien.
Schlüsselwörter
Christlich-Soziale Union (CSU), Bayerische Volkspartei (BVP), Bundespolitik, CDU, Föderalismus, Parteiensystem, Bayern, Parteiorganisation, Ideologie, Wahlverhalten.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die CSU - Bayern und die Bundespolitik
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Christlich-Soziale Union (CSU), ihre Entstehungsgeschichte, programmatischen Grundsätze, Organisationsstruktur und ihre besondere Rolle in der deutschen Bundespolitik, insbesondere im Verhältnis zur CDU. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der zukünftigen Position der CSU in Bayern.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der CSU, ihre programmatischen Grundsätze und ideologische Ausrichtung, ihren Sonderstatus in der Bundespolitik und das Verhältnis zur CDU, die Organisationsstruktur und Mitgliederentwicklung der CSU sowie die Zukunftsaussichten der CSU in Bayern.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst ein Vorwort, eine Einleitung, Kapitel über das Porträt der CSU (inkl. Entstehungsgeschichte, programmatische Grundsätze und Organisationsstruktur) und den Sonderstatus der CSU in der Bundespolitik (inkl. Verhältnis zur CDU), sowie ein abschließendes Kapitel zur zukünftigen Position der CSU in Bayern und ein Literaturverzeichnis.
Was wird im Kapitel "Porträt der CSU" behandelt?
Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die CSU, beginnend mit ihren Vorläuferparteien (BVP), ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg, ihren programmatischen Grundsätzen und ihrer Organisationsstruktur inklusive Mitgliederentwicklung und interner Organisation.
Was ist der Fokus des Kapitels "Sonderstatus der CSU in der Bundespolitik"?
Dieses Kapitel analysiert die einzigartige Stellung der CSU in der Bundespolitik, ihre ideologischen, traditionellen und verfassungspolitischen Grundlagen (z.B. Föderalismus), und vor allem ihr komplexes Verhältnis zur CDU – eine „konkurrierende Kooperation“. Es untersucht Ursachen, Auswirkungen, Diskrepanzen und Krisen in der Beziehung zwischen den beiden Parteien sowie die Sonderrechte der CSU in der Bundestagsfraktion.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit bezüglich der Zukunft der CSU?
Die Hausarbeit untersucht die Frage, ob ein Ende der CSU-Hegemonie in Bayern in Sicht ist. Konkrete Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Analyse der vorherigen Kapitel und werden im entsprechenden Kapitel zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Christlich-Soziale Union (CSU), Bayerische Volkspartei (BVP), Bundespolitik, CDU, Föderalismus, Parteiensystem, Bayern, Parteiorganisation, Ideologie, Wahlverhalten.
Wie wird die männliche Formulierung für Parteiämter gerechtfertigt?
Der Autor begründet die Verwendung der männlichen Formulierung für Parteiämter rein stilistisch und betont, dass dies nicht diskriminierend gemeint ist.
Welche Vorurteile über Bayern und die CSU werden im Vorwort angesprochen?
Das Vorwort reflektiert gängige Klischees über Bayern und seine Bevölkerung, insbesondere im Kontext des Seminars "Das politische System der Bundesrepublik Deutschland", und der Autor beschreibt diese als teilweise haltlos.
Wie beschreibt die Einleitung Bayern und seine Bevölkerung?
Die Einleitung charakterisiert Bayern und seine Bevölkerung humorvoll, aber treffend, indem sie auf das ausgeprägte National- und Heimatgefühl, die „Mir san mir“-Mentalität und den Hang zur Unabhängigkeit eingeht.
- Arbeit zitieren
- Werner Martin (Autor:in), 2000, Die Christlich-Soziale Union (CSU) und ihre Sonderstellung in der Bundespolitik: Ursachen und Erscheinungsformen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46026