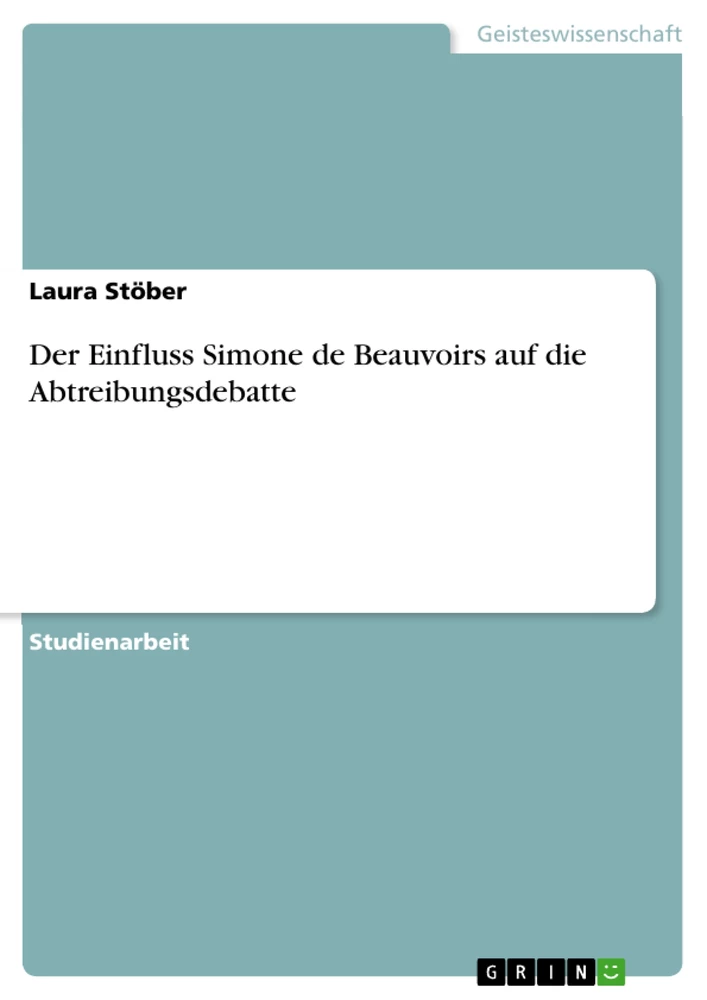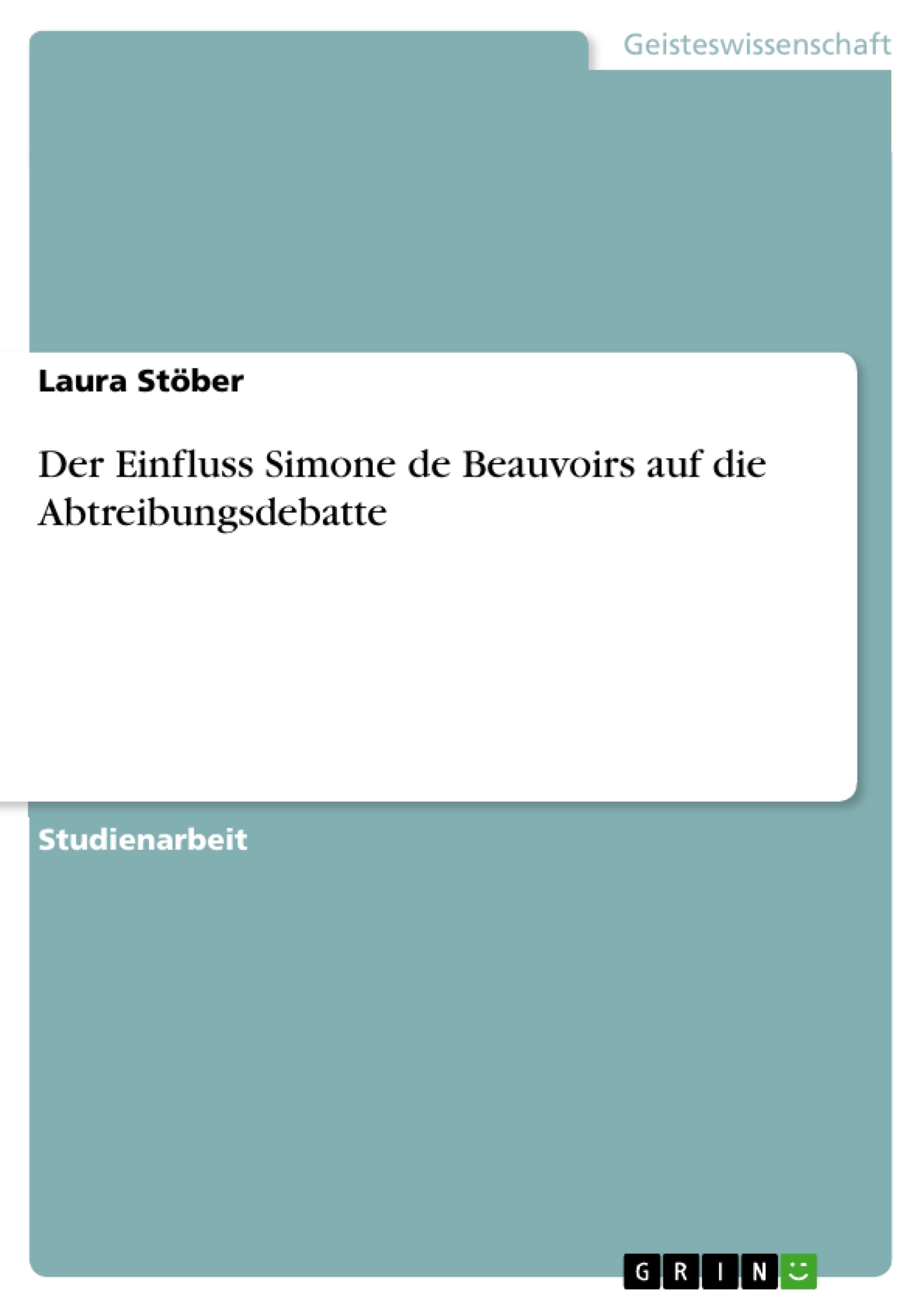Der Diskurs um Abtreibung und um die Neuregelung der Rechtslage gehört zu den umstrittensten der letzten Jahre. Feministinnen kritisieren die bis heute staatliche Kontrolle über den Körper der Frau. Diese Kritik an den scheinbar schon immer bestehenden rechtlichen und gesellschaftlichen Restriktionen äußerte die Autorin Simone de Beauvoir bereits im Jahr 1949 in ihrem Werk "Das andere Geschlecht". Sie stellte fest, dass die Rechtsprechung aus der Abtreibung ein Verbrechen macht, was sie vehement ablehnte und eine gesetzlich erlaubte Abtreibung forderte. Ihre Argumente sollten als Grundlage für die Diskursanalyse in Deutschland dienen. In dieser Arbeit soll diskutiert werden, wie relevant und aktuell die Argumente von Simone de Beauvoir in der Abtreibungsdebatte von 1970 bis 1995 in Deutschland waren.
Dazu wird das Werk Simone de Beauvoirs vorgestellt und ihre Argumente, mit der sie eine Abtreibungserlaubnis begründet, analysiert. Schließlich wird die Kontroverse um den Paragraphen 218 StGB in Deutschland beleuchtet. Danach wird der Abtreibungskonflikt in Deutschland bis in die 1970er Jahre beschrieben, um die öffentliche Debatte um die Abtreibung in den 1970er Jahren besser zu verstehen. Die Argumente der Gegner und Befürworter eines Abtreibungsverbots werden interpretiert und in ihren Bezügen zu Simone de Beauvoirs Werk untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abtreibung und Mutterschaft in „Das andere Geschlecht“ von Simone de Beauvoir
- Fallbeispiel: Die Kontroverse um den §218 StGB
- Der Abtreibungskonflikt im historischen Kontext
- Argumente für ein Abtreibungsverbot
- Argumente gegen ein Abtreibungsverbot
- Der gesetzliche Änderungsprozess des §218 zwischen 1970 und 1995
- §219 Schwangerschaftskonfliktberatung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Kontroverse um den §218 StGB in Deutschland im Zeitraum von 1970 bis 1995. Dabei wird untersucht, inwiefern die Argumente aus Simone de Beauvoirs Werk „Das andere Geschlecht“ in die Debatte um Abtreibung einfließen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Relevanz von de Beauvoirs Thesen für den deutschen Abtreibungskonflikt zu erforschen.
- Die Rolle der Mutterschaft in der gesellschaftlichen Konstruktion der Frau
- Die rechtliche und gesellschaftliche Kontrolle über die weibliche Reproduktionsfähigkeit
- Die Auseinandersetzung mit Argumenten für und gegen ein Abtreibungsverbot
- Der Einfluss von „Das andere Geschlecht“ auf die Abtreibungsdebatte in Deutschland
- Der gesetzliche Änderungsprozess des §218 und seine gesellschaftlichen Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Rahmen der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die Argumentation von Simone de Beauvoir in „Das andere Geschlecht“ bezüglich Abtreibung und Mutterschaft. Kapitel 3 befasst sich mit der Kontroverse um den §218 StGB in Deutschland. Es werden historische Hintergründe, Argumente für und gegen ein Abtreibungsverbot sowie der gesetzliche Änderungsprozess analysiert. Kapitel 4 stellt den §219 Schwangerschaftskonfliktberatung vor. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Konflikte und Diskurse.
Schlüsselwörter
Abtreibung, §218 StGB, Simone de Beauvoir, „Das andere Geschlecht“, Mutterschaft, Frauenrechte, gesellschaftliche Normen, rechtliche Kontrolle, Abtreibungsdebatte, Schwangerschaftskonfliktberatung, Feminismus, Gender, Reproduktionsfähigkeit.
- Arbeit zitieren
- Laura Stöber (Autor:in), 2016, Der Einfluss Simone de Beauvoirs auf die Abtreibungsdebatte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/460496