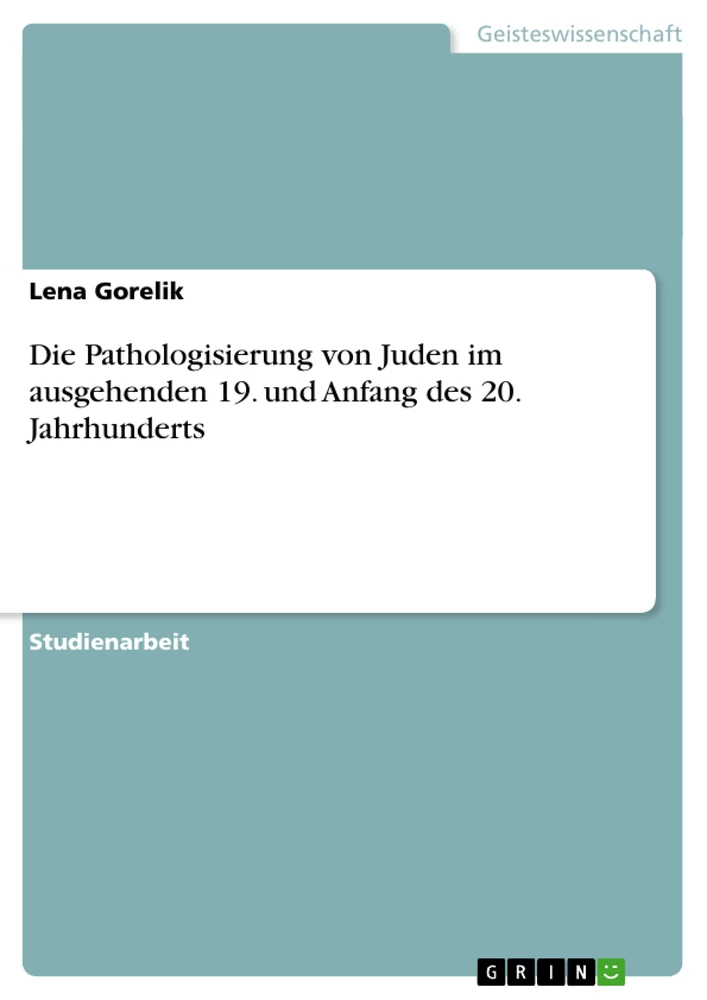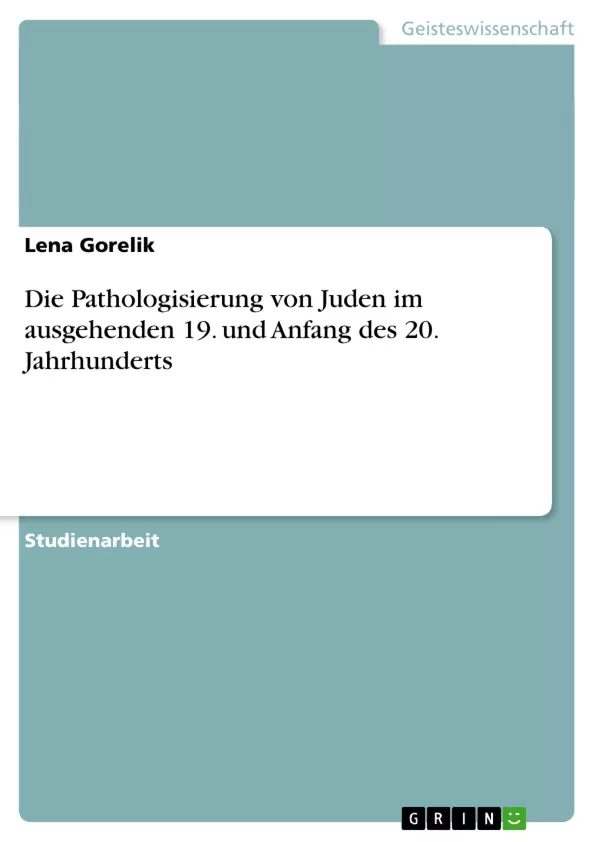Bereits im 18. Jahrhundert setzte sich sowohl in der Psychologie als auch in der Medizin die Ansicht durch, dass Juden anders gebaut seien als Nichtjuden. So wurden diese beiden Gruppen getrennt voneinander untersucht und in Studien miteinander verglichen. Mit der Zeit wurde dieser Trend verstärkt und auf andere wissenschaftliche Bereiche, aber genauso auch auf das Alltagsleben übertragen. Dieser Trend ist als Hinweis darauf zu verstehen, dass die Integration der Westjuden in Deutschland nicht so funktioniert hatte, wie diese das gerne gesehen hätten. In dieser Zeit entstanden auch Begriffe wie Judenfrage und Judenkrankheit. Auf der anderen Seite spielte im ausgehenden 19. Jahrhundert in der Medizinwissenschaft das Nervensystem eine zentrale und zunehmende Rolle. Neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet führten dazu, dass es die Seele als Untersuchungsobjekt, aber auch als Erklärungsmodell ablöste. So gewann auch Nervenschwäche als Krankheit nicht nur in der Forschung sondern auch im Alltagsobjekt an Bedeutung: Sie wurde als Antonym zu bürgerlichen Zielen und Tugenden wie beispielsweise Karriere gesetzt. Parallel zu dieser Entwicklung setzte sich das Gerücht durch, dass Juden besonders oft an dieser Krankheit litten. Dieses anfänglich nicht auf wissenschaftlichen Daten basierende Gerücht wurde mit dem sozialen Aufstieg und dem anwachsenden Ansehen der Ärzte „medikalisiert“. Nach dem Motto „ alles, was n icht bürgerlich ist, ist krank“ wurden Juden als nervenschwach und geisteskrank abgestempelt.
Als Nervenschwäche und Krankheit galt in dieser Zeit auch Masturbation. Weil dabei Nervenenergie verloren gehe, wirke sie sich negativ auf den Körper aus, hieß es damals. Gleichzeitig verstöße Masturbation gegen bürgerliche Werte und mache Männer weiblicher. Weil Juden aufgrund ihrer Frühreife angeblich mehr masturbierten als Nichtjuden, sprach man nun auch von einer „Verweiblichung“ der Juden. Das Vorurteil der Frühreife beruhte auf der Tatsache, dass in jüdischen Familien aufgrund von Traditionen oft früher geheiratet wurde als in christlichen. Ein weiteres, zu jener Zeit übliches Vorurteil lautete, „religiöse Schwärmerei“ hänge mit Nervenkrankheiten zusammen und komme vor allem bei Frauen und Juden vor. Bei Frauen liege dies an einer Nichtbefriedigung der sinnlichen Sexualität, bei Juden an ihrer besonders ausgeprägten Disposition zur Masturbation. Damit wurde die Religiösität von Juden erklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische Einführung
- Die Verweiblichung der Juden und die Abgrenzung der Westjuden
- Die angeblich pathogene Kultur der Juden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat befasst sich mit der Pathologisierung von Juden im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Es untersucht, wie die Stereotypisierung von Juden in dieser Zeit medizinisch und wissenschaftlich begründet wurde und sich in verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erstreckte.
- Die Konstruktion von Juden als körperlich und psychisch andersartig
- Die Rolle von medizinischen Theorien und Vorurteilen bei der Verweiblichung von Juden
- Die Behauptung einer pathogenen jüdischen Kultur und die Verbindung zwischen Religion und Geisteskrankheiten
- Die Unterscheidung zwischen Ost- und Westjuden und die Verwendung von Stereotypen zur Abgrenzung
- Die Folgen der Pathologisierung für die Integration und Assimilation von Juden
Zusammenfassung der Kapitel
Theoretische Einführung
Das erste Kapitel behandelt die Entstehung von Stereotypen, die Juden als andersartig darstellten. Es wird auf die Entwicklung von medizinischen Theorien und die Verwendung wissenschaftlicher Methoden zur Begründung dieser Stereotypisierung eingegangen. Außerdem wird die Rolle der „Judenfrage“ und die Verknüpfung von Juden mit Krankheiten wie Nervenschwäche beleuchtet.
Die Verweiblichung der Juden und die Abgrenzung der Westjuden
In diesem Kapitel werden die Mechanismen der Verweiblichung von Juden im 19. Jahrhundert näher betrachtet. Es werden verschiedene medizinische und kulturelle Argumente beleuchtet, die zur Konstruktion von Juden als weiblich führten. Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Ost- und Westjuden für die Etablierung und Weitergabe von Stereotypen wird thematisiert. Auch die Strategie der Westjuden, sich von den Ostjuden abzugrenzen und sich so von den Stereotypen zu distanzieren, wird untersucht.
Die angeblich pathogene Kultur der Juden
Im dritten Kapitel werden Studien von prominenten Psychologen wie Emil Kraeplin und Richard von Kraft-Ebing untersucht, die die Verbindung zwischen Religion und Geisteskrankheiten beleuchteten und Juden als besonders anfällig für diese Krankheiten darstellten. Das Kapitel beleuchtet auch die Reaktion jüdischer Psychiater auf diese Theorien und die Versuche, die Stereotypisierung zu widerlegen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in diesem Referat sind: Pathologisierung, Stereotype, Antisemitismus, Judenfrage, Verweiblichung, Ostjuden, Westjuden, Geisteskrankheit, Kultur, Religion, Assimilation, Medizin, Wissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die „Pathologisierung von Juden“?
Es beschreibt den Trend im 19. Jahrhundert, jüdische Merkmale und Verhaltensweisen als medizinisch krankhaft oder biologisch minderwertig darzustellen.
Was war die „Judenkrankheit“?
Dies war ein antisemitisches Klischee, das behauptete, Juden litten besonders häufig an Nervenschwäche (Neurasthenie) und Geisteskrankheiten.
Wie wurde die „Verweiblichung“ der Juden begründet?
Mediziner behaupteten, durch Masturbation und „Frühreife“ würden jüdische Männer ihre männliche Energie verlieren und weibliche Züge annehmen.
Gab es Unterschiede in der Wahrnehmung von Ost- und Westjuden?
Ja, Westjuden versuchten oft, sich von den als „krankhaft“ oder „unmodern“ stigmatisierten Ostjuden abzugrenzen, um ihre eigene Integration zu fördern.
Welche Rolle spielte die Wissenschaft bei diesem Vorurteil?
Wissenschaftler wie Emil Kraepelin medikalisierten soziale Vorurteile, indem sie religiöse Praktiken als psychische Dispositionen deuteten.
- Citar trabajo
- Lena Gorelik (Autor), 2005, Die Pathologisierung von Juden im ausgehenden 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46117