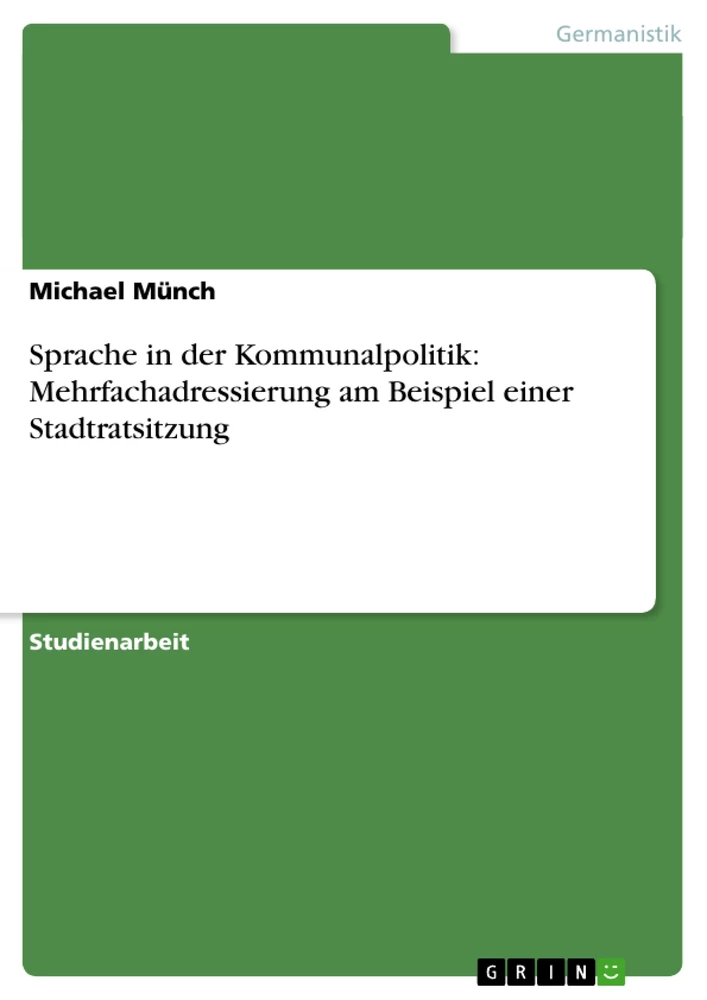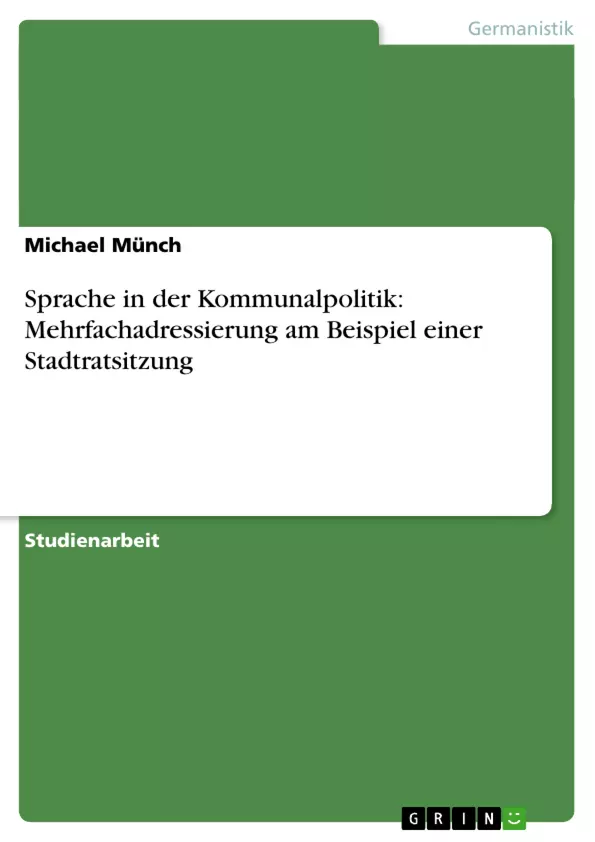Die Sprache der Politik ist die Sprache der Macht konstatierten Harold Laswell und Nathan Leiters 1965. Ihr Ziel sei die Herstellung einer politischen und kulturellen Ordnung nach dem Vorbild einer Ideologie (Vgl. Bergsdorf, 1978, 49). So entscheidet die Sprache der Politik über Recht oder Unrecht und trifft verbindliche Entscheidungen für die Bevölkerung. Damit ist gezeigt, dass die politische Sprache auch gleichzeitig politisches Handeln bedeutet. Denn ein politischer Beschluss kann für Tausende oder gar Millionen Menschen eine Veränderung ihres eigenen Lebens bedeuten, ohne dass diese an der direkten Formulierung des Beschlusses und damit an dessen Inhaltsfestlegung beteiligt waren.
Gleichzeitig regt die Sprache der Politik aber auch an zur Diskussion und versucht die Handlungen der politischen Führung durch Erklärungen für die Bevölkerung einsichtig zu machen. Dieser Punkt ist insbesondere für einen demokratischen Staat unerlässlich. Politiker sämtlicher Couleur schreiben sich Transparenz auf die Fahne. Um diese zu erreichen wenden sie sich in Kundgebungen oder über die Medien an die Bevölkerung und werben um Verständnis für die getroffenen Entscheidungen. Doch schon dieser Prozess zeigt, dass die Sprache der Politik weitaus mehr beinhaltet als die Festlegung von Beschlüssen und Gesetzen oder die notwendigen Erklärungsversuche. Zur politischen Kommunikation gehört neben der Argumentation, der Information, der Überzeugungsarbeit und rhetorischem Geschick auch das Werben um Zustimmung sowie die Manipulation, um den Gegner in die sprachliche Defensive zu bringen. Ein Vergleich dieser (mit Sicherheit unvollständigen Aufzählung) mit der politischen Realität macht deutlich, dass die einzelnen Aspekte fast nie getrennt auftreten, sich jedoch meistens an unterschiedliche Adressaten wenden. Diese Arbeit wird sich daher mit dem Problem der Mehrfachadressierung politischer Kommunikation beschäftigen. Hierbei werden die Fragen zu klären sein, wie es zur Mehrfachadressierung kommt, in welcher Weise sie von Politikern (bewusst oder unbewusst) angewendet wird und wer die tatsächlichen Empfänger sind.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele politischer Kommunikation
- Die politische Debatte
- Das Konzept der Mehrfachadressierung
- Fallbeispiel Stadtratsitzung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept der Mehrfachadressierung in der politischen Kommunikation, insbesondere im Kontext der Kommunalpolitik. Sie beleuchtet, wie Politiker unterschiedliche Adressaten in ihren Äußerungen berücksichtigen und welche Sprachhandlungen dabei zum Einsatz kommen.
- Die verschiedenen Ziele politischer Kommunikation
- Die Bedeutung der Mehrfachadressierung in der politischen Sprache
- Die Analyse von Sprachhandlungen in der parlamentarischen Debatte
- Die Anwendung der Mehrfachadressierung in der Praxis anhand eines Fallbeispiels
- Die Auswirkungen der Mehrfachadressierung auf die politische Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Mehrfachadressierung in der politischen Kommunikation vor und erläutert die Relevanz der Sprache in politischen Prozessen. Sie stellt die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit dar.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Zielen politischer Kommunikation. Es werden das Persuasionsmodell von Kopperschmidt und das Sprachhandlungsmodell von Holly vorgestellt, um die verschiedenen Absichten, die ein Politiker mit seinen Äußerungen verfolgt, zu analysieren.
- Kapitel drei behandelt die politische Debatte und analysiert die sprachlichen Mittel, die im Rahmen der parlamentarischen Diskussion eingesetzt werden. Es werden die unterschiedlichen Rollen und Funktionen der Sprache in der Debatte beleuchtet.
- Kapitel vier beschäftigt sich mit dem Konzept der Mehrfachadressierung und untersucht, wie Politiker in ihren Äußerungen unterschiedliche Adressaten berücksichtigen. Es werden die verschiedenen Formen der Mehrfachadressierung und ihre Auswirkungen auf die politische Kommunikation analysiert.
- Kapitel fünf stellt ein Fallbeispiel einer Stadtratsitzung vor und analysiert die Sprache der politischen Akteure anhand der theoretischen Grundlagen der vorherigen Kapitel.
Schlüsselwörter
Mehrfachadressierung, politische Kommunikation, Kommunalpolitik, Stadtratsitzung, Sprachhandlungen, Persuasionsmodell, Sprachhandlungsmodell, Rhetorik, Debatte, politische Debatte, Parlamentsdebatte, Demokratie, Ziele politischer Kommunikation, Adressaten, Empfänger, Medien-Öffentlichkeit, politische Sprache, Sprache der Macht, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Mehrfachadressierung in der Politik?
Es beschreibt das Phänomen, dass Politiker in einer Rede gleichzeitig verschiedene Zielgruppen (z.B. Parteikollegen, Opposition und Wähler) mit unterschiedlichen Botschaften ansprechen.
Warum ist die Sprache der Politik auch eine „Sprache der Macht“?
Politische Sprache setzt Beschlüsse fest und definiert Recht oder Unrecht, wodurch sie direkt das Leben von Millionen Menschen beeinflusst.
Wie wird Mehrfachadressierung in Stadtratssitzungen eingesetzt?
Stadträte sprechen oft technisch für das Protokoll, aber gleichzeitig rhetorisch für die anwesende Presse oder Bürger, um Zustimmung für ihre Positionen zu gewinnen.
Welche Rolle spielt die Manipulation in der politischen Kommunikation?
Manipulation wird oft genutzt, um den politischen Gegner sprachlich in die Defensive zu bringen oder komplexe Sachverhalte einseitig darzustellen.
Was ist das Sprachhandlungsmodell nach Holly?
Dieses Modell analysiert, welche konkreten Absichten (z.B. Überzeugen, Informieren, Werben) hinter politischen Äußerungen stehen.
Warum ist Transparenz in der politischen Sprache so schwierig?
Obwohl Politiker Transparenz fordern, führt die Notwendigkeit der Mehrfachadressierung oft zu vagen Formulierungen, um keine der verschiedenen Zielgruppen zu verschrecken.
- Citar trabajo
- Michael Münch (Autor), 2004, Sprache in der Kommunalpolitik: Mehrfachadressierung am Beispiel einer Stadtratsitzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46131