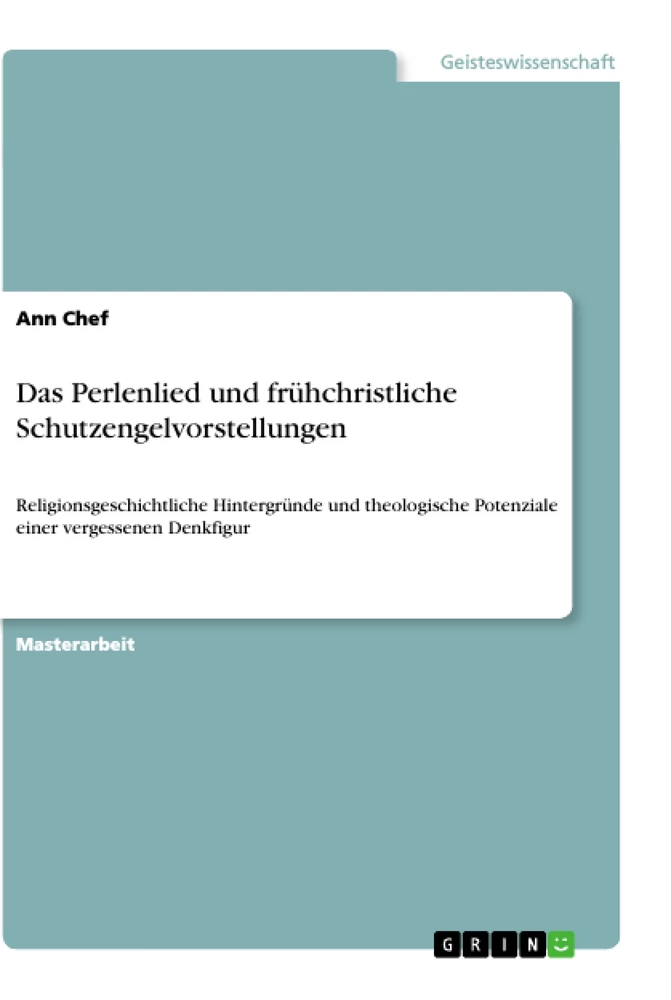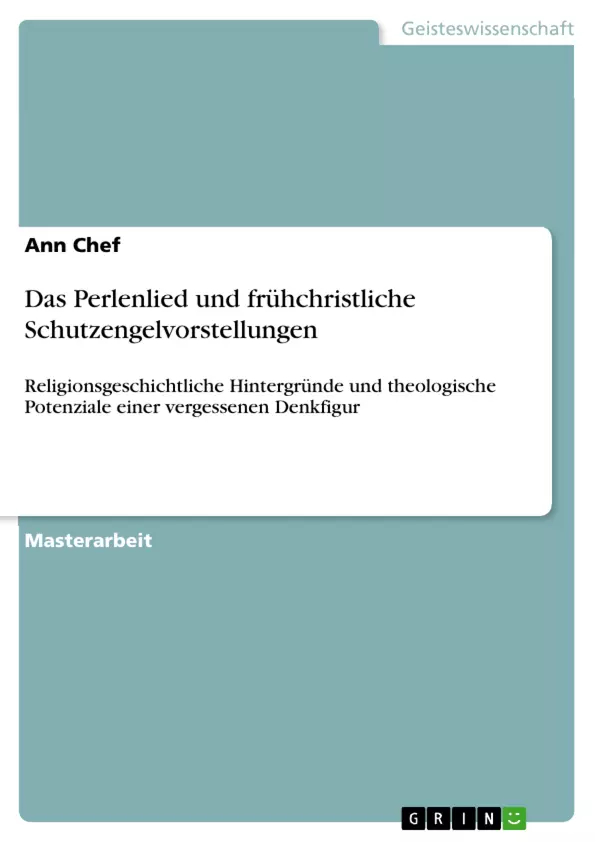Seit Jahren erlebt der Glaube an Schutzengel nahezu eine Hochkonjunktur und ist aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken, denn nicht selten spürt man, dass man in schwierigen oder gefährlichen Situationen eben nicht alleine ist, sondern dass man sich geschützt und behütet fühlt – von einem höheren Wesen, welches man als persönlichen Schutzengel identifiziert.
Dabei ist der Glaube an einen persönlichen Schutzengel anscheinend nicht mit dem Glauben an Gott gekoppelt, denn heutzutage glaubt nur noch knapp jeder Dritte in Deutschland an Gott. An den persönlichen Schutzengel glauben jedoch über die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen, wobei die Ursachen dafür vielfältig sind. Zum einen drückt der Schutzengel aus, dass der Mensch in dieser Welt bzw. im gesamten Universum nicht alleine ist, sondern dass ebenfalls höhere Mächte existieren, die sich wissenschaftlich meist nur schwer oder nicht explizit beweisen lassen. Zum anderen besteht die Vorstellung eines Schutzengels länger als die Religion sowie die Kultur des Christentums.
Der Schutzengelglaube lässt sich aber auch heute noch als ein gegenwärtiges und durchaus religionssoziologisches Massenphänomen der Gesellschaft beschreiben, welches in der vorliegenden Arbeit näher zu beleuchten gilt. Jenes religionssoziologische Massenphänomen hat sich dahingehend so weitreichend entwickelt, dass auch der römisch-katholische Theologe Thomas Ruster schon von der neuen „Engelreligion“ spricht, sodass die Relevanz dieser Thematik für Theologie und Kirche nicht mehr zu verkennen ist. Es finden sich auch schon in frühchristlichen kanonischen sowie außerkanonischen Texten Andeutungen auf Schutzengel, denen jeweils ein anderes Verständnis und unterschiedliche Vorstellungen zugrunde liegen.
Diese Zeugnisse belegen, dass der Glaube an Schutzengel durchaus zutiefst christlich ist. Umso mehr verwundert es, dass heutzutage im systematisch-theologischen sowie kirchlichen Kontext das Thema des begleitenden Schutzengels nicht mehr auftaucht und eine fruchtbare Begegnung von Schutzengelvorstellungen mit Theologie und Kirche zunehmend durch eine Nichtthematisierung erschwert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Anspielungen auf Schutzengelvorstellungen im frühen Christentum
- 1.2 Zur Verortung des „Perlenliedes“
- 1.3 Struktur und Methodik
- 2. Zu Text und Inhalt des „Perlenliedes“
- 2.1 Grundzüge der Erzählung
- 2.2 Deutungsmöglichkeiten
- 3. Analogien von Schutzengelvorstellungen im „Perlenlied“
- 4. Religionsgeschichtliche Hintergründe zu Schutzengelvorstellungen im ,,Perlenlied"
- 4.1 Platons Seelenwanderungslehre
- 4.2 Die platonischen „Daimonia“ als Lebensbegleiter
- 4.3 Die Überlieferungen zu platonischen „Daimonia“ bei Plutarch
- 4.4 Traditionen des Thomasevangeliums als Parallelen zum „Perlenlied“
- 5. Die Verdrängung der Schutzengel aus Theologie und Kirche
- 5.1 Warnung vor den Engeln
- 5.2 Systematisch-theologische Perspektiven zur Angelologie
- 5.2.1 Thomas Ruster
- 5.2.2 Karl Rahner
- 5.2.3 Karl Barth
- 5.2.4 Wolfhart Pannenberg
- 5.2.5 Wilfried Härle
- 6. Der Glaube an Schutzengel als Phänomen der Gegenwartsreligiösität
- 6.1 Der Schutzengelglaube als religionssoziologisches Massenphänomen
- 6.2 Schutzengelvorstellungen von Jana Haas als Beispiel einer Gegenwartsreligiösität
- 6.3 Parallelen der Schutzengelvorstellungen von Jana Haas zu platonischen Schutzengelvorstellungen
- 6.4 Parallelen der Schutzengelvorstellungen von Jana Haas zum „Perlenlied"
- 7. Potenziale von Schutzengelvorstellungen für Theologie und Kirche in der Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Glauben an Schutzengel in Bezug auf das „Perlenlied“, einen frühchristlichen Text, und beleuchtet dessen religionsgeschichtliche Hintergründe sowie die Bedeutung dieser Denkfigur für die Theologie und Kirche der Gegenwart. Dabei soll die Verdrängung des Schutzengelglaubens in der systematisch-theologischen Diskussion aufgezeigt werden, um die Relevanz des Themas für die heutige Zeit zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf den potenziellen Chancen, die der Schutzengelglaube für die Theologie und Kirche bietet.
- Religionsgeschichtliche Hintergründe des Schutzengelglaubens
- Das „Perlenlied“ als Quelle frühchristlicher Schutzengelvorstellungen
- Die Verdrängung des Schutzengelglaubens in der systematisch-theologischen Diskussion
- Der Schutzengelglaube in der Gegenwartsreligiösität
- Potenziale von Schutzengelvorstellungen für Theologie und Kirche in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Relevanz des Schutzengelglaubens und stellt die Thematik in den Kontext frühchristlicher Texte. Kapitel 2 analysiert den Text des „Perlenliedes“ und deutet dessen Bedeutung im Hinblick auf Schutzengelvorstellungen. Kapitel 3 untersucht Analogien zwischen Schutzengelvorstellungen im „Perlenlied“ und anderen frühen christlichen Quellen. Kapitel 4 erforscht die religionsgeschichtlichen Wurzeln des Schutzengelglaubens, insbesondere die Platonsche Seelenwanderungslehre und die platonischen „Daimonia“. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Verdrängung der Schutzengel aus Theologie und Kirche, indem es verschiedene systematisch-theologische Positionen dazu beleuchtet. Kapitel 6 untersucht den Schutzengelglaube als Phänomen der Gegenwartsreligiösität und analysiert anhand von Jana Haas ein aktuelles Beispiel. Kapitel 7 schließlich beleuchtet die Potenziale von Schutzengelvorstellungen für Theologie und Kirche in der Gegenwart.
Schlüsselwörter
Schutzengel, „Perlenlied“, frühchristliche Texte, Religionsgeschichte, Theologie, Kirche, Gegenwartsreligiösität, Platonsche Seelenwanderungslehre, „Daimonia“, Systematische Theologie, Angelologie, Thomas Ruster, Karl Rahner, Karl Barth, Wolfhart Pannenberg, Wilfried Härle, Jana Haas.
- Citar trabajo
- Ann Chef (Autor), 2018, Das Perlenlied und frühchristliche Schutzengelvorstellungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461371