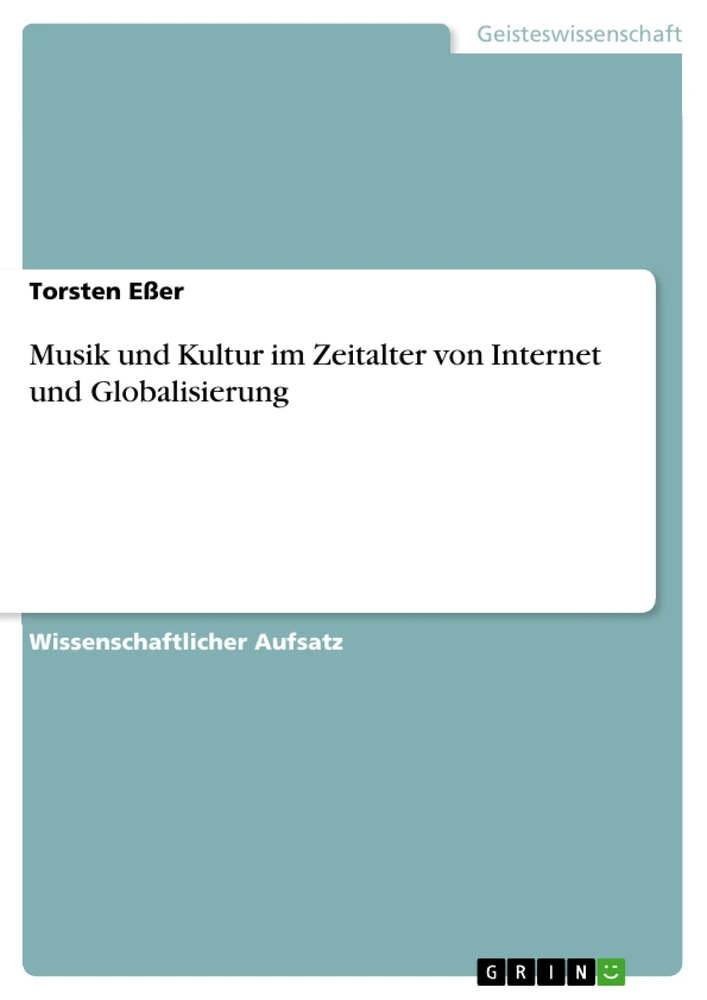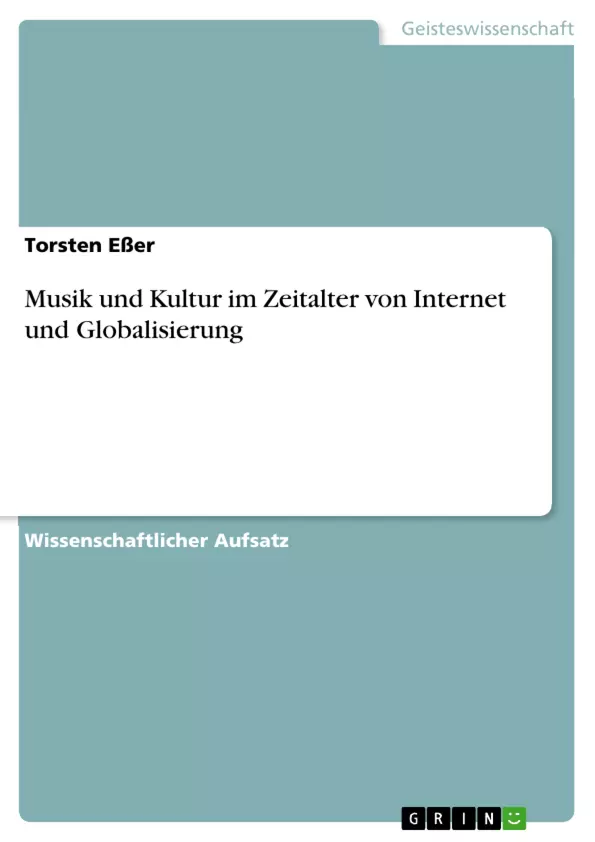Um zu verstehen, was das Internet und die damit einhergehende Globalisierung mit Kultur, Musik und Musikindustrie zu tun haben und welche Auswirkungen damit verbunden sind, sollte man den „Mythos Internet“ aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und auch seine Geschichte kennen. Zu beidem gibt diese Arbeit Gelegenheit.
Inhaltsverzeichnis
- Musik und Kultur im Zeitalter von Internet und Globalisierung.
- Ein atombombensicheres Kommunikationsnetz.
- Globalisierung und die Generation @
- Globalisierung der Musik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss des Internets und der Globalisierung auf Kultur, Musik und die Musikindustrie. Es erörtert den „Mythos Internet“ aus verschiedenen Perspektiven und beleuchtet seine Geschichte. Das Kapitel analysiert die Entwicklung des Internets, insbesondere im Hinblick auf die Entstehung des „Globalen Dorfes“ und die Auswirkungen auf die Musiklandschaft.
- Die Entwicklung des Internets als globales Kommunikationsnetz
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Musiklandschaft
- Die Rolle der Medienkonzerne im globalen Musikmarkt
- Die Kontroverse um das Internet: Chancen und Risiken
- Die kulturelle Globalisierung und ihre Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Ein atombombensicheres Kommunikationsnetz
Dieses Kapitel zeichnet die Geschichte des Internets nach, beginnend mit seinen militärischen Wurzeln im Kalten Krieg. Es beschreibt die Entstehung des paketorientierten Datenübertragungssystems und die Entwicklung des ARPANET. Das Kapitel beleuchtet die zunehmende Bedeutung des Internets in Wissenschaft und Gesellschaft, die Einführung von Diensten wie E-Mail und Newsgruppen sowie die Rolle der technischen Revolution und der Deregulierung der Telekommunikationsmärkte. Es erläutert die Entstehung des „World Wide Web“ und die rasante Verbreitung des Internets.
1.2 Globalisierung und die Generation @
Dieses Kapitel diskutiert die Kommerzialisierung des Internets und die zunehmende Machtkonzentration in der Musikindustrie. Es analysiert die Auswirkungen der Globalisierung auf die Musiklandschaft und die Rolle der Medienkonzerne. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen des Internets, die Kontroverse um die Nutzung des Netzes und die „Digital Divide“.
Schlüsselwörter
Internet, Globalisierung, Musik, Kultur, Musikindustrie, Medienkonzerne, Globales Dorf, Digital Divide, Kulturelle Homogenität, Kulturelle Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat das Internet die Musiklandschaft verändert?
Das Internet hat die Verbreitung von Musik globalisiert, neue Kommunikationswege geschaffen, aber auch zu einer Machtkonzentration bei großen Medienkonzernen geführt.
Was versteht man unter dem "Globalen Dorf" in Bezug auf Musik?
Es beschreibt die durch das Internet vernetzte Welt, in der kulturelle Inhalte wie Musik jederzeit und überall verfügbar sind, was zu kultureller Homogenisierung oder Heterogenität führen kann.
Welche militärischen Wurzeln hat das Internet?
Das Internet entstand ursprünglich als ARPANET, ein paketorientiertes, "atombombensicheres" Kommunikationsnetz während des Kalten Krieges.
Was bedeutet "Digital Divide"?
Der Begriff beschreibt die digitale Kluft zwischen gesellschaftlichen Gruppen oder Regionen, die Zugang zu moderner Informationstechnologie haben, und jenen, die davon ausgeschlossen sind.
Wer ist die "Generation @"?
Es bezeichnet die Generation, die mit dem Internet und der damit einhergehenden Globalisierung aufgewachsen ist und deren Musikkonsum maßgeblich digital geprägt ist.
- Quote paper
- Torsten Eßer (Author), 2000, Musik und Kultur im Zeitalter von Internet und Globalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461387