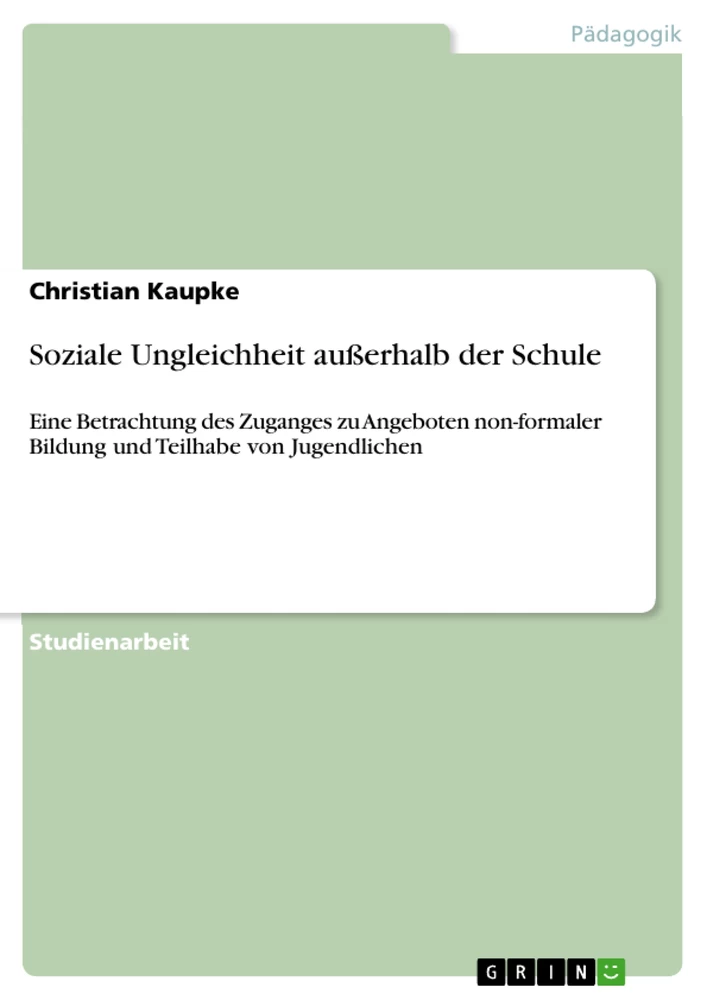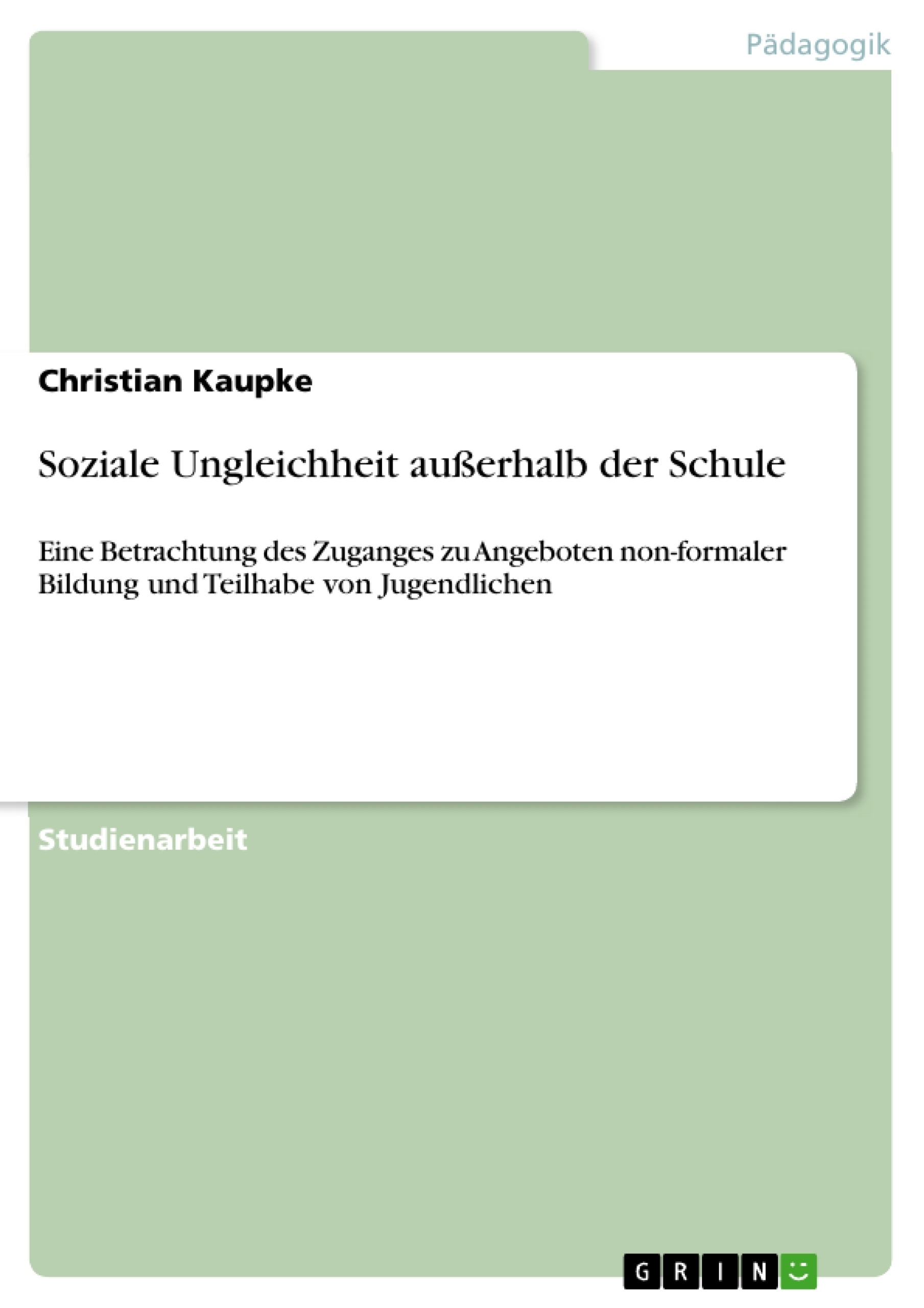Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Studie im Jahr 2001 sind teils heftige Diskurse um den Bildungszugang von Kindern und Jugendlichen geführt worden. Gemessen am internationalen Leistungsstandard belegte Deutschland eine eher schlechte Platzierung. Eine Grunderkenntnis in diesem Zusammenhang lautete, dass die soziale Herkunft der Schüler die Ausprägung ihrer Kompetenzen beeinflusst. Somit wurde für Politik und Öffentlichkeit die im deutschen Bildungssystem vorherrschende Bildungsungerechtigkeit mit erheblichen Nachteilen für Kinder aus einkommensschwachen Familien offengelegt. Seitdem sind seitens der Bundesregierung verschiedene politische Anstrengungen initiiert worden, um dieser festgestellten Bildungsungleichheit entgegenzuwirken und diese zu überwinden.
Es wurden auch in den Sozialleistungssystemen Mechanismen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Chancenungerechtigkeit, wie etwa 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket zur Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher geschaffen. Mit diesem Vorhaben soll eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für alle Kinder und Jugendlichen möglich sein. Insbesondere wurden so erstmals auf Bundesebene finanzielle Unterstützungsleistungen für außerschulische Nachhilfe, Vereinsmitgliedschaften, zur Ermöglichung von kostenlosem Mittagessen in Kindertagesstätte oder Schule wie auch der Teilnahme an kulturellen Aktivitäten geschaffen. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass Bildung nicht nur innerhalb der Schule stattfindet und damit eben auch immer mehr als formaler Unterricht ist, auch zielführend. Wie Grunert u.a. bereits ausführen, „verbringen Kinder und Jugendliche heute einen Großteil ihrer Zeit außerhalb der Schule auch innerhalb organisierter Freizeitarrangements.“. Die Bedeutung dieser Arrangements in Hinblick auf die Lern- und Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen steigt damit.
Zielsetzung dieses Moduls ist die bildungswissenschaftliche Beschäftigung mit einem selbst zu wählenden Themenfeld der Kindheits-und Jugendforschung. Dies geschieht mit dieser Hausarbeit, indem die Perspektive von Jugendlichen hinsichtlich ihres Zuganges zu Angeboten des non-formalen Bildungsbereiches außerhalb der Schule und dabei insbesondere auch der Zusammenhang zur jeweiligen Einkommenssituation innerhalb der Herkunftsfamilie und deren sozialer Positionierung in den Blick genommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Die 16. Shell-Studie 2010
- Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AIDA) 2009
- DIW-Wochenberichte zum Freizeitverhalten Jugendlicher bzw. zur Nachhilfe
- Freizeitverhalten Jugendlicher
- Nachhilfe
- Außerschulische Nachhilfe - eine Studie des Böckler-Institutes
- Forschungsdesiderate
- Forschungsfrage und -skizze
- Fallauswahl
- Datenerhebung
- Datenauswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Zugang von Jugendlichen zu Angeboten der non-formalen Bildung außerhalb der Schule, insbesondere im Zusammenhang mit der Einkommenssituation der Herkunftsfamilie und deren sozialer Positionierung. Sie untersucht, ob die Bemühungen der Politik zur Überwindung der Bildungsungleichheit zu einer gerechteren Teilhabe an außerschulischen Bildungsangeboten führen.
- Analyse des Zugangs von Jugendlichen zu außerschulischen Bildungsangeboten
- Bedeutung der Einkommenssituation der Familie für die Teilhabe an außerschulischen Angeboten
- Bewertung der Wirksamkeit politischer Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit
- Identifizierung von Forschungsdesideraten im Bereich der außerschulischen Bildung
- Entwicklung einer eigenen Forschungsfrage und -skizze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und der Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der Bildungsungleichheit und der PISA-Studie aufgezeigt. Kapitel zwei analysiert verschiedene Studien, die den Zugang von Jugendlichen zu außerschulischen Bildungsangeboten untersuchen. Die Shell-Studie 2010, die AIDA-Studie 2009 und Studien des DIW sowie des Böckler-Institutes werden hinsichtlich ihrer Methodik, Zielsetzung und Ergebnisse betrachtet. Die Analyse der Forschungsergebnisse beleuchtet die Bedeutung der Herkunftsfamilie und ihrer finanziellen Ressourcen für die Teilhabe an außerschulischen Aktivitäten. In Kapitel drei werden Forschungsdesiderate aus den vorherigen Studien herausgearbeitet. Diese Lücken dienen als Grundlage für die Formulierung einer eigenen Forschungsfrage, die in Kapitel vier vorgestellt wird. Dieses Kapitel enthält auch eine Skizze des methodischen Vorgehens für die Erhebung und Auswertung der Daten.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, non-formale Bildung, außerschulische Bildung, Zugang zu Angeboten, soziale Herkunft, Einkommenssituation, Familienkapital, Chancengerechtigkeit, Jugendliche, Forschungsdesiderate, Forschungsfrage, Forschungsmethodik.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die soziale Herkunft den Bildungserfolg in Deutschland?
Studien wie PISA zeigen, dass die soziale Herkunft und die finanziellen Ressourcen der Familie maßgeblich die Kompetenzentwicklung von Kindern beeinflussen.
Was ist das Ziel des Bildungs- und Teilhabepakets von 2011?
Es soll sozial benachteiligten Kindern die Teilnahme an Mittagsverpflegung, Nachhilfe und kulturellen Aktivitäten ermöglichen.
Welche Rolle spielt non-formale Bildung außerhalb der Schule?
Da Kinder viel Zeit in organisierten Freizeitarrangements verbringen, gewinnen diese für Lernprozesse und die soziale Positionierung an Bedeutung.
Welche Studien zum Freizeitverhalten werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit wertet unter anderem die 16. Shell-Studie, die AIDA-Studie und DIW-Wochenberichte aus.
Was sind die zentralen Forschungsdesiderate in diesem Bereich?
Es besteht Forschungsbedarf hinsichtlich der tatsächlichen Wirksamkeit politischer Maßnahmen für den Zugang zu außerschulischer Bildung.
- Citation du texte
- Christian Kaupke (Auteur), 2017, Soziale Ungleichheit außerhalb der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461494