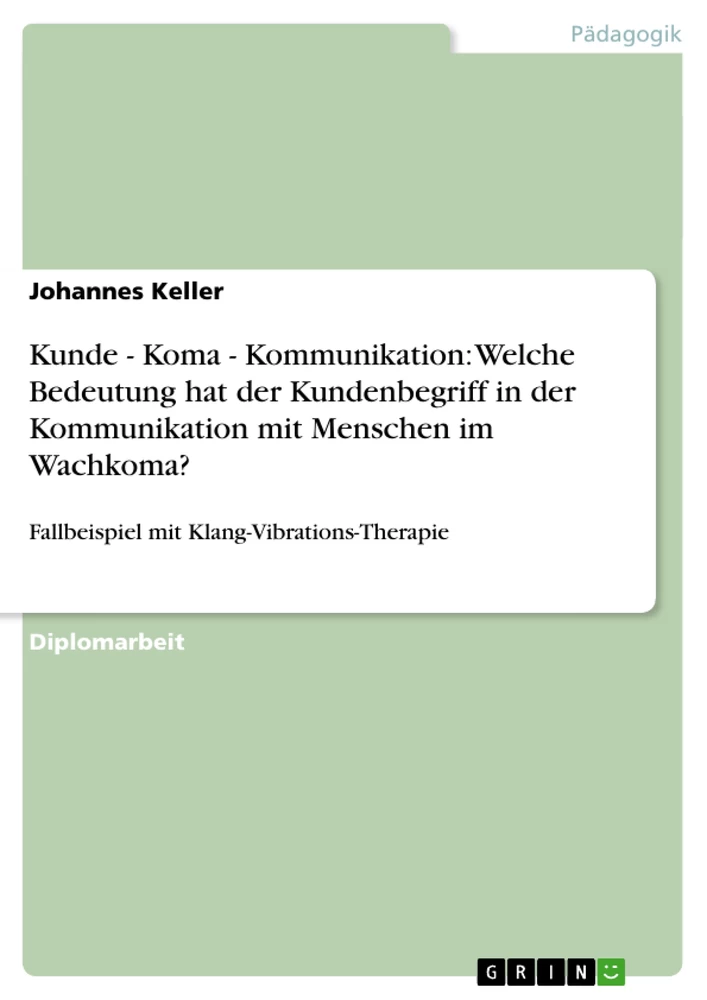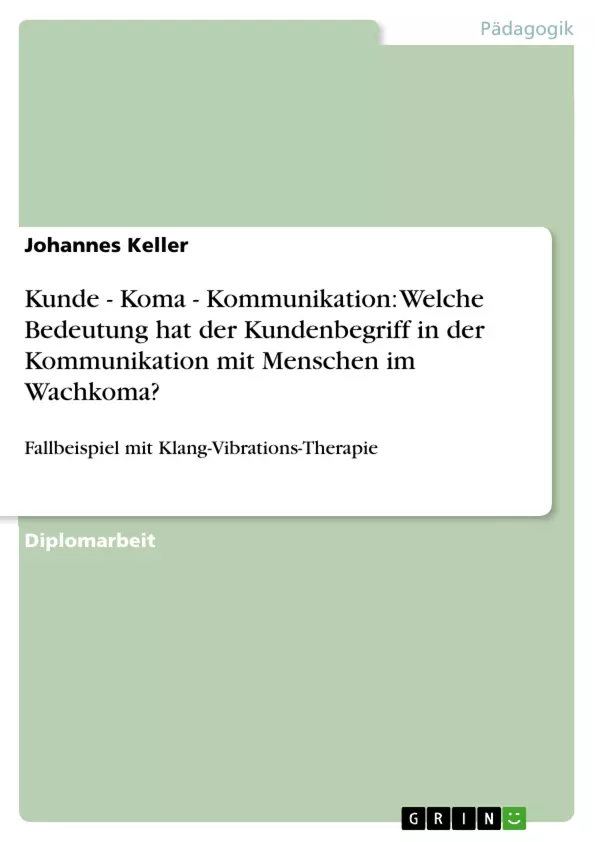Die Bedeutung der Begriffe „Kunde“ und „Kommunikation“ haben sich besonders stark in der Ökonomisierung des gesamten Sozialwesens gerade da gewandelt, umso mehr man sich im Bestreben für Qualitätssicherung und - entwicklung bezüglich Kostendämpfung eher im Kreise drehte und dabei zur Sicherung von monetären Quellen nach neuen Kunden Ausschau hielt: da man sich erhöhte Einnahmequellen monetärer Art verspricht, sind neue Kundenkreise - wie z.B. auch Menschen im Wachkoma - für Behindertenhilfe-Einrichtungen kein Tabu-Thema mehr. In dieser vorliegenden Diplom-Arbeit soll ein Kundenverständnis deshalb zunächst ganz besonders bezogen auf Menschen im Wachkoma beleuchtet werden. Was bedeutet das „Kunde-Sein“ angesichts enormer Abhängigkeit von Hilfe, einhergehend mit äußerst eingeschränkter Kommunikationskompetenz ?
Was bedeutet es für diese „Kunden“ und den Anbietern, wenn dieser Zustand des Kunden über Jahre anhält ?
Die erkenntnisleitende Frage ist über allem die:
Was macht das menschliche Miteinander aus in dem Spannungsfeld der Begriffe: Kunde-Koma-Kommunikation ?
Nach einer ersten Untersuchung der drei Leitbegriffe "Kunde" - "Koma" - "Kommunikation" nach deren aktuelle Bedeutung und deren aktuelle Aufeinander-Bezogenheit einschließlich unterschiedlichster Ansätze von Kommunikationstheorien und Kommunikationsformen, möchte ich praktische-musikalische und persönliche Erlebnisse innerhalb dieser Thematik aus der Begegnung mit einem Mädchen im Wachkoma anschließen. Die Reflexion dieser Praxis verlangt eine tiefergehende Interpretation unter den „Außenimpulsen“ der leibphänomenologischen Philosophie Husserls und Levinas. Eine weitere Verdichtung durch wortsemantische Rückbesinnung in Verbindung mit religionsphilosophischen Überlegungen soll die Neubestimmung und Neuausrichtung der Bedeutung des Begriffs Kunde bezogen auf die Kommunikation mit Menschen im Wachkoma erkennbar machen. Welche Konsequenzen, ja welche „reformatorische“ Dynamik diese Neuausrichtung des Kundenverständnisses für die heilpädagogische Praxis und die Heilpädagogik allgemein hat, soll abschließend erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Kunde und sozialer Markt
- 2.1 Soziale Dienstleistung in Non-Profit-Unternehmen zwischen Qualität und Ökonomie
- 2.2 Kundenverständnis und Kundenrolle in sozialen Unternehmen
- 2.3 Markterschließung und „neue Kunden“
- 3 Menschen im Wachkoma
- 3.1 Wachkoma - ein medizinisches Phänomen zwischen Leben und Tod oder Wachheit und tiefem Schlaf
- 3.2 Medizinische und soziale Rollenzuschreibung von „Wachkoma-Patienten“
- 3.3 Das Kundendasein in der Abhängigkeit
- 4 Kommunikation mit Menschen im Wachkoma
- 4.1 Nonverbale Kommunikation nach Watzlawick
- 4.2 „Echte Kommunikation“ und der „Kontakt“ nach F. Perls
- 4.3 Basale Kommunikation nach Winfried Mall
- 4.3.1 Elementare Kommunikationsformen der heilpädagogischen Praxis
- 4.3.2 Heilpädagogisch-musiktherapeutische Kommunikation
- 4.3.2.1 Exkurs: Der Einsatz der menschlichen Stimme in der heilpädagogisch-musiktherapeutischen Kommunikation
- 4.4 Kommunikation mit Menschen im Wachkoma gemeinsam mit deren Angehörigen als weitere Kunden
- 5 Praxisdarstellung – wie erlebe ich Kunden in der Kommunikation im Wachkoma und deren Angehörige?
- 5.1 Die Anfrage und das Konzept der regionalen Dienstleistung
- 5.1.1 Die Anfrage
- 5.1.2 Regionale Dienstleistung als konzeptionelle Intention
- 5.2 Erstes Kennenlernen und erste Kommunikation mit einem Mädchen im Wachkoma und ihren Angehörigen
- 5.2.1 Erster Eindruck
- 5.2.2 Wie habe ich angefangen – meine Vorüberlegungen und erstes Ausprobieren des Mediums Musik in der Kommunikation mit dem Mädchen im Wachkoma
- 5.2.3 Erste Begegnungen – ein bewegendes Erleben
- 5.3 Entwicklung einer heilpädagogisch-musiktherapeutischen Kommunikation mit dem System Familie als Kunde
- 5.3.1 Ablauf einer Einheit „Begegnung und Kommunikation mit Musik“
- 5.4 Das Erleben von Kommunikation, Kontakt und Beziehungen im Kundenverhältnis
- 5.4.1 Einbeziehung und Erleben unterschiedlicher Angehöriger
- 5.4.2 Wandlungen und Sensibilisierungen durch Reflexionen
- 5.4.3 Erlebnisse vor und Reflexionen nach dem Tod von Jirina
- 6 Kunde-Koma-Kommunikation – ein Spannungsfeld im Blickwinkel von phänomenologischer, dialogphilosophischer, religionsphilosophischer und wortsemantischer Reflexion
- 6.1 Die phänomenologische Reduktion nach Husserl
- 6.2 Das dialogische Prinzip nach Buber
- 6.3 Die sinnlich-ursprüngliche Kommunikation nach Lévinas
- 6.4 Gottes Anruf oder das „Drei-Eins-Sein“ nach Jörg Splett
- 6.5 Begriffsbestimmungen und Begriffsrückführungen
- 6.5.1 Der Begriff „Kunde“ zunächst nach Grimm's Wörterbuch
- 6.5.2 Der Begriff „Kommunikation“
- 6.5.3 Der Begriff „(Wach)koma“ und seine Geschichte
- 6.6 Neuausrichtung eines Kundenverständnisses durch Impulse der Philosophie und der Wortsemantik
- 7 Folgerungen und Konsequenzen für die Heilpädagogik
- 7.1 Widerstand und Ruf des Anderen versus Verdinglichung des Anderen (Kundschafter versus Kundschaft)
- 7.2 Dienstgemeinschaft versus Dienstleistung
- 7.3 Gemeinsames Leben und Lernen in „Resonanz im Trialog“
- 8 Zusammenfassung und Schlussbemerkung
- 9 Persönliche Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Kundenbegriffs in der Kommunikation mit Menschen im Wachkoma. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunikation in diesem Kontext und analysiert den Wandel des Kundenverständnisses im sozialen Bereich, insbesondere im Hinblick auf die Ökonomisierung des Sozialwesens. Die Arbeit basiert auf einem Fallbeispiel mit Klang-Vibrations-Therapie.
- Wandel des Kundenverständnisses im sozialen Bereich
- Kommunikationsmöglichkeiten mit Menschen im Wachkoma
- Ethische Aspekte der Kundenbeziehung im Kontext von Wachkoma
- Heilpädagogisch-musiktherapeutische Ansätze
- Philosophische Reflexionen zu Kunde, Koma und Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel des Kundenbegriffs in einer zunehmend monetarisierten Gesellschaft und veranschaulicht dies anhand eines persönlichen Erlebnisses am Postschalter. Der Autor betont die Bedeutung der zwischenmenschlichen Kommunikation im Kontext des Kundenbegriffs und leitet zur zentralen Fragestellung der Arbeit über: die Bedeutung des Kundenbegriffs in der Kommunikation mit Menschen im Wachkoma. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung von Kunde, Koma und Kommunikation und dem damit verbundenen Wandel im Sozialwesen.
2 Kunde und sozialer Markt: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Kunden in sozialen Non-Profit-Unternehmen und analysiert das Spannungsfeld zwischen Qualität, Ökonomie und Kundenorientierung. Es wird das Kundenverständnis in sozialen Einrichtungen diskutiert und die Notwendigkeit der Erschließung neuer Kundengruppen, wie z.B. Menschen im Wachkoma, im Kontext der Refinanzierung von Dienstleistungen beleuchtet. Die zunehmende Spezialisierung von Einrichtungen im Behindertenbereich wird als Folge der finanziellen Herausforderungen dargestellt.
3 Menschen im Wachkoma: Dieses Kapitel beschreibt das medizinische Phänomen des Wachkomas und die damit verbundenen medizinischen und sozialen Rollenzuschreibungen. Es untersucht die besondere Abhängigkeit von Menschen im Wachkoma und die daraus resultierenden Herausforderungen in Bezug auf das „Kundendasein“ und die Kommunikation. Der Fokus liegt auf der besonderen Situation der Betroffenen und ihren Angehörigen.
4 Kommunikation mit Menschen im Wachkoma: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Ansätze der Kommunikation mit Menschen im Wachkoma, angefangen bei nonverbaler Kommunikation nach Watzlawick über den „Kontakt“ nach Perls bis hin zu basaler Kommunikation nach Mall und heilpädagogisch-musiktherapeutischen Methoden. Es werden unterschiedliche Kommunikationsformen und deren Einsatzmöglichkeiten ausführlich diskutiert. Der Einsatz der menschlichen Stimme in der heilpädagogisch-musiktherapeutischen Kommunikation wird besonders hervorgehoben.
5 Praxisdarstellung – wie erlebe ich Kunden in der Kommunikation im Wachkoma und deren Angehörige?: Das Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel aus der Praxis, schildert die Kontaktaufnahme mit einem Mädchen im Wachkoma und deren Familie, und beschreibt den Prozess der Entwicklung einer heilpädagogisch-musiktherapeutischen Kommunikationsstrategie. Es dokumentiert die Herausforderungen und Erfolge der Arbeit mit dem System Familie als Kunde. Die Reflexion des Erlebens von Kommunikation, Kontakt und Beziehungen im Kundenverhältnis, einschliesslich der Einbeziehung unterschiedlicher Angehöriger und die Verarbeitung des Todes der Patientin werden hier auch besprochen.
6 Kunde-Koma-Kommunikation – ein Spannungsfeld im Blickwinkel von phänomenologischer, dialogphilosophischer, religionsphilosophischer und wortsemantischer Reflexion: Dieses Kapitel bietet eine tiefgreifende philosophische Reflexion der Begriffe „Kunde“, „Koma“ und „Kommunikation“. Es greift auf verschiedene philosophische Ansätze zurück (Husserl, Buber, Lévinas, Splett) und analysiert das Spannungsfeld zwischen dem „Kunden“-Begriff und der Würde des Menschen im Wachkoma. Die begriffliche Klärung und Rückführung der Schlüsselbegriffe ist hier zentral.
7 Folgerungen und Konsequenzen für die Heilpädagogik: Dieses Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Kapiteln und diskutiert die Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis. Es beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Widerstand und Verdinglichung des Anderen und diskutiert die Bedeutung von Dienstgemeinschaft im Gegensatz zu Dienstleistung. Der Ansatz von „Resonanz im Trialog“ wird als zukunftsweisend vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kunde, Koma, Kommunikation, Wachkoma, Heilpädagogik, Musiktherapie, Non-Profit-Unternehmen, Soziale Dienstleistung, Kundenverständnis, Philosophie, Dialog, Phänomenologie, Basale Kommunikation, Angehörige, Fallbeispiel, Klang-Vibrations-Therapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kundenverständnis in der Kommunikation mit Menschen im Wachkoma
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Kundenbegriff im Kontext der Kommunikation mit Menschen im Wachkoma. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunikation in dieser Situation und beleuchtet den Wandel des Kundenverständnisses im sozialen Bereich, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Ökonomisierung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: den Wandel des Kundenverständnisses im sozialen Bereich, Kommunikationsmöglichkeiten mit Menschen im Wachkoma, ethische Aspekte der Kundenbeziehung im Kontext von Wachkoma, heilpädagogisch-musiktherapeutische Ansätze und philosophische Reflexionen zu Kunde, Koma und Kommunikation. Ein Fallbeispiel mit Klang-Vibrations-Therapie wird detailliert dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Wandel des Kundenbegriffs und die zentrale Fragestellung. Kapitel 2 (Kunde und sozialer Markt) beleuchtet die Rolle des Kunden in sozialen Non-Profit-Unternehmen. Kapitel 3 (Menschen im Wachkoma) beschreibt das medizinische Phänomen und die soziale Situation der Betroffenen. Kapitel 4 (Kommunikation mit Menschen im Wachkoma) behandelt verschiedene Kommunikationsansätze. Kapitel 5 (Praxisdarstellung) präsentiert ein Fallbeispiel mit heilpädagogisch-musiktherapeutischer Kommunikation. Kapitel 6 (Kunde-Koma-Kommunikation – philosophische Reflexion) bietet eine philosophische Analyse der Schlüsselbegriffe. Kapitel 7 (Folgerungen und Konsequenzen für die Heilpädagogik) zieht Schlussfolgerungen für die Praxis. Kapitel 8 bietet eine Zusammenfassung und Schlussbemerkung, und Kapitel 9 enthält eine persönliche Reflexion.
Welche philosophischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit greift auf verschiedene philosophische Ansätze zurück, darunter die Phänomenologie (Husserl), das dialogische Prinzip (Buber), die sinnlich-ursprüngliche Kommunikation (Lévinas) und die Religionsphilosophie (Splett). Diese Ansätze dienen der Reflexion des Spannungsfelds zwischen dem „Kunden“-Begriff und der Würde des Menschen im Wachkoma.
Welche Methoden werden in der Praxisdarstellung angewendet?
Die Praxisdarstellung konzentriert sich auf ein Fallbeispiel, in dem heilpädagogisch-musiktherapeutische Methoden, insbesondere Klang-Vibrations-Therapie, eingesetzt werden. Der Prozess der Kontaktaufnahme mit dem Mädchen im Wachkoma und deren Familie, die Entwicklung der Kommunikationsstrategie und die Herausforderungen und Erfolge der Arbeit mit dem System Familie als Kunde werden detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden für die Heilpädagogik gezogen?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Dienstgemeinschaft im Gegensatz zu bloßer Dienstleistung und den Ansatz von „Resonanz im Trialog“ als zukunftsweisend für die Arbeit mit Menschen im Wachkoma und ihren Angehörigen. Es wird das Spannungsfeld zwischen Widerstand und Verdinglichung des Anderen ("Kundschafter versus Kundschaft") hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kunde, Koma, Kommunikation, Wachkoma, Heilpädagogik, Musiktherapie, Non-Profit-Unternehmen, Soziale Dienstleistung, Kundenverständnis, Philosophie, Dialog, Phänomenologie, Basale Kommunikation, Angehörige, Fallbeispiel, Klang-Vibrations-Therapie.
- Citar trabajo
- Johannes Keller (Autor), 2005, Kunde - Koma - Kommunikation: Welche Bedeutung hat der Kundenbegriff in der Kommunikation mit Menschen im Wachkoma?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46173