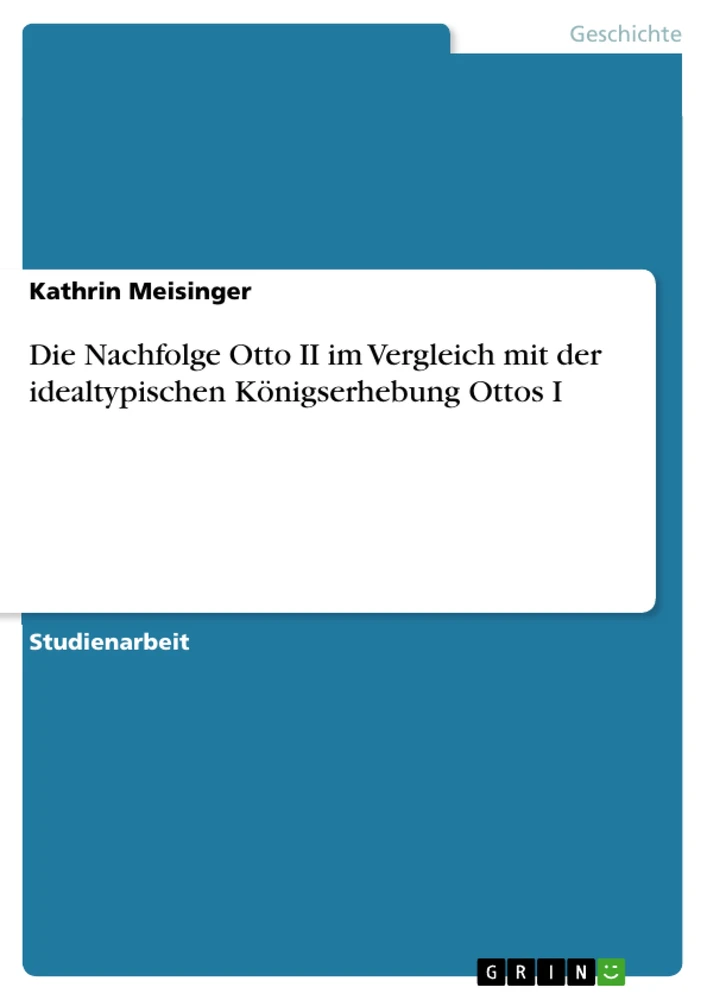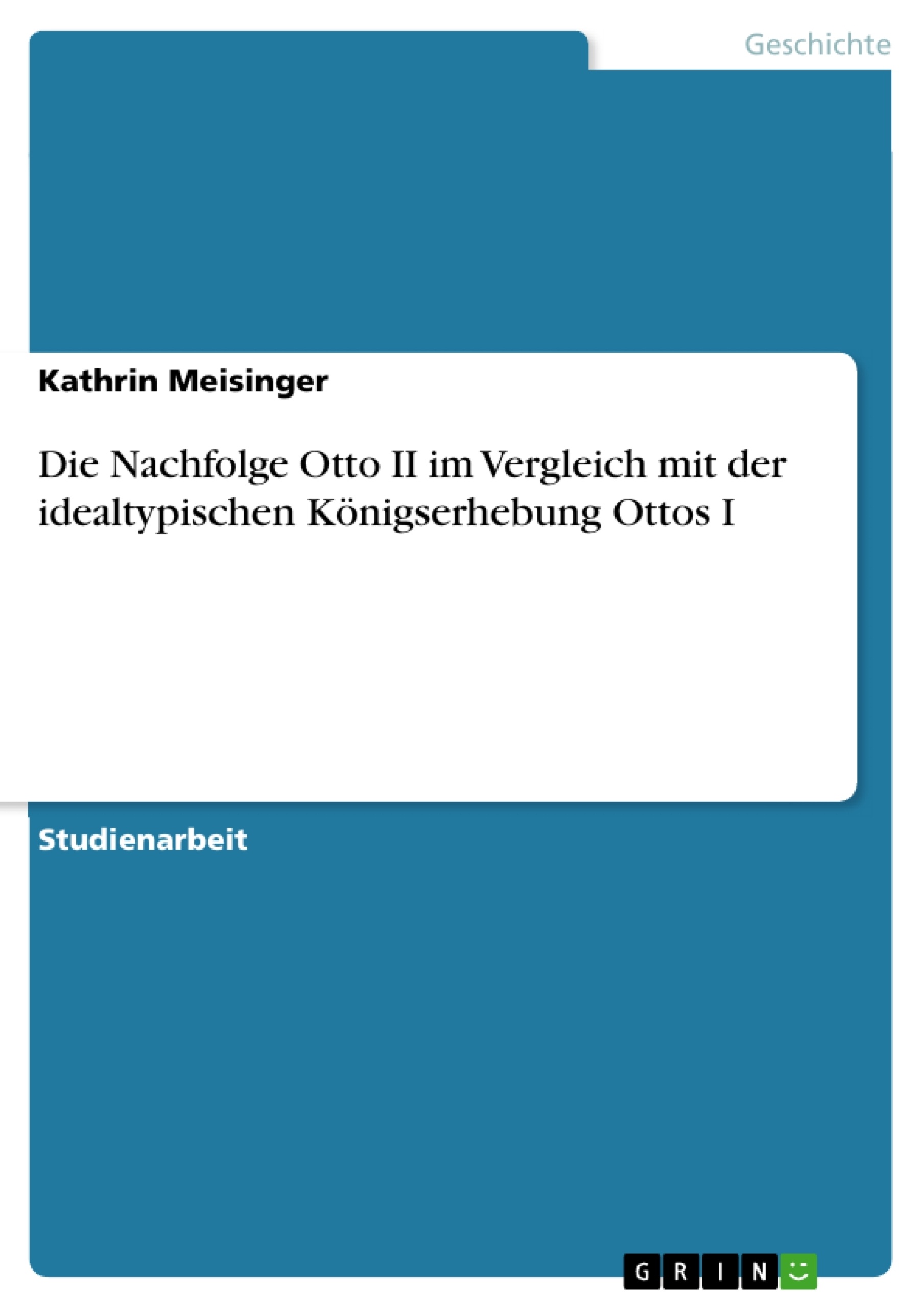Diese Arbeit thematisiert, inwiefern die Nachfolge Ottos III. tatsächlich strittig war. Dabei wird zunächst die Königserhebung Ottos I. analysiert, die mit ihren weltlichen und geistlichen Akten der Erhebung als idealtypisch gelten kann. Anschließend wird die Erhebung Ottos III. auf die idealtypischen Akte Otto I. untersucht und die innerfamiliäre Ausgangslage bestimmt. Darauf folgt ein Vergleich, der sich zunächst auf die Unterschiede bei den Königserhebungen konzentriert und daraufhin die Familien-Streitigkeiten analysiert. Kündigt sich der Konflikt um die Nachfolge bereits während der Erhebung Ottos III. an? Sind die Unterschiede bei der Erhebung Ottos III. im Vergleich zu Otto I. ausschlaggebend für den Zwist? Gibt es einen Ausgangspunkt für die innerfamiliären Streitigkeiten? Welche Motive und strategische Überlegungen werden von wem getroffen? Wie wird das Problem der Nachfolge innerhalb der Familie gelöst?
Otto II. konnte sich in seiner letzten Schlacht nicht behaupten, dennoch gelang es ihm, seinen Sohn Otto 983 vor seinem Tod 984 zum König in Verona zu bestimmen. Die Nachfolge des Kaisers gilt nichtsdestotrotz als strittig. Der ottonische Herrschaftsbereich befand sich in der genannten Zeitspanne im Ausnahmezustand. Die Niederlage gegen die Sarazenen sowie das Hereinbrechen der dänischen und slawischen Stämme wirkten bedrohlich. Dennoch waren es die innerfamiliären Machtkämpfe, die die Herrschaft Ottos III. zu Beginn ins Wanken brachten.
Auf die innerfamiliären Fehden zu Herrschaftsbeginn Ottos I. wird im Vergleich nur am Rande eingegangen. Allerdings war die Vorgehensweise nach den Fehden ähnlich wie bei Otto III.: Die innerfamiliären Streitigkeiten zogen eine stärkere Einbindung derselben „Unruhestifter“ in die Herrschaft nach sich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Königserhebung Otto I.
- 3. Die Königserhebung Otto III.
- 4. Vergleich der Königserhebungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwieweit die Nachfolge Ottos III. tatsächlich strittig war. Hierzu wird die Königserhebung Ottos I. als idealtypischer Vergleichspunkt herangezogen und mit der Erhebung Ottos III. kontrastiert. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in den Erhebungsprozessen und den daraus resultierenden innerfamiliären Konflikten.
- Analyse der idealtypischen Königserhebung Ottos I.
- Untersuchung der Königserhebung Ottos III. und der innerfamiliären Ausgangslage.
- Vergleich der beiden Königserhebungen hinsichtlich ihrer Unterschiede.
- Analyse der innerfamiliären Streitigkeiten im Kontext der Nachfolge Ottos III.
- Ermittlung der Motive und strategischen Überlegungen der beteiligten Akteure.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der strittigen Nachfolge Ottos III. ein und skizziert die Forschungsfrage. Sie erläutert die methodische Vorgehensweise, die auf einem Vergleich der Königserhebungen Ottos I. und Ottos III. basiert, um die innerfamiliären Machtkämpfe und deren Einfluss auf die Nachfolge zu analysieren. Die Hauptquellen der Arbeit, die Merseburger Chronik und die Res gestae Saxonicae Widukinds von Corvey, werden vorgestellt und deren jeweilige Bedeutung für die Untersuchung erläutert. Die Einleitung umreißt die zentralen Fragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen, wie zum Beispiel die Rolle der Kaiserinnen Theophanu und Adelheid und die Motive der beteiligten Akteure.
2. Die Königserhebung Otto I.: Dieses Kapitel analysiert die Königserhebung Ottos I. als idealtypisches Modell. Es beschreibt die verschiedenen Akte der Erhebung, beginnend mit der göttlichen Erwählung und der Designation durch den Vater Heinrich I., gefolgt von der Zustimmung der Großen und der symbolträchtigen Thronbesteigung in Aachen. Die Kapitel analysiert das Spannungsverhältnis zwischen göttlicher Erwählung und der Zustimmung der Großen, wobei die "Wahl" der Großen mehr als eine Proklamation des bereits vom Vater bestimmten Nachfolgers gesehen wird. Die Bedeutung der Designation durch den Vater als verbindlicher Akt wird hervorgehoben, ebenso wie der strategische Ausschluss anderer potentieller Thronfolger wie Thankmar. Das Kapitel betont die Bedeutung der inszenierten Königserhebung in Aachen als Demonstration der programmatischen Einbindung in die fränkische Tradition.
Schlüsselwörter
Königserhebung, Otto I., Otto III., Ottonen, Nachfolge, innerfamiliäre Konflikte, Machtkämpfe, Herrschaftslegitimation, göttliche Erwählung, Idealtyp, Merseburger Chronik, Res gestae Saxonicae, Theophanu, Adelheid, Willigis, Heinrich der Zänker.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vergleich der Königserhebungen Ottos I. und Ottos III.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwieweit die Nachfolge Ottos III. tatsächlich strittig war. Sie vergleicht dazu die Königserhebung Ottos I. als idealtypischen Vergleichspunkt mit der Erhebung Ottos III., um die Unterschiede in den Erhebungsprozessen und die daraus resultierenden innerfamiliären Konflikte zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die idealtypische Königserhebung Ottos I., untersucht die Königserhebung Ottos III. und die innerfamiliäre Ausgangslage, vergleicht beide Erhebungen hinsichtlich ihrer Unterschiede, analysiert die innerfamiliären Streitigkeiten im Kontext der Nachfolge Ottos III. und ermittelt die Motive und strategischen Überlegungen der beteiligten Akteure.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquellen der Arbeit sind die Merseburger Chronik und die Res gestae Saxonicae Widukinds von Corvey. Ihre jeweilige Bedeutung für die Untersuchung wird in der Einleitung erläutert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung, Die Königserhebung Otto I., Die Königserhebung Otto III., Vergleich der Königserhebungen und Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die methodische Vorgehensweise. Die Kapitel 2 und 3 analysieren die jeweiligen Königserhebungen. Kapitel 4 vergleicht beide Erhebungen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Königserhebung Ottos I. dargestellt?
Die Königserhebung Ottos I. wird als idealtypisches Modell analysiert. Es werden die verschiedenen Akte der Erhebung beschrieben, von der göttlichen Erwählung und der Designation durch den Vater Heinrich I. bis zur Zustimmung der Großen und der Thronbesteigung in Aachen. Das Spannungsverhältnis zwischen göttlicher Erwählung und Zustimmung der Großen wird beleuchtet, ebenso die strategische Bedeutung der Ausschaltung anderer potentieller Thronfolger.
Welche Rolle spielen innerfamiliäre Konflikte?
Die Arbeit analysiert die innerfamiliären Konflikte im Kontext der Nachfolge Ottos III. Sie untersucht die Motive und strategischen Überlegungen der beteiligten Akteure und deren Einfluss auf den Verlauf der Nachfolge.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Königserhebung, Otto I., Otto III., Ottonen, Nachfolge, innerfamiliäre Konflikte, Machtkämpfe, Herrschaftslegitimation, göttliche Erwählung, Idealtyp, Merseburger Chronik, Res gestae Saxonicae, Theophanu, Adelheid, Willigis, Heinrich der Zänker.
Welche Rolle spielen die Kaiserinnen Theophanu und Adelheid?
Die Rolle der Kaiserinnen Theophanu und Adelheid und deren Einfluss auf die Nachfolge wird in der Arbeit untersucht. Die genauen Details ergeben sich aus der Analyse der Königserhebungen und der innerfamiliären Konflikte.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird am Ende des Textes zusammengefasst und beinhaltet die Ergebnisse des Vergleichs der Königserhebungen und die Schlussfolgerungen zur strittigen Nachfolge Ottos III.
- Citar trabajo
- Kathrin Meisinger (Autor), 2018, Die Nachfolge Otto II im Vergleich mit der idealtypischen Königserhebung Ottos I, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461865