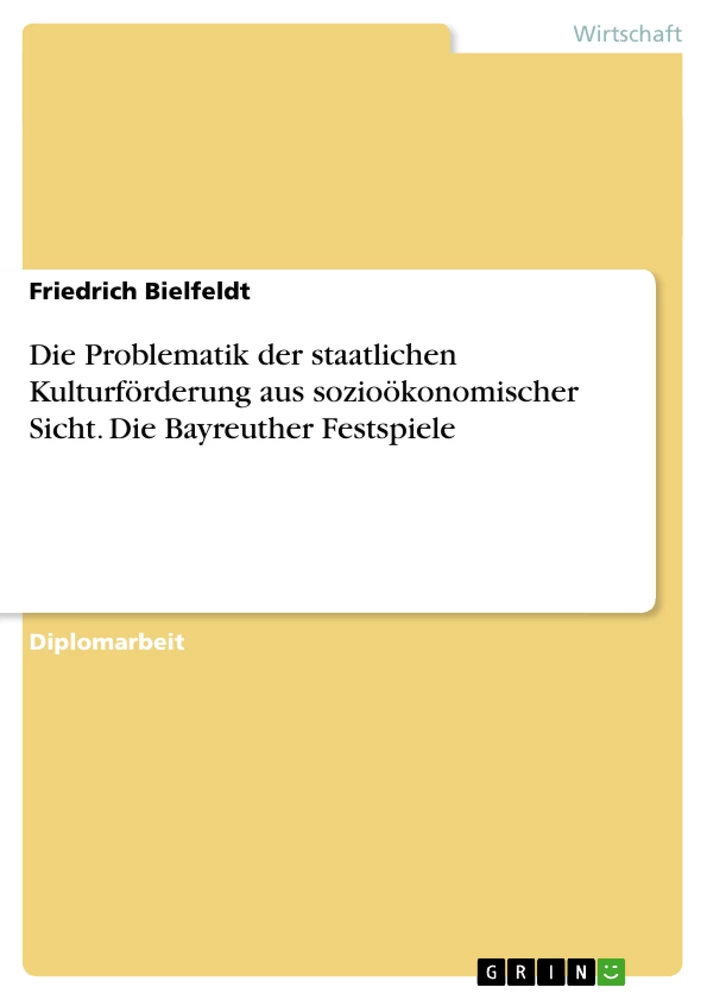Die staatliche Kulturfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) steht vor einem Dilemma, welches zumal nach der Wiedervereinigung 1990 zu einer immer lauter werdenden Diskussion auf politischer Ebene über den (Un-)Sinn der staatlichen Kulturförderung von Kulturinstitutionen geführt hat. Zum einen nämlich steht ein Staat, welcher sich als Kulturnation, als Land der Dichter und Denker versteht, in der Verantwortung, seine Kultur zu schützen und zu fördern. Zum anderen aber führt die Krise sämtlicher staatlicher Haushalte auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene zu der Notwendigkeit, in allen öffentlichen Bereichen, und so auch im Bereich der Kultur und ihrer Institutionen, Einsparungen vornehmen zu müssen, womit vor allem Theater und Opernhäuser, Museen, Orchester, Volkshochschulen, Bibliotheken sowie Literaturarchive und Denkmäler gemeint sind.
Die Frage der staatlichen Kulturförderung soll in dieser Diplomarbeit einer Gesamtbetrachtung unterzogen und in Bezug auf die Bayreuther Festspiele angewendet und diskutiert werden, welche in ihrer Erscheinungsform als Festspiele, von ihrer inhaltlichen und historischen Entstehung her, aber auch aufgrund ihrer finanziellen Situation eine singuläre Stellung in der bundesdeutschen Kulturlandschaft einnehmen.
Dabei wird es von Bedeutung sein, dass die Bayreuther Festspiele sowohl in ihrer Funktion als Festspielbetrieb, der lediglich in den Sommerwochen von Ende Juli bis Ende August stattfindet, als auch aus ihrer spezifischen Geschichte heraus anders zu bewerten sind, als diejenigen Kulturinstitutionen, denen ein eher regionaler und saisonaler Charakter beigemessen werden kann.
Zudem ist es zur genaueren Bestimmung eines kultursoziologischen Stakeholder-Ansatzes nicht nur wichtig, die Organisation und Finanzierung der Bayreuther Festspiele zu betrachten, sondern zusätzlich auch eine Betrachtung des Bayreuther Publikums vorzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Das Problem der staatlichen Kulturförderung
- Der Staat und die Kulturförderung
- Kultur als Staatsaufgabe
- Die Krise der Staatshaushalte
- Die staatliche Kulturfinanzierung in der BRD in Zahlen
- Der Sinn staatlicher Kulturförderung
- Kultur als volkswirtschaftliches Gut
- Positive externe Effekte von Kultur
- Kultur als Standortfaktor
- Kritik an der volkswirtschaftlichen Sichtweise
- Kultur und Umwegrentabilität
- Wirtschaftliche Effekte von Festspielen
- Methodik des Umwegrentabilitäts-Konzepts
- Mögliche Ergebnisse
- Kritik an dem Modell der Umwegrentabilität
- Die Kultur in ihrem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld
- Der Kulturbegriff
- Das Kulturmodell nach Mary Douglas
- Die Einordnung der staatlichen Kulturförderung in das Modell
- Der Versuch eines kulturpolitischen Stakeholderansatzes
- Der ökonomische Stakeholderansatz
- Ein Stakeholderansatz für Kulturbetriebe
- Die Verknüpfung von Kulturmodell und Stakeholderansatz
- Kritik an der sozialwissenschaftlichen Sichtweise
- Die Bayreuther Festspiele
- Die Geschichte der Bayreuther Festspiele
- Organisation und Finanzierung
- Die Organisation des Festspielbetriebes
- Die Finanzierung der Festspiele
- Die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.
- Die Kulturförderung der Stadt Bayreuth
- Der Besucher- und Kundenkreis der Festspiele
- Die Auswirkungen der Festspiele auf die Region
- Ein Stakeholderansatz für die Bayreuther Festspiele
- Das Problem der staatlichen Kulturförderung II
- Die Entwicklung des Stakeholding im Kulturbereich
- Die Zukunft der Kulturfinanzierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Problematik der staatlichen Kulturförderung aus sozioökonomischer Sicht am Beispiel der Bayreuther Festspiele. Das zentrale Anliegen ist es, die aktuellen Herausforderungen der Kulturfinanzierung in Deutschland zu beleuchten und anhand eines konkreten Fallbeispiels die verschiedenen Perspektiven auf die staatliche Kulturförderung zu analysieren. Die Arbeit setzt sich mit den verschiedenen Argumenten für und gegen staatliche Kulturförderung auseinander und untersucht, inwiefern die Festspiele als kulturelles Kapital in die regionale Wirtschaftsentwicklung und das gesellschaftliche Leben integriert sind.
- Krise der staatlichen Kulturfinanzierung in Deutschland
- Argumentation für und gegen staatliche Kulturförderung
- Sozioökonomische Bedeutung von Kulturinstitutionen
- Stakeholderansatz in der Kulturförderung
- Die Bayreuther Festspiele als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Problem der staatlichen Kulturförderung und zeigt die aktuellen Herausforderungen der Kulturfinanzierung in Deutschland auf. Es wird die Diskussion um die Notwendigkeit und den Sinn staatlicher Kulturförderung aufgezeigt und anhand von Beispielen aus verschiedenen Bundesländern die aktuelle Situation der Kulturhaushalte illustriert.
Das zweite Kapitel widmet sich der Frage, wie der Staat die Kulturförderung gestalten kann. Es werden verschiedene Argumente für und gegen staatliche Kulturförderung vorgestellt und verschiedene Ansätze zur Bewertung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Kultur betrachtet.
Das dritte Kapitel erörtert den Kulturbegriff und seine Einordnung in das soziale und wirtschaftliche Umfeld. Es werden verschiedene Ansätze zur Analyse von Kultur vorgestellt, darunter das Kulturmodell nach Mary Douglas und der Stakeholderansatz.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Bayreuther Festspielen als konkretes Beispiel für eine Kulturinstitution, die von der staatlichen Kulturförderung profitiert. Es werden die Geschichte der Festspiele, ihre Organisation, Finanzierung und ihre Auswirkungen auf die Region Bayreuth betrachtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen staatliche Kulturförderung, sozioökonomische Analyse, Kulturpolitik, Kulturfinanzierung, Stakeholderansatz, Bayreuther Festspiele, Kulturmodell nach Mary Douglas, Umwegrentabilität, Kulturnation, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht die staatliche Kulturförderung in der Kritik?
Durch Haushaltskrisen auf Bundes- und Kommunalebene wird zunehmend hinterfragt, ob sich der Staat teure Kulturinstitutionen wie Opern und Museen leisten kann.
Was versteht man unter „Umwegrentabilität“ im Kulturbereich?
Umwegrentabilität bezeichnet die indirekten wirtschaftlichen Effekte von Kulturereignissen, wie etwa Einnahmen für Gastronomie und Hotellerie durch Festspielbesucher.
Was macht die Bayreuther Festspiele zu einem besonderen Fall?
Sie haben eine singuläre historische Stellung, einen überregionalen Charakter und eine spezifische Finanzierungsstruktur durch Staat und private Förderer.
Was ist ein kulturpolitischer Stakeholder-Ansatz?
Dieser Ansatz analysiert alle Interessengruppen einer Kulturinstitution, von Geldgebern über Mitarbeiter bis hin zum Publikum, um deren soziale und wirtschaftliche Bedeutung zu bestimmen.
Wie werden die Bayreuther Festspiele finanziert?
Die Finanzierung erfolgt durch öffentliche Mittel der Stadt, des Landes und des Bundes sowie maßgeblich durch die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.
- Citation du texte
- Friedrich Bielfeldt (Auteur), 2005, Die Problematik der staatlichen Kulturförderung aus sozioökonomischer Sicht. Die Bayreuther Festspiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46187