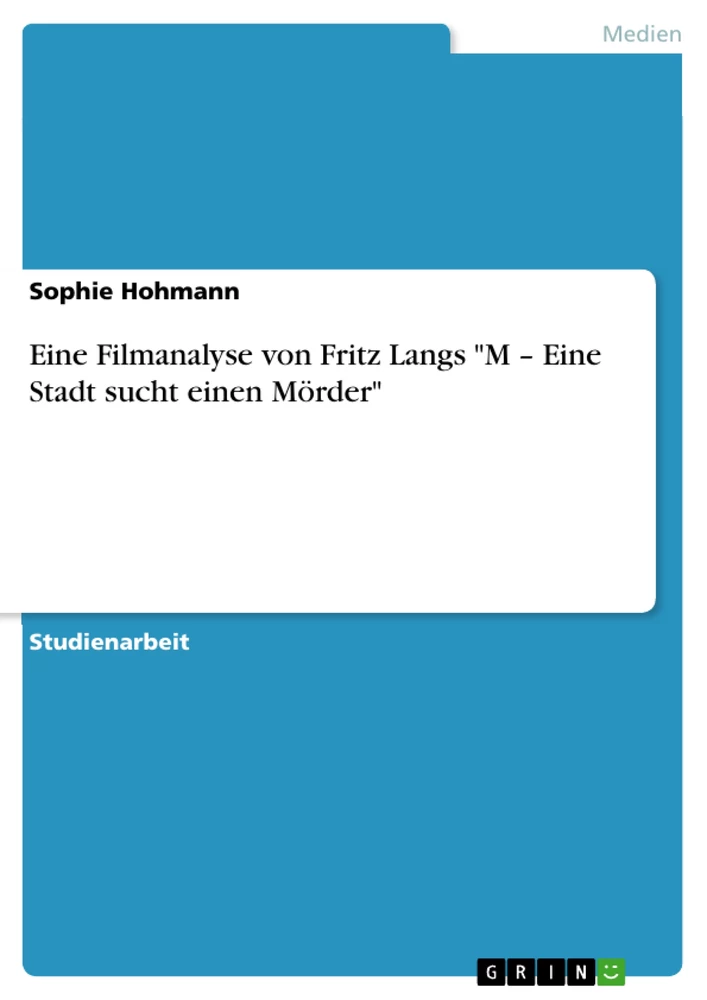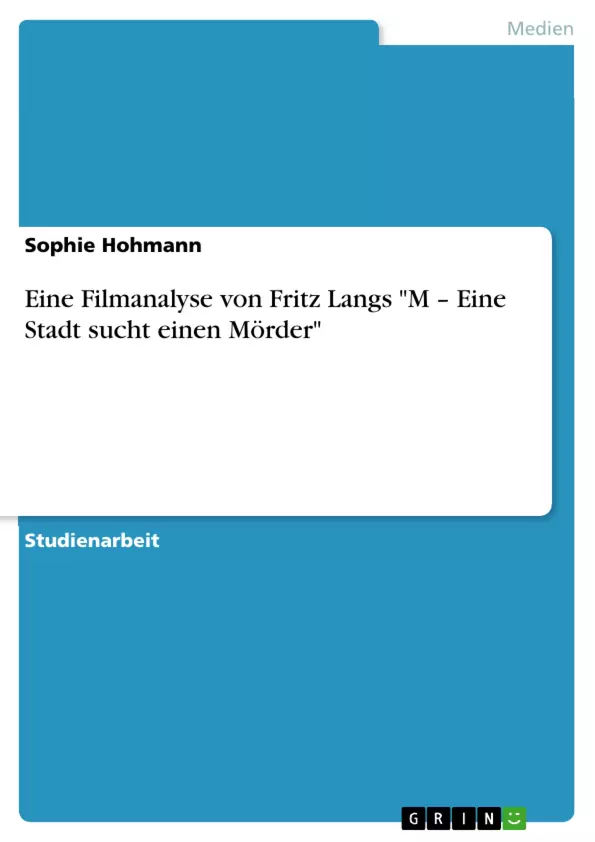Der Film „M“ entstand im Jahr 1931 unter der Regie von Fritz Lang und zählt zu den bedeutendsten Werken des deutschen Films. Es ist eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen und nutzt dieses neue Medium besonders gekonnt aus. Es wird den Genres Gerichtsdrama, sozialrealistisches und -kritisches Proletarierdrama und Krimi zugeordnet. Durch eindrucksvolle Licht- und Schattenspiele wirkt der Film düster, mysteriös und gefährlich und wird daher auch dem Film Noir zugeordnet.
Der Film wird häufig zusammen mit dem früheren Arbeitstitel „Mörder unter uns“ oder dem späteren Verleihtitel „Eine Stadt sucht einen Mörder“ genannt. Er ist einer der späteren Filme des Erfolgsregisseurs Lang. Zusammen mit Drehbuchautorin Thea von Harbou und Kameramann Fritz Arno Wagner entstand Anfang der 40er Jahre der in der Originallänge 117-minütige Film. Die überarbeitete Fassung dauert letztlich nur 107 Minuten. Er ist mit einem FSK von 12 Jahren eingeordnet.
Die herausragende filmhistorische Bedeutung, die „M“ genießt, wird zumeist auch anhand der ästhetischen Gestaltung dieses Films begründet. Fritz Lang wagte sich mit dem Medium Tonfilm an etwas für ihn völlig Neues. Die dabei durchgeführten Experimente gelten auch heute noch als „Beispiel für eine vorbildliche Bewältigung des Mediums Ton“ .
Die grundsätzliche Idee des Themas kam Lang durch aktuelle Zeitungsartikel über Serienmörder, wie Peter Kürter, der als „Vampir von Düsseldorf“ bekannt wurde. Als diesem schließlich der Prozess gemacht wurde und er zum Tode verurteilt wurde, waren die Dreharbeiten bereits im Gange. Drei Wochen nach seiner Hinrichtung feierte „M“ seine Premiere. „Der Film wurde zu einer unmittelbaren fassungslosen Reaktion einer Generation auf die Düsseldorfer Mordserie.“ Diese Berichte zu den Mordfällen veranlassten Fritz Lang nach eigenem Bekunden dazu, „der Sachlichkeit der Zeitepoche, durch die wir eben durchgehen, zu entsprechen und einen Film rein auf Tatsachenberichten aufzubauen.“ Er informierte sich umfangreich bei Kriminalpolizisten über Fahndungsmethoden und bei Psychologen sowie Psychiatern über die Geisteshaltung von Triebtätern, um ein möglichst realitätsnahes Werk entstehen zu lassen. Die Aufgabe des Films lag ihm zufolge darin, „an wirklichen Geschehnissen eine Warnung, eine Aufklärung zu gebe, und dadurch schließlich vorbeugend zu wirken.“ Das Ergebnis war ein sensibles Zeitbild, dessen stark realistische Verfahrensweise ein gegensätzliches Bild der damaligen Gesellschaft zeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeines
- Inhalt
- Charaktere
- Mise-en-Scene
- Narrationsebenen
- Motive
- Interpretationsversuch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Filmanalyse von Fritz Langs „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ befasst sich mit der detaillierten Untersuchung des Films und seiner Bedeutung im Kontext des deutschen Films der 1930er Jahre. Sie analysiert die filmischen Mittel, die Lang einsetzt, um die Geschichte eines Kindermörders und die Reaktion der Gesellschaft darauf darzustellen.
- Die Bedeutung von Tonfilm und visuellen Effekten
- Die Darstellung der Kriminalität und der Gesellschaft in Berlin
- Die psychologische Analyse der Figur des Hans Beckert
- Der Einfluss von aktuellen Zeitereignissen auf die Filmproduktion
- Die Bedeutung des Films als Vorläufer des Film Noir
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Allgemeines“ stellt den Film „M“ in seinen historischen Kontext und beleuchtet seine Relevanz im Rahmen des deutschen Films. Es beschreibt die filmischen Genres, denen der Film zugeordnet werden kann, und geht auf die Produktionsumstände und die filmische Bedeutung ein.
Das Kapitel „Inhalt“ bietet eine detaillierte Zusammenfassung der Handlung des Films und beschreibt die Ereignisse, die sich um den Kindermörder Hans Beckert drehen. Es beleuchtet die Reaktion der Polizei, die Verfolgung durch die Unterwelt und die Konfrontation zwischen den verschiedenen Akteuren.
Das Kapitel „Charaktere“ analysiert die wichtigsten Figuren im Film und ihre Beziehung zueinander. Es geht auf die Rolle des Hans Beckert, der Polizei, der Verbrecher und der Bevölkerung ein.
Schlüsselwörter
Die Filmanalyse von „M“ konzentriert sich auf die Schlüsselthemen Film Noir, Kriminalität, Gesellschaftskritik, Psychologische Analyse, Tonfilm, Expressionismus, und die Bedeutung von Fritz Langs Film im Kontext des deutschen Films der 1930er Jahre.
Häufig gestellte Fragen zu Fritz Langs Film "M"
Warum ist der Film "M" filmhistorisch so bedeutend?
Er war eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen und gilt als Meisterwerk für den innovativen Einsatz von Ton und Licht-Schatten-Effekten.
Welche realen Kriminalfälle inspirierten den Film?
Fritz Lang orientierte sich an Berichten über Serienmörder wie Peter Kürten, den „Vampir von Düsseldorf“.
Warum wird der Film dem Film Noir zugeordnet?
Wegen seiner düsteren Atmosphäre, der Darstellung einer bedrohlichen Stadt und der ästhetischen Gestaltung mit starken Kontrasten.
Welche gesellschaftliche Kritik übt der Film?
Er zeichnet ein sensibles Zeitbild der Gesellschaft der 1930er Jahre und thematisiert die Grenze zwischen Recht und Selbstjustiz (durch die Unterwelt).
Was war Fritz Langs Ziel mit diesem Film?
Er wollte durch die realitätsnahe Darstellung eine Warnung aussprechen und über die Psyche von Triebtätern aufklären.
- Quote paper
- Sophie Hohmann (Author), 2014, Eine Filmanalyse von Fritz Langs "M – Eine Stadt sucht einen Mörder", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461940