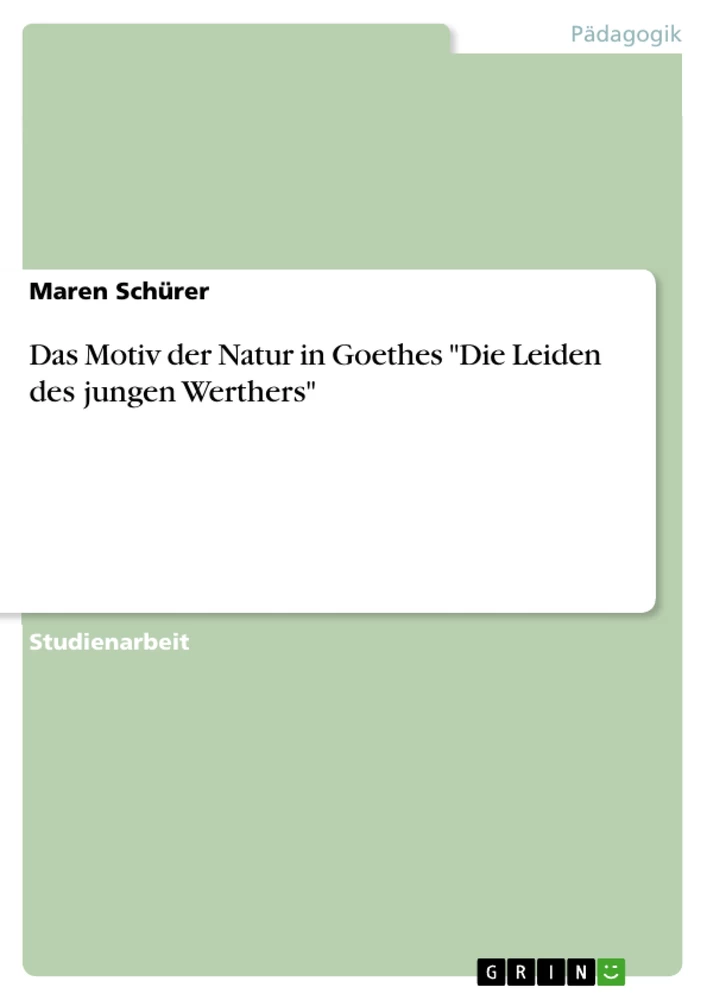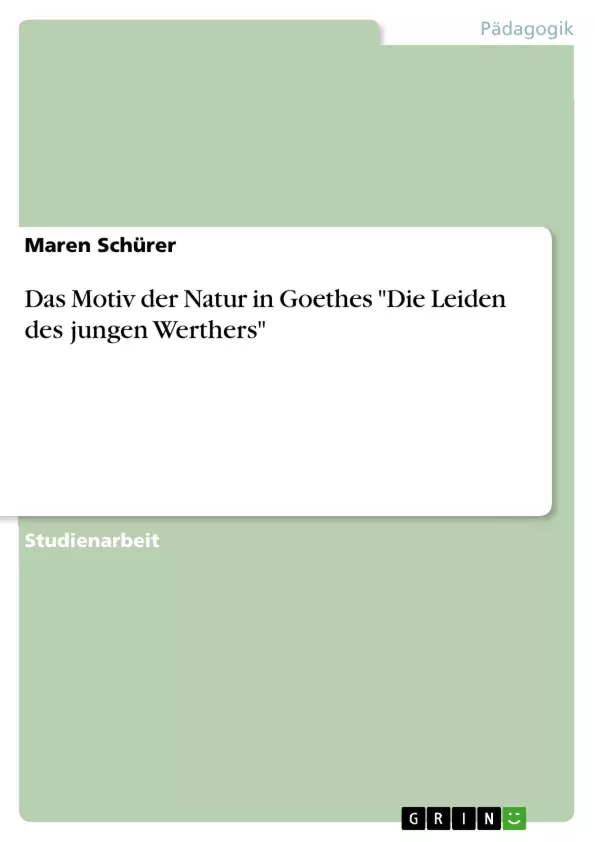Werther ist ein typisches Beispiel der Identitätskrise des 18. Jahrhunderts. Wie sich diese äußert und wie Werther versucht diese zu bewältigen, soll in dieser Arbeit erläutert werden. Insgesamt unternimmt Werther drei Versuche mithilfe von Natur, Liebe und Gesellschaft sein Leben zu stabilisieren. Hierbei liegt der Fokus auf der Natur, zu der Werther eine ganz besondere Verbindung erlebt, welche so stark ist, dass sie in pantheistischen Zügen kumuliert. Im Nachfolgenden werden die Parallelen von Werthers Naturerleben zu seiner Gefühlswelt, die Suche nach der eigenen Identität mithilfe der Natur und Gründe für das Scheitern daran näher erleuchtet. Des Weiteren werden Einblicke in Goethes religiöse Einstellung, seine eigene Haltung zum Pantheismus und zur Natur gewährt sowie ausgewählte Vergleiche zu anderen Werken Goethes gezogen.
Wie man bereits beim ersten Lesen des Werkes "Die Leiden des jungen Werthers" bemerkt, ist Werthers Verhältnis zur Natur ein ganz besonderes. Natur bedeutet für ihn Zuflucht, Sicherheit, Geborgenheit und offenbart die Anwesenheit übernatürlicher Kräfte. Es lassen sich demzufolge deutlich pantheistische Züge bei der Beschreibung der Natur erkennen. Durch die Natur versucht Werther sich zu identifizieren und sein Leben zu stabilisieren. Anhand seiner entweder positiv-euphorischen bzw. später negativ-hasserfüllten Beschreibung seiner Umgebung lassen sich Werthers innerste Gefühle ableiten. Man sieht, dass die Natur einige Parallelen zu Werthers Gefühlswelt aufweist.
Da Werther ein typischer Vertreter der Stürmer und Dränger ist, sieht auch er die Natur als einen lebendigen Organismus an. Er selbst ist dabei Teil dieses Organismus. Demzufolge dient die Natur im Sturm und Drang als Rückzugs- bzw. Zufluchtsort. Dies lässt sich ebenfalls auf Werther übertragen, der aus seinem städtischen Heimatort in das ländliche Wahlheim gezogen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werther und die Natur
- Allgemeines
- Die Rolle der Jahreszeiten
- Vergleich von Natur und Stadt
- Pantheistische Züge in Werthers Naturerleben
- Die Natur als Lösung für Werthers Identitätskrise
- Die Rolle der Natur in Goethes Leben und Werk
- Goethe ein Pantheist? - Goethes Bezug zur Religion
- Vergleich zu anderen Werken Goethes
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle der Natur im Werk „Die Leiden des jungen Werthers“ und beleuchtet, wie sie als Ausdruck von Werthers emotionalem Zustand und seinem Streben nach einer stabilen Identität dient. Die Analyse zeigt auf, wie Werthers Beziehung zur Natur pantheistische Züge aufweist und wie die Natur als Ort der Flucht aus der Gesellschaft und der Suche nach innerem Frieden fungiert.
- Werthers Verhältnis zur Natur als Spiegel seiner Gefühlswelt
- Die Rolle der Natur in Werthers Suche nach Identität
- Pantheistische Elemente in Werthers Naturerleben
- Die Bedeutung von Natur und Gesellschaft für Werthers psychisches Wohlbefinden
- Goethes eigene Einstellung zu Natur und Pantheismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Werthers Identitätskrise als zentrales Thema des Romans vor und beleuchtet seine Versuche, sein Leben mithilfe von Natur, Liebe und Gesellschaft zu stabilisieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Werthers Beziehung zur Natur und ihrer Bedeutung für seine emotionale Entwicklung.
Das Kapitel „Werther und die Natur“ beleuchtet Werthers besondere Beziehung zur Natur, die für ihn Zuflucht, Sicherheit und Geborgenheit bietet. Die Analyse zeigt die pantheistischen Züge in seiner Naturerfahrung auf und untersucht, wie die Natur als Ort der Identitätsfindung und Stabilisierung dient.
Das Kapitel „Die Rolle der Natur in Goethes Leben und Werk“ beleuchtet Goethes eigene Einstellung zu Natur und Pantheismus und stellt Vergleiche zu anderen Werken Goethes her, um die Relevanz der Natur im Kontext seiner Gesamtwerk zu erforschen.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werthers, Natur, Identität, Pantheismus, Stürmer und Dränger, Rousseau, Jahreszeiten, Gefühlswelt, Goethes Werk, Religion
- Quote paper
- Maren Schürer (Author), 2019, Das Motiv der Natur in Goethes "Die Leiden des jungen Werthers", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462242