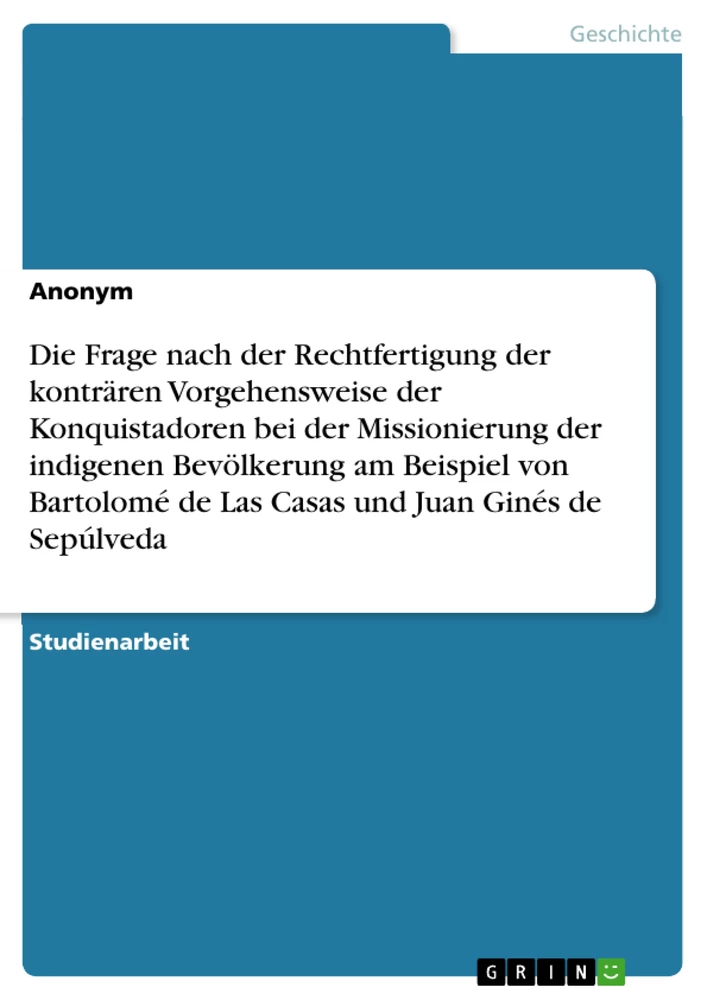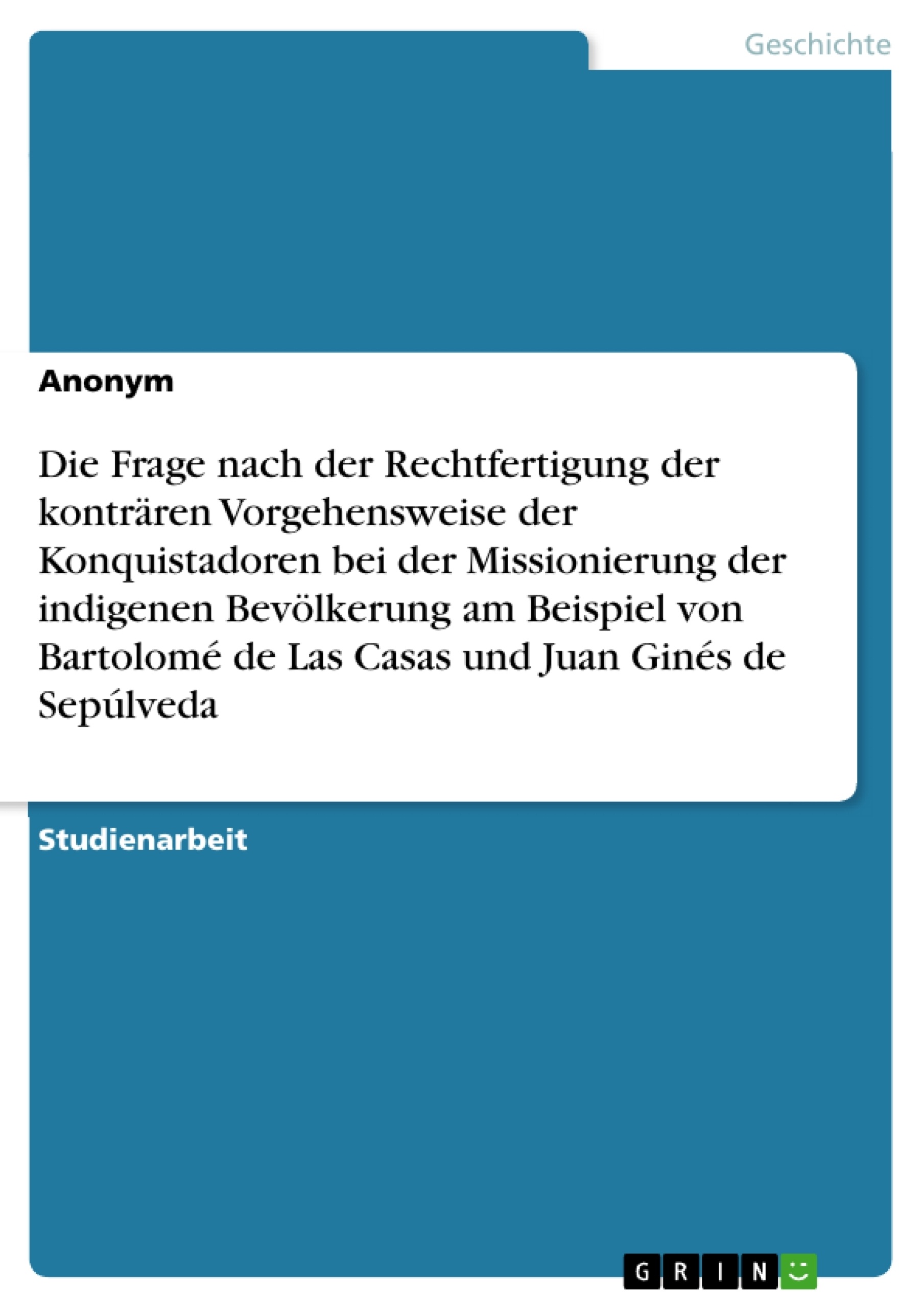Als Christoph Kolumbus im Jahr 1492 zum ersten Mal den Fuß auf ein Stück Land der ,,Neuen Welt" setzte, konnte vermutlich niemand erahnen, welche Folgen diese Tatsache mit sich bringen würde. Nach und nach drangen immer mehr spanische Konquistadoren in die „Neue Welt“ ein. Es begann mit der hoffnungsvollen Entdeckung und Erkundung der amerikanischen Gebiete und führte recht schnell zu einer Eroberung von noch nie da gewesenem Ausmaß. Zu der geographischen Entdeckung Amerikas kam die nicht weniger bedeutsame Entdeckung „der Anderen“ hinzu.
Schlussendlich war das Resultat der wohl größte Völkermord in der Geschichte der Menschheit, Anfang des 16. Jahrhunderts. Viele Indios wurden versklavt und ermordet, während sie selbst zunächst kaum verstanden, was nach einem jahrhundertelangen Leben ohne zu erwähnende Störung von außen mit ihnen geschah.
Einen hohen Stellenwert dieser Arbeit nimmt die kritische Betrachtung der viel zitierten eroberten ,,Neuen Welt" ein. Bei diesem Begriff geht man fast stillschweigend davon aus, dass die amerikanische Welt vor Kolumbus zwar existierte, aber auf keinen Fall mit der geistigen und kulturellen Wertigkeit des ,,alten" Abendlandes konkurrieren konnte. Dies lässt sich auch daraus schließen, dass die Ureinwohner als unterwürdig und barbarisch angesehen wurden. So ist Kolumbus 1492 auf einem Kontinent gelandet, der schon eine reiche Kulturgeschichte vorzuweisen hatte. Zu Beginn ist zu erwähnen, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Mission einige Schwierigkeiten mit sich bringt, da es hierbei schnell zu Bewertungen und Vorurteilen kommen kann. Aus diesem Grund ist die Thematik generell mit Vorsicht zu genießen, da es sich bei der Auseinandersetzung um eine Kommunikation auf moralischer Ebene handelt.
In dieser Arbeit erschien es nach anfänglichen Überlegungen als durchaus interessant, die Missionierung der frühen Neuzeit, aus der Sicht der indigenen Bevölkerung darzustellen und das schreckliche Vorhaben aus den Augen der Betroffenen darzulegen. Die aktuelle Quellenlage lässt dies jedoch nicht zu. Bezüglich der Thematik der Missionierung können nicht nur die Meinungen auseinander gehen und verschiedene Sicht- und Denkweisen entstehen, sondern auch in der Quellenlage lässt sich eine Unregelmäßigkeit erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Mission in der frühen Neuzeit - der Versuch einer Beschreibung
- Der Begriff Mission und sein Verständnis
- Der Versuch einer Beschreibung
- Die berühmte Adventspredigt des Antón Montesino 1511
- Bartolomé de Las Casas und seine Ziele
- Die Person und das Denken des Juan Ginés de Sepúlveda
- Der Disput von Valladolid
- Die Rolle und das Verhalten der Krone
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rechtfertigung des barbarischen Verhaltens der spanischen Konquistadoren während der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Sie analysiert die gegensätzlichen Sichtweisen auf die Missionierung der indigenen Bevölkerung, basierend auf den Positionen von Bartolomé de Las Casas und Juan Ginés de Sepúlveda.
- Die Missionierung der indigenen Bevölkerung in der frühen Neuzeit
- Die Rolle von Bartolomé de Las Casas als Verfechter der Rechte der Indios
- Die Gegenposition von Juan Ginés de Sepúlveda zur Behandlung der indigenen Bevölkerung
- Der Disput von Valladolid als Höhepunkt der Debatte über die Rechtfertigung der Eroberung
- Die Rolle der spanischen Krone in der Kolonialisierung und Missionierung Amerikas
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der spanischen Kolonialisierung Amerikas ein und beleuchtet die Bedeutung der Missionierung als integralen Bestandteil der Eroberung.
- Die Mission in der frühen Neuzeit - der Versuch einer Beschreibung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Mission in der frühen Neuzeit, untersucht unterschiedliche Sichtweisen und zeigt die moralische Dimension der Thematik auf.
- Bartolomé de Las Casas und seine Ziele: Das Kapitel konzentriert sich auf die Person und das Werk von Bartolomé de Las Casas, einem bekannten Verfechter der Rechte der Indios. Es beleuchtet seine Ziele und Bemühungen zur Verbesserung der Lage der indigenen Bevölkerung.
- Die Person und das Denken des Juan Ginés de Sepúlveda: Dieses Kapitel stellt die Gegenposition von Juan Ginés de Sepúlveda dar. Es untersucht seine Ansichten zur Behandlung der indigenen Bevölkerung und setzt sie in Relation zu den Positionen von Las Casas.
- Der Disput von Valladolid: Dieses Kapitel widmet sich dem berühmten Disput von Valladolid, einem öffentlichen Streitgespräch zwischen Las Casas und Sepúlveda, bei dem die Rechtfertigung der Kolonisierung Amerikas heftig diskutiert wurde.
- Die Rolle und das Verhalten der Krone: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der spanischen Krone in der Kolonialisierung und Missionierung Amerikas. Es betrachtet die politischen und wirtschaftlichen Motive hinter der Eroberung sowie die Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der spanischen Kolonialisierung, Missionierung, indigene Bevölkerung, Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, der Disput von Valladolid und die Rolle der spanischen Krone. Weitere wichtige Begriffe sind Völkermord, Menschenrechte, Kulturkonflikt und ethnische Ausbeutung.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren Las Casas und Sepúlveda?
Bartolomé de Las Casas war ein Dominikanermönch und Verfechter der Rechte der Indios, während Juan Ginés de Sepúlveda ein Gelehrter war, der die gewaltsame Eroberung und Unterwerfung der indigenen Bevölkerung rechtfertigte.
Was war der Disput von Valladolid?
Ein berühmtes Streitgespräch (1550–1551), in dem Las Casas und Sepúlveda vor einer Kommission über die moralische und rechtliche Zulässigkeit der Kriege gegen die Indios debattierten.
Mit welchen Argumenten rechtfertigte Sepúlveda die Gewalt?
Er betrachtete die Ureinwohner als „Barbaren“ und „Sklaven von Natur aus“, die aufgrund ihrer vermeintlichen kulturellen Unterlegenheit und „heidnischen“ Bräuche rechtmäßig unterworfen werden dürften.
Welche Ziele verfolgte Bartolomé de Las Casas?
Las Casas kämpfte für die Abschaffung der Encomienda-Systeme, die Anerkennung der Menschenwürde der Indios und eine friedliche Missionierung ohne militärische Gewalt.
Wie verhielt sich die spanische Krone in diesem Konflikt?
Die Krone schwankte zwischen wirtschaftlichen Interessen an der Ausbeutung der Kolonien und dem moralischen Anspruch, die Indios als Untertanen zu schützen, was zu widersprüchlichen Gesetzen führte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Die Frage nach der Rechtfertigung der konträren Vorgehensweise der Konquistadoren bei der Missionierung der indigenen Bevölkerung am Beispiel von Bartolomé de Las Casas und Juan Ginés de Sepúlveda, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462384